26 Oberlausitzer Bergland (OLB)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Downloaded from Brill.Com09/23/2021 09:14:00PM Via Free Access
russian history 44 (2017) 209-242 brill.com/ruhi What Do We Know about *Čьrnobogъ and *Bělъ Bogъ? Yaroslav Gorbachov Assistant Professor of Linguistics, Department of Linguistics, University of Chicago [email protected] Abstract As attested, the Slavic pantheon is rather well-populated. However, many of its nu- merous members are known only by their names mentioned in passing in one or two medieval documents. Among those barely attested Slavic deities, there are a few whose very existence may be doubted. This does not deter some scholars from articulating rather elaborate theories about Slavic mythology and cosmology. The article discusses two obscure Slavic deities, “Black God” and “White God,” and, in particular, reexamines the extant primary sources on them. It is argued that “Black God” worship was limited to the Slavic North-West, and “White God” never existed. Keywords Chernobog – Belbog – Belbuck – Tjarnaglófi – Vij – Slavic dualism Introduction A discussion of Slavic mythology and pantheons is always a difficult, risky, and thankless business. There is no dearth of gods to talk about. In the literature they are discussed with confidence and, at times, some bold conclusions about Slavic cosmology are made, based on the sheer fact of the existence of a par- ticular deity. In reality, however, many of the “known” Slavic gods are not much more than a bare theonym mentioned once or twice in what often is a late, un- reliable, or poorly interpretable document. The available evidence is undeni- ably scanty and the dots to be connected are spaced far apart. Naturally, many © koninklijke brill nv, leiden, 2017 | doi 10.1163/18763316-04402011Downloaded from Brill.com09/23/2021 09:14:00PM via free access <UN> 210 Gorbachov Slavic mythologists have succumbed to an understandable urge to supply the missing fragments by “reconstructing” them. -
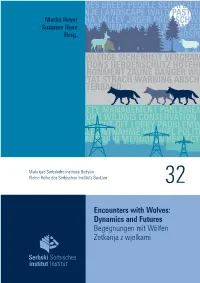
Encounters with Wolves
Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen 32 Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami 32 · 2020 Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami © 2020 Serbski institut Budyšin Sorbisches Institut Bautzen Dwórnišćowa 6 · Bahnhofstraße 6 D-02625 Budyšin · Bautzen Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž T +49 3591 4972-0 dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na F +49 3591 4972-14 zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych www.serbski-institut.de wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborska a Sakskeho krajneho sejma. [email protected] Gefördert durch die Stiftung für das sorbische Redakcija Redaktion Volk, die jährlich auf der Grundlage der von den Marlis Heyer, Susanne Hose Abgeordneten des Deutschen Bundestages, des Landtages Brandenburg und des Sächsischen Wuhotowanje Gestaltung Landtages beschlossenen Haushalte Zuwen- Ralf Reimann, Büro für Gestaltung, dungen aus Steuermitteln erhält. Bautzen Ćišć Druck Grafik S. 33 unter Verwendung eines 32 Union Druckerei Dresden GmbH Scherenschnitts von Elisabeth Müller, Collmen Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin ISBN 978-3-9816961-7-2 Grafik S. 87 nach GEO-Karte 5/2018 Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Page Content 5 Marlis Heyer and Susanne Hose Vorwort · Preface 23 Emilia -

OT Weigsdorf/Köblitz
HEIMATZEITUNG FÜR DAS CUNEWALDER TAL Mitteilungen, Berichte und Anzeigen für die Einwohner von Cunewalde und umliegende Orte – AMTSBLATT der Gemeinde Cunewalde – 30. Jahrgang /Nr. 9 6. September 2019 2,00 Euro Konstituierende Sitzung Neuer Gemeinderat ist vereidigt Mit der Vereidigung durch Bürger- meister Thomas Martolock hat der neu gewählte Cunewalder Gemeinderat am 21. August 2019 seine Arbeit in der Le- gislaturperiode 2019 bis 2024 aufge- nommen. Der Einladung zur konstituierenden Sitzung in der „Blauen Kugel“ waren neben 16 Mitgliedern des Rates, zwei fehlten wegen Urlaubs, auch mehr als 80 Bürgerinnen und Bürger von Cu- newalde gefolgt, die das Prozedere auf- merksam verfolgten. Die Vereidigung der Ratsmitglieder erfolgte in Block mit anschließendem persönlichem Handschlag. Bürgermei- ster Thomas Martolock schwor die Räte unter Einbeziehung der Vereidigungs- formel nach § 63 Sächsisches Beamten- Bürgermeister Thomas Martolock (links) mit dem neuen Cunewalder Gemeinderat von links: Dr. Udo Mann, Frank Berg- Gesetz (SächsBG) und § 35 der Säch- mann, Hagen Kriegel, Hans-Jürgen Dittmann, Rüdiger Brabandt, Claudia Zimmermann, Ulf Gedan, Hans-Uwe Pschola, sischen Gemeindeordnung (SächsGe- Dr. Michael Hanisch, Markus Schuster, Jürgen Schulz, Frank Unger, Hagen Spitzbarth, Dirk Kahlert, Andreas Bär und mO) ein: „Ich schwöre, dass ich mein Thomas Preusche. Es fehlen Andreas Löchel und Florian Sieber. Amt nach bestem Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit ge- ßenden Ausschüsse an, anschließend genüber allen üben werde.“ wurden die beratenden Ausschüsse Nach der Vereidigung des Gemein- durch Wahlentscheidung besetzt. Wei- derates wandte sich Bürgermeister tere Wahlen folgten: Die Wahl der Ge- Thomas Martolock sowohl an die ge- meinderatsvertreter in der Gesellschaf- wählten Räte als auch die anwesende terversammlung der Cunewalder Tal- Bürgerschaft. -

Gemeindeverwaltung Cunewalde 56
HEIMATZEITUNG FÜR DAS CUNEWALDER TAL Mitteilungen, Berichte und Anzeigen für die Einwohner von Cunewalde und umliegende Orte – AMTSBLATT der Gemeinde Cunewalde – 25. Jahrgang/Nr. 3 7. März 2014 1,50 Euro Sanierung der Bergbaude auf dem Czorneboh Stadt Bautzen will investieren! In den vergangenen 6 Monaten stand der Czorneboh in den Schlagzeilen der regionalen Presse wie lange nicht und selten zuvor. Im Sommer 2014 mussten Presse und Funk vermelden, dass die langjährige Pächterin Mandy Plößl samt Familie den Betrieb der Bergbaude überwiegend aus gesundheitlichen Gründen zum 30. September aufgeben muss. Hier über war die Stadt Bautzen als Eigentümer schon im Frühjahr in Kenntnis gesetzt worden. Je näher der letzte Tag des Baudenbe- triebes rückte, umso lauter wurden die Fragen nach dem Fortbestand. Ein über- gangsloser Winterbetrieb durch einen neuen Pächter war nicht möglich, zumal sich nun für die Stadt Bautzen Fragen Die Czornebohbaude wie wir alle sie kennen. An sonnigen Tagen lässt es sich gut ausruhen vor dem Berggasthof, aber wir hinsichtlich des zweifellos bestehenden brauchen noch etwas Geduld, bis neues Leben einzieht in die Gemäuer. Sanierungsstaus stellten. Angesichts der Probleme in nahezu allen Bereichen von Doch dem ist nicht so! In einem Sanierungsarbeiten veranlasst. Für diese Also Freunde des Cunewalder Haus- Küche über Sanitäranlagen bis hin zu Schreiben von Bautzens Bürgermeister Vorhaben sollen 2014 etwa 250.000 € berges: Entspannung ist angesagt! Es den Beherbergungsmöglichkeiten konn- Michael Böhmer an das Cune walder Ge- zur Verfügung stehen. Nachfolgend sieht so aus, als sollte die Bergbaude te der Eigentümer auch keine schnelle meindeoberhaupt Thomas Martolock werden ab 2015 für die Komplettsanie- wieder besseren Zeiten entgegen gehen. -

Gemeindeverwaltung Cunewalde Am Mittwoch, Dem 16
HEIMATZEITUNG FÜR DAS CUNEWALDER TAL Mitteilungen, Berichte und Anzeigen für die Einwohner von Cunewalde und umliegende Orte – AMTSBLATT der Gemeinde Cunewalde – 30. Jahrgang /Nr. 10 11. Oktober 2019 2,00 Euro Albert-Schweitzer-Siedlung 10 bis 18. Hier sind die Arbeiten abgeschlossen, das Albert-Schweitzer-Siedlung 19 bis 27. Hier sind die Arbeiten in vollem Gange, in Ergebnis kann sich sehen lassen. ein paar Wochen soll alles fertig sein. Albert-Schweitzer-Siedlung Schlosserteich Weigsdorf-Köblitz Das sieht doch gut aus Baubeginn nicht möglich Ende September sind die ersten Inzwischen ist das Bauunternehmen In unserer Juli-Ausgabe hatten wir Thomas Martolock verwies in diesem beiden Bauabschnitte des Gesamt- auf den 3. Bauabschnitt gezogen. Hier auf den eventuell bevorstehenden Zusammenhang auf den noch ausste- vorhabens „Insel der Generationen“ im Bereich ASS 19 bis 27 wird gerade Baubeginn am Schlosserteich in henden geänderten Zuwendungsbe- in der Albert-Schweitzer-Siedlung in an der Erneuerung der Straße gearbei- Weigsdorf-Köblitz aufmerksam ge- scheid für die dafür erforderlichen För- Weigsdorf-Köblitz abgenommen tet, erste Straßenborde stehen bereits. macht. dermittel. Ein Baustart ohne die Zusage worden. Bis auf ein paar Kleinig- Daß diese Arbeiten mit Unannehmlich- Nach seinerzeitigem Stand schien der auf Förderung wäre zu riskant, die Ge- keiten sind die baulichen Zielset- keiten und Belastungen für die Anwoh- Beginn der Bauarbeiten zum Termin meinde Cunewalde hat diesbezüglich zungen erreicht worden. ner verbunden sind, ist unvermeidbar. der Herbstferien im Oktober realis- leider auch schlechte Erfahrungen ma- Noch nicht endgültig entschieden Längere Wege zum Einkauf, die provi- tisch. Das Bauvorhaben sollte mit Ar- chen müssen. sind die verkehrsrechtlichen Belange. -

Von Zeit Zu Zeit Hdys a Hdys 26
VON ZEIT ZU ZEIT HDYS A HDYS 26. AUGUST 2020 NEUES AUS DER LANDKREISVERWALTUNG | NOWOSĆE Z WOKRJESNEHO ZARJADA WAS LANGE WÄHRT… Von Zeit zu Zeit – Freiwillige Feuerwehren werden modernisiert Hdys a hdys Für die Kameradinnen und Kamera- den der Freiwilligen Feuerwehren in Klix, Neukirch (b. Königsbrück) und Großdrebnitz hat das lange Warten auf eine finanzielle Unterstützung für ihre in die Jahre gekommenen Feuer- wehrgerätehäuser nun ein Ende. Bei- geordnete Birgit Weber überbrachte den drei Wehren im August die Be- scheide, über die durch den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Fördermittel. Damit können nun alle drei Feuerwehrgerätehauser auf den neuesten Stand gebracht werden. Sieben Jahre haben die Klixer Kameraden warten müssen. Dank der Fördermittel des …müssen wir uns immer wieder den Realitäten stellen. Der Sommer ist vor- Freistaates kann nun der Neubau starten. Freiwillige Feuerwehr Klix bei. Der Schulbetrieb wird aufgenom- Bürgermeister Lutz Mörbe freute sich sehr, men und die ABC-Schützen können nach so langer Zeit endlich loslegen zu das kommende Wochenende mit der können und versprach, die Einweihung Freiwillige Feuerwehr Großdrebnitz Schuleingangsfeier kaum erwarten. Die gemeinsam mit allen Beteiligten groß zu jungen Absolventen, welche zehn oder feiern. zwölf Jahre Schule hinter sich haben, stehen am Beginn zu Ausbildung oder Auch die Großdrebnitzer Kameraden Studium und damit ebenso vor einem nahmen den Fördermittelbescheid aus neuen Lebensabschnitt. Birgit Webers Händen dankend entgegen. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses So mancher der Oberschulabsolventen kann damit ebenfalls in die Tat umgesetzt wird sich an den eigenen Schuleingang werden. vor zehn Jahren erinnern, der buch- stäblich ins Wasser fiel. Im Einzugs- Einsatzbereit und voller Vorfreude war- bereich der Spree und deren Zuflüsse teten am 14. -

LEADER-Entwicklungsstrategie Der Region Bautzener Oberland
LEADER - Entwicklungsstrategie der Region Bautzener Oberland Impressum Auftraggeber: Verein zur Entwicklung de r Region Bautzener Oberland e.V. Karl - Marx - Straße 16/17 02627 Hochkirch Bearbeiter: neuland Landschafts - und Freiraumplanung | Regionalmanagement Lindenberger Straße 46 b D - 02 736 Oppach Dipl. - Ing. Ulrike Neumann Dipl. - Ing. Beate Mücke Dipl. - Ing. Heike Augustin Dipl. - Kfm. Manuel Saring M.A. Susanne Schwarzbach Stand 15.03.2016 /2. Änderung Hinweis zur Gender - gerechter Formulierung: Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird. Quellen: Alle Karten wurden durch den Bearbeiter erstellt (wenn nicht anders ang e- geben). Die statistischen Daten beruhen (wenn nicht anders angegeben) auf gelieferte n Daten des Statistischen Lan des amtes Sachsen. Fotonachweis: Verein zur Entwicklung der Region Bautzener Oberland e.V . LEADER - Entwicklungsstrategie der Region Bautzener Oberland – Fassung vom 15.03.2016 2 I NHALT Abkürzungsve rzeichnis ................................ ................................ ................................ ........................ 5 Kurzzusammenfassung der LEADER - Entwicklungsstrategie für die Region Bautzener Oberland ........... 6 1 Gebiet und Bevölkerung ................................ ................................ ................................ .............. 8 1.1 Geographische, wirtschaftliche und soziokulturelle Kohärenz ............................... -

Abhandlungen Und Berichte Des Naturkundemuseums Görlitz
© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at Flora der Oberlausitz preussischen und sächsischen Anteils einschliesslich des nördlichen Böhmens. Auf Grund eigener und anderweitiger Beobachtungen unter Berücksichtigung älterer floristischer Arbeiten zusammengestellt von E. Barber. III. Teil. Die Dicotyledonen. Abteilung II. Reihe: ROSALES. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at Vorbemerkung zu Teil III, Abteilung II. Nachstehende Fortsetzung der „Flora der Oberlausitz“ schliesst sich systematisch nicht unmittelbar an die vorausgegangenen Teile I und II (vergl. Bd. XXII und XXIII der Abhandlungen) an, da Teil III, 1. Abteilung, einer späteren Bearbeitung unterzogen werden soll. Der Grund dafür ist einerseits darin zu suchen, dass die Forschungen bezüglich der Salices im Gebiet noch nicht zum Abschluss gelangten, andererseits darin, dass der Verfasser sich seit einer Reihe von Jahren eingehender mit den kritischen Gattungen Rosa, Rubus und Potentilla befasste und die dabei gemachten Be¬ obachtungen gern der Öffentlichkeit übergeben möchte. Von dem seither geübten Verfahren, nur Standortsangaben über anderenorts genügend bearbeitete Pflanzen zu machen, ist der Verfasser bezüglich der Gattung Rubus abgewichen. Eine ein¬ gehende diagnostische, aus der Praxis hervorgegangene Behandlung dieser ungemein schwierigen und formenreichen Gattung dürfte angehenden Jüngern der Wissenschaft nicht unerwünscht sein. Um freundliche Nachsicht bittet Der Verfasser. © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at Reihe 11. ROSALES, Rosenähnliche. 49. Fam.: CRASSILACEAE, Dickhlattgewächse. 224. Sedum L. Fetthenne. a) Telephium Koch. 611. S. maximum Sut. Grosse Fetthenne. S. Telephium L. z. T. S. latifolium Bert. Kölb. 908, Fechner 227,1. Buschige, steinige Hügel, Felsen, Mauern, Ackerraine, trockene Wälder, Hecken. Im Hügellande verbreitet, besonders häufig und kräftig auf den Basaltkuppen: Landskrone, Rot¬ stein, Löbauer Berg, Stromberg usw. -

2 PAST EVENTS ...2 Library NEWS ...5
wendish news WENDISHW HERITAGE SOCIETY A USTRALIA NUMBER 56 MARCH 2016 C ONTENTS CALENDAR OF UPCOMING EVENTS ........ 2 PAST EVENTS ..................... 2 Clockwise from top: LIBRARY NEWS ................... 5 1. Mary Cooper at our Research Centre with TOURS ......................... 6 our new sign, made by John Modra. 2. Janice Blackburn. RESEARCH ...................... 8 3. Richard Albert. 4. Glenys Wollermann. TRIBUTE ...................... .10 5. Beryl Nagorcka. 6. Betty Huf and Mary Cooper. GENERAL NEWS ................. .12 PHOTOS SUPPLIED BY JOHN MODRA AND DIRECTORY ..................... .12 JOEL & JANICE BLACKBURN. Calendar of upcoming events ***Annual General Meeting*** Saturday 16 April 2016: Wend/Sorb Saturday 2 April 2016 Society of S.A. Historical Bus Trip Our Society’s AGM will be held at 1.30 pm, fol- The bus trip will start at 8.30 am sharp from lowed by afternoon tea. All are welcome. the south side of South Terrace, Adelaide. The The venue is our meeting room at St Aidan’s destinations include Gawler, Concordia, Bethany, Community Centre, 12 Surrey St, Box Hill Tanunda, Moculta, Keyneton, Sedan, Cambrai, South, Victoria. Birdwood and Oakbank. The cost is $45 per per- Proxies will be accepted. Please appoint a proxy son. Payment to “Wend/Sorb Society of S.A.” is if you are unable to attend, to ensure that we have required with booking before 26 March. Book early a quorum for this important meeting. Please see the to secure a seat. enclosed proxy form. We need 26 members, includ- Contact Ruth Walter: (08) 8269 7168 ing proxies, for a quorum. Committee members may and post to 43 Clifton St. Prospect, S.A. -

Lehrpfade Im Landkreis Görlitz 27 Naturlehrpfade Des Landkreises Görlitz Vorgestellt
Gefördert durch: Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Lehrpfade im Landkreis Görlitz 27 Naturlehrpfade des Landkreises Görlitz vorgestellt Herausgeber Landkreis Görlitz, 2011 LEHRPFADE IM LANDKREIS GÖRLITZ Diese Broschüre entstand im Rahmen des grenzübergreifenden deutsch-tschechischen Ziel3-Umweltbildungs- projektes »Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz in der Euroregion Neiße« . Bestandteile des Projektes sind u. a.: die Herausgabe von populärwissenschaftlichen Publikationen des Bezirkes Liberec in deutscher Sprache, die Herausgabe von zwei populärwissenschaftlichen Publikationen über den Landkreis Görlitz in deutscher und tschechischer Sprache, die Herausgabe von drei zweisprachigen Fotokalendern für die Jahre 2010, 2011/2012 und 2013 sowie Projekt begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Anliegen des Projektes ist es, Landschaften, Naturschönheiten und Schutzgüter des im Zuge der Gebiets- reform neu entstandenen Landkreises Görlitz und des angrenzenden Landschaftsschutzgebietes »Lužické hory« – »Lausitzer Gebirge« vorzustellen. Kontakt Naturschutzzentrum »Zittauer Gebirge« gemeinnützige GmbH Geschäftsführer: Herr Hans-Gert Herberg Projektpartner: Goethestraße 8 Landkreis Görlitz (Leadpartner) 02763 Zittau www.kreis-goerlitz.de Tel. 0049 3583 512512 [email protected] www.naturschutzzentrum-zittau.de Společnost pro Lužické hory Valdov 12 471 25 Jablonné v Podještědí Büro: Zdislavy z Lemberka 335 471 25 Jablonné -

Mitteilungen Des Vereins Sächsischer Ornithologen
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen Jahr/Year: 2002-06 Band/Volume: 9 Autor(en)/Author(s): Zimmermann Rudolf, Stamm Hans Christoph Artikel/Article: Die Vogelwelt der Oberlausitzer Niederung - eine faunistisch- ökologische Studie 141-184 FID Biodiversitätsforschung Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen Die Vogelwelt der Oberlausitzer Niederung - eine faunistisch-ökologische Studie Zimmermann, Rudolf Stamm, Hans Christoph 2003 Digitalisiert durch die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main im Rahmen des DFG-geförderten Projekts FID Biodiversitätsforschung (BIOfid) Weitere Informationen Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im: Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main. Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten Identifikator: urn:nbn:de:hebis:30:4-131916 Mitt . Ver . Sächs . Ornithol . 9 , 2003 : S . 141 - 184 Die Vogelwelt der Oberlausitzer Niederung Eine faunistisch - ökologische Studie Ein nachgelassenes Fragment von RUDOLF ZIMMERMANN († 1943 ) mit einer Vorbemerkung von HANS CHRISTOPH STAMM The Birds of the Upper Lusatian lowlands . RUDOLF ZIMMERMANN ( 1878 - 1943 ) , founder and long Standing editor of the Journal of the Association of Saxonian Ornithologists (Mitteilungen des Vereins sächsischer Ornithologen ) worked from 1920 for two -

Cunewalder Karneval Ruft
HEIMATZEITUNG FÜR DAS CUNEWALDER TAL Mitteilungen, Berichte und Anzeigen für die Einwohner von Cunewalde und umliegende Orte – AMTSBLATT der Gemeinde Cunewalde – 24. Jahrgang/Nr. 2 8. Februar 2013 1,50 Euro Feuerwehrgerätehaus Hochwasserschäden werden beseitigt Bürgermeisterwahl am 9. Juni 2013 Nachdem im vergangenen Jahr die bausubstanz muss voraussichtlich die Mit Beschluss des Cunewalder Gemeinderates vom 19. Dezember 2012 Schäden am Dach des Feuerwehrge- Heizungsanlage demontiert und natür- findet am 9. Juni 2013 die Wahl des Cunewalder Bürgermeisters statt. Der rätehauses an der Czornebohstraße be- lich wieder aufgebaut werden. An der Urnengang ist erforderlich, weil die 7jährige Amtszeit von Bürgermeister seitigt werden konnten, sind nun end- Außenfassade sind im Sockelbereich Thomas Martolock am 31. Juli 2013 turnusmäßig endet. lich die Hochwasserschäden am Haupt- ebenfalls Arbeiten notwendig, wie bei- haus an der Reihe. Die Arbeiten sind spielsweise die Herstellung eines Kies- Als Termin einer eventuell erforderlichen Neuwahl ist der 23. Juni 2013 vorige Woche in Angriff genommen bettes zum Spritzwasserschutz. festgesetzt worden. Die amtlichen Bekanntmachungen zu Berwerbungen worden. Am Anfang stand die Aufnah- Die Reparaturarbeiten verursachen und Fristen erfolgen in der März-Ausgabe der CBZ. me von Teilen des Fußbodens, Trocken- Kosten in Höhe von etwa 57.000 €. bauwände sind zu entfernen und wieder 90 % davon werden durch Fördermittel einzuziehen. aus dem Hochwasserschutzfond ge- Aufgrund der Arbeiten an der Grund- deckt. Stützmauer Hauptstraße Obercunewalde Mitte März beginnt 2-Jahres-Baustelle! Nicht erst nach Ostern, sondern be- angelegt. Im Laufe der Bauarbeiten wer- reits am 18. März erfolgt der Startschuss den recht aufwendige Verlegungen von zum Bauvorhaben „Stützmauer an der Medienleitungen (Elektro, Trinkwasser, Hauptstraße“.