Abhandlungen Und Berichte Des Naturkundemuseums Görlitz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Downloaded from Brill.Com09/23/2021 09:14:00PM Via Free Access
russian history 44 (2017) 209-242 brill.com/ruhi What Do We Know about *Čьrnobogъ and *Bělъ Bogъ? Yaroslav Gorbachov Assistant Professor of Linguistics, Department of Linguistics, University of Chicago [email protected] Abstract As attested, the Slavic pantheon is rather well-populated. However, many of its nu- merous members are known only by their names mentioned in passing in one or two medieval documents. Among those barely attested Slavic deities, there are a few whose very existence may be doubted. This does not deter some scholars from articulating rather elaborate theories about Slavic mythology and cosmology. The article discusses two obscure Slavic deities, “Black God” and “White God,” and, in particular, reexamines the extant primary sources on them. It is argued that “Black God” worship was limited to the Slavic North-West, and “White God” never existed. Keywords Chernobog – Belbog – Belbuck – Tjarnaglófi – Vij – Slavic dualism Introduction A discussion of Slavic mythology and pantheons is always a difficult, risky, and thankless business. There is no dearth of gods to talk about. In the literature they are discussed with confidence and, at times, some bold conclusions about Slavic cosmology are made, based on the sheer fact of the existence of a par- ticular deity. In reality, however, many of the “known” Slavic gods are not much more than a bare theonym mentioned once or twice in what often is a late, un- reliable, or poorly interpretable document. The available evidence is undeni- ably scanty and the dots to be connected are spaced far apart. Naturally, many © koninklijke brill nv, leiden, 2017 | doi 10.1163/18763316-04402011Downloaded from Brill.com09/23/2021 09:14:00PM via free access <UN> 210 Gorbachov Slavic mythologists have succumbed to an understandable urge to supply the missing fragments by “reconstructing” them. -

Vattenfall's Opportunity
A future forLusatiawithoutlignite A future opportunityVattenfall’s www . greenpeace . de This study was commissioned by Greenpeace Germany and executed by Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Katharina Heinbach, Mark Bost, Steven Salecki, Julika Weiß Berlin | April 2015 Kein Geld von Industrie und Staat Greenpeace ist international, überparteilich und völlig unabhängig von Politik, Parteien und Industrie. Mit gewaltfreien Aktionen kämpft Greenpeace für den Schutz der Lebensgrundlagen. Rund 590.000 Menschen in Deutschland spenden an Greenpeace und gewährleisten damit unsere tägliche Arbeit zum Schutz der Umwelt. Impressum Greenpeace e. V., Hongkongstraße 10, 20457 Hamburg, Tel. 040/3 06 18 - 0 Pressestelle Tel. 040/3 06 18 - 340, F 040/3 06 18-340, [email protected] , www . greenpeace . de Politische Vertretung Berlin Marienstraße 19 – 20, 10117 Berlin, Tel. 030/30 88 99 - 0 V.i.S.d.P. Gregor Kessler Foto Paul Langrock / Greenpeace Zur Deckung unserer Herstellungskosten bitten wir um eine Spende: GLS Bank, IBAN DE49 4306 0967 0000 0334 01, BIC GENODEM1GLS Gedruckt auf 100% Recyclingpapier ROAD MAP FOR TRANSITION — VATTENFALL 2030 | 3 Contents 1 Introduction ........................................................................................................... 6 2 The Phaseout of Lignite ........................................................................................ 6 2.1 Lignite in the context of low-carbon targets ....................................................................................... 7 2.1.1 -

OT Weigsdorf/Köblitz
HEIMATZEITUNG FÜR DAS CUNEWALDER TAL Mitteilungen, Berichte und Anzeigen für die Einwohner von Cunewalde und umliegende Orte – AMTSBLATT der Gemeinde Cunewalde – 30. Jahrgang /Nr. 9 6. September 2019 2,00 Euro Konstituierende Sitzung Neuer Gemeinderat ist vereidigt Mit der Vereidigung durch Bürger- meister Thomas Martolock hat der neu gewählte Cunewalder Gemeinderat am 21. August 2019 seine Arbeit in der Le- gislaturperiode 2019 bis 2024 aufge- nommen. Der Einladung zur konstituierenden Sitzung in der „Blauen Kugel“ waren neben 16 Mitgliedern des Rates, zwei fehlten wegen Urlaubs, auch mehr als 80 Bürgerinnen und Bürger von Cu- newalde gefolgt, die das Prozedere auf- merksam verfolgten. Die Vereidigung der Ratsmitglieder erfolgte in Block mit anschließendem persönlichem Handschlag. Bürgermei- ster Thomas Martolock schwor die Räte unter Einbeziehung der Vereidigungs- formel nach § 63 Sächsisches Beamten- Bürgermeister Thomas Martolock (links) mit dem neuen Cunewalder Gemeinderat von links: Dr. Udo Mann, Frank Berg- Gesetz (SächsBG) und § 35 der Säch- mann, Hagen Kriegel, Hans-Jürgen Dittmann, Rüdiger Brabandt, Claudia Zimmermann, Ulf Gedan, Hans-Uwe Pschola, sischen Gemeindeordnung (SächsGe- Dr. Michael Hanisch, Markus Schuster, Jürgen Schulz, Frank Unger, Hagen Spitzbarth, Dirk Kahlert, Andreas Bär und mO) ein: „Ich schwöre, dass ich mein Thomas Preusche. Es fehlen Andreas Löchel und Florian Sieber. Amt nach bestem Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit ge- ßenden Ausschüsse an, anschließend genüber allen üben werde.“ wurden die beratenden Ausschüsse Nach der Vereidigung des Gemein- durch Wahlentscheidung besetzt. Wei- derates wandte sich Bürgermeister tere Wahlen folgten: Die Wahl der Ge- Thomas Martolock sowohl an die ge- meinderatsvertreter in der Gesellschaf- wählten Räte als auch die anwesende terversammlung der Cunewalder Tal- Bürgerschaft. -

Ein Dorf Steigt Auf !!! Ab
02/2014 Vereins-Nachrichten des Sportvereins Trebendorf Ein Dorf steigt auf !!! ab. Die Freude der Spieler, Verant- 22 Toren gefolgt von Michael Die Tabellenführer sind wortlichen sowie der Fans des SV Werchosch mit 10 Toren haben nicht mehr zu schlagen Trebendorf war grenzenlos. Nach natürlich einen großen Anteil - der SV Trebendorf ist drei Jahren hat der SV Trebendorf am Erfolg. Besonders erwähnen den Aufstieg in die Kreisoberliga möchten wir, dass Guido die Saisonmeister geschaff t. Mannschaft die erste Saison trai- niert und aus den Reihen als Spie- Am Sonntag den 04.05.2014 kam Trebendorf spielte in diesem Jahr ler der ersten Männer kommt. Das der Tabellenzweite aus SEE nach die beste Saison überhaupt. Das Ziel und der Erfolg zeigt, was bei Trebendorf. Die Anspannung spiegelt sich in der Statistik vom einer guten Zusammenarbeit er- zwischen beiden Teams vor dem Mai 2014 wieder. Von 120 säch- reichbar ist. Spiel war spürbar. Von Beginn an sischen Vereinen in der Kreisliga/ Die Mannschaften, Trainer und haben beide Teams gekämpft Sachsen in der Saison 2013/14 Verantwortliche sind mächtig und den Fans guten Fußball ge- hat Trebendorf den ersten Tabel- stolz auf das Erreichte und wün- boten. Trebendorf übte etwas lenplatz in der Kategorie „Bester schen sich für die neue Saison auf mehr Druck aus und der Schluss- Sturm“ mit 127 Toren belegt - der jeden Fall den Klassenerhalt in der mann von SEE konnte ein bis zwei Zweitplatzierte Liebstädter SV Kreisoberliga sowie Kreisliga. Torschüsse verhindern. Nach 21 schoss 119 Tore der Platz 120 Blau Auch für Trebendorf selbst wird Minuten netzte Martin Prochaska Weiß Leipzig hat 72 Tore geschos- die Präsenz nicht nur in der Presse zum 1:0 ein. -

Herzlich Willkommen Zum Weihnachtsmarkt in Horka
Gemeinde Gemeinde Horka Neißeaue Gemeinde Gemeinde Kodersdorf Schöpstal VERWALTUNGSVERBAND WEISSER SCHÖPS/NEISSE Herausgeber: Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße. Für amtliche Mitteilungen verantwortlich: Verwaltungsverbandsvorsitzender oder seine Vertreter im Amt. Anzeigenannahme: MARKETINGFIRMA, Ebermann und Rast GbR, Königshainer Straße 5, 02906 Niesky, Telefon 03588 2944345, Fax 03588 2944347, E-Mail: [email protected]; Satz + Druck: Gustav Winter Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH, Gewerbestraße 2, 02747 Herrnhut, Telefon 035873 418-0, Fax 41888 Nr. 12 4. Dezember 2019 24. Jahrgang INHALT Herzlich willkommen zum Amtliche Bekanntmachungen Verwaltungsverband Weihnachtsmarkt Weißer Schöps/Neiße S. 2 Gemeinde Horka S. 6 Gemeinde Kodersdorf S. 8 10. in Horka Gemeinde Neißeaue S. 10 am Freitag, Gemeinde Schöpstal S. 14 6. Dezember 2019, Mitteilungen und Informationen ab 16.00 Uhr Gemeinde Horka S. 14 Gemeinde Kodersdorf S. 20 auf dem Schulhof der Grundschule Horka Gemeinde Neißeaue S. 24 Gemeinde Schöpstal S. 28 Die nächste Ausgabe erscheint am 15.1.2020. Redaktionsschluss ist der 12.12.2019. Redaktion Amtsblatt Elke Geier Gemeinde Horka Am Gemeindeamt 2 02923 Horka Tel. 035892 3273 Fax 035892 3041 [email protected] www.weisserschoeps- neisse.de Stellenausschreibung Der Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße beabsichtigt schnellst- möglich eine/einen Sachgebietsleiter/in im Bereich Allgemeine Verwaltung (Teilzeitbeschäftigung mit 36 Wochenstunden/ Vergütung nach TVöD Entgeltgruppe 9c) befristet gemäß §14 Abs. 1 S. 2 Nr. -

Rundgang Für Das Neue Sportlerheim Grundsteinlegung
Vereins-Nachrichten des Sportvereins Trebendorf | Ausgabe 08 | November 2011 Rundgang für das neue Sportlerheim René Kraink, Vereinsvorsitzender Um noch mal unser Vereinshaus ins Ge- dächtnis zu rufen ein kleiner Rundgang: Wenn man ins Vereinsgebäude kommt, dann sind im Erdgeschoss links Gastro- 1 bereich und zwei Bowlingbahnen, rechts die behindertengerechte Sanitäranlage und Umkleide für den großen Gymnasti- kraum. Dieser wird ausgestattet mit einer Fußbodenheizung und Spiegelwand. Die Kindergartenkinder werden diesen Raum mit nutzen. Auf dieser Ebene befindet sich ebenso der Zugang in den Mehrzweckraum. Hier können nicht nur Volleyball, Hallenfuß- ball, Badminton und anderes gespielt wer- 3 2 den, auch kann er als Veranstaltungssaal dienen. Dieser hat große Ausgänge zum Festplatz und kann dadurch bei Bedarf mit einem Festzelt verlängert werden. Der Raum kann aber auch in der Mitte abge- trennt werden, um zwei kleinere Räume bzw. Felder zu erhalten. Auf dieser Ebene befinden sich ebenfalls ein Erste-Hilfe-, Wäsche- und Fitnessraum. Im Obergeschoss entstehen die Räume für die Vereine und Trainer oder auch zum Beispiel der Regieraum für den Sta- dionsprecher, der Billardraum und das Vereinszimmer etc. Außerdem entsteht ein separates Gebäude mit Doppelgarage, 4 Werkstatt und Jugendclub-Bereich. Drau- ßen entstehen Kunstrasenplatz mit Flut- licht, Tribüne und integrierter Kampfbahn Grundsteinlegung des neuen Vereinshauses für unsere Feuerwehr. am 01. Juli 2011 Bild 1: Zahlreiche Vertreter und Mitglieder Tanzteufeln“ und „der Trommlerfrauen“. der Vereine und der Feuerwehr in der Ge- Der Applaus war Ihnen sicher. meinde Trebendorf nahmen interessiert an dieser Veranstaltung teil. Bild 4: Die aktuellen Tageszeitungen und weitere symbolische Gegenstände werden Bild 2 und 3: Das durch den Sportverein Inhalte der einzubetonierenden Zeitkapsel. -
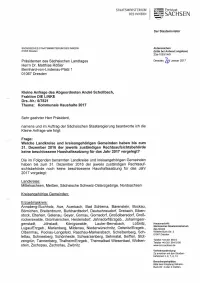
T'31 SACHSEN C C23
STAATSMINISTERIUM -;-= Freistaat DES INNERN t'31 SACHSEN c c23, Der Staatsminister SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN Aktenzeichen 01095 Dresden (bitte bei Antwort angeben) 23a-1053/14/9 Präsidenten des Sächsischen Landtages Dresden, 7 0 Januar 2017 Herrn Dr. Matthias Rößler Bernhard -von -Lindenau -Platz 1 01067 Dresden Kleine Anfrage des Abgeordneten Andre Schollbach, Fraktion DIE LINKE Drs.-Nr.: 6/7821 Thema: Kommunale Haushalte 2017 Sehr geehrter Herr Präsident, namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: Frage: Welche Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden haben bis zum 31. Dezember 2016 der jeweils zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde keine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2017 vorgelegt? Die im Folgenden benannten Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden haben bis zum 31. Dezember 2016 der jeweils zuständigen Rechtsauf- sichtsbehörde noch keine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2017 vorgelegt: Landkreise: Mittelsachsen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Nordsachsen Kreisangehörige Gemeinden: Erzgebirgskreis: Annaberg-Buchholz, Aue, Auerbach, Bad Schlema, Bärenstein, Bockau, Börnichen, Breitenbrunn, Burkhardtsdorf, Deutschneudorf, Drebach, Eiben- stock, Elterlein, Gelenau, Geyer, Gornau, Gornsdorf, Großolbersdorf, Groß- rückerswalde, Grünhainichen, Heidersdorf, Jahnsdorf/Erzgeb., Johanngeor- genstadt, Jöhstadt, Königswalde, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Hausanschrift: Sächsisches Staatsministerium Lugau/Erzgeb., Marienberg, Mildenau, Niederwürschnitz, -

Sportverein Frauenverein
01/2015 www.sv-trebendorf.de Kontaktaufnahme: 035773 - 91 00 20 [email protected] Sportverein Frauenverein Feuerwehr Vereinsnachrichten Seniorenverein Haus der Vereine News Domowina aus Trebendorf Jugendclub Vereinsnachrichten Liebe Mitglieder, liebe Partner des Sports, sehr geehrte Damen und Herren, Unsere neuen Trainer Das neue Jahr hat längst begon- Jana Kollowa nen und so möchte ich gern diese Trainerin der Sektion: Gelegenheit nutzen, Euch allen ein Dance und Step-Kids erfolgreiches, glückliches und vor Trainingszeit Dance: allem gesundes neues Jahr 2015 zu Mi 17.00 – 19.30 Uhr wünschen. Trainingszeit Step-Kids: Fr 16.00 – 18.00 Uhr Ich möchte diese Neujahrsgrüße, Im Verein seit: 2014 gern mit viel Dank, für all die Un- Wohnort: Weißwasser terstützung und Zusammenarbeit verbinden. Danke für Euer Vertrauen Marco Ludwig und Eure Treue. Danke für die gemeinsam erreichten Trainer der Sektion: Ziele. Fußball-Nachwuchs G-Jugend Trainingszeit: Fr 15.30 – 16.30 Uhr René Kraink Im Verein seit: 2014 Vorstandsvorsitzender Wohnort: Weißwasser Dominik Schubert Trainer der Sektion: Fußball-Nachwuchs D-Jugend Trainingszeit: Die & Do 16.30 – 18.00 Uhr Im Verein seit: 2012 Wohnort: Trebendorf Carlos Guilundo & Steve Killian Trainer der Sektion: Fußball-Nachwuchs E-Jugend Trainingszeit: Die & Do 16.30 – 18.00 Uhr Im Verein seit: 2007 Wohnort: Weißwasser TRAININGSZEITEN Wie wäre es mit Bewegung gegen die Müdigkeit, Langeweile oder triste Bei Fragen informiert Sie das Abende!? Der Sportverein Trebendorf, bietet eine Vielzahl von Möglich- Team vom -

Von Zeit Zu Zeit Hdys a Hdys 26
VON ZEIT ZU ZEIT HDYS A HDYS 26. AUGUST 2020 NEUES AUS DER LANDKREISVERWALTUNG | NOWOSĆE Z WOKRJESNEHO ZARJADA WAS LANGE WÄHRT… Von Zeit zu Zeit – Freiwillige Feuerwehren werden modernisiert Hdys a hdys Für die Kameradinnen und Kamera- den der Freiwilligen Feuerwehren in Klix, Neukirch (b. Königsbrück) und Großdrebnitz hat das lange Warten auf eine finanzielle Unterstützung für ihre in die Jahre gekommenen Feuer- wehrgerätehäuser nun ein Ende. Bei- geordnete Birgit Weber überbrachte den drei Wehren im August die Be- scheide, über die durch den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Fördermittel. Damit können nun alle drei Feuerwehrgerätehauser auf den neuesten Stand gebracht werden. Sieben Jahre haben die Klixer Kameraden warten müssen. Dank der Fördermittel des …müssen wir uns immer wieder den Realitäten stellen. Der Sommer ist vor- Freistaates kann nun der Neubau starten. Freiwillige Feuerwehr Klix bei. Der Schulbetrieb wird aufgenom- Bürgermeister Lutz Mörbe freute sich sehr, men und die ABC-Schützen können nach so langer Zeit endlich loslegen zu das kommende Wochenende mit der können und versprach, die Einweihung Freiwillige Feuerwehr Großdrebnitz Schuleingangsfeier kaum erwarten. Die gemeinsam mit allen Beteiligten groß zu jungen Absolventen, welche zehn oder feiern. zwölf Jahre Schule hinter sich haben, stehen am Beginn zu Ausbildung oder Auch die Großdrebnitzer Kameraden Studium und damit ebenso vor einem nahmen den Fördermittelbescheid aus neuen Lebensabschnitt. Birgit Webers Händen dankend entgegen. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses So mancher der Oberschulabsolventen kann damit ebenfalls in die Tat umgesetzt wird sich an den eigenen Schuleingang werden. vor zehn Jahren erinnern, der buch- stäblich ins Wasser fiel. Im Einzugs- Einsatzbereit und voller Vorfreude war- bereich der Spree und deren Zuflüsse teten am 14. -

Anerkannte LEADER-Gebiete in Sachsen 2014-2020 Raschau-Markersbach
Dommitzsch Land Sachsen-Anhalt Trossin Beilrode Laußig Elsnig Republik Polen Bad Muskau Bad Düben Groß Düben Löbnitz Gablenz Schleife Landkreis Nordsachsen Dübener Heide Dreiheide Torgau Delitzsch Arzberg Trebendorf Zschepplin Elsterheide Weißwasser/O.L. Schönwölkau Mockrehna Doberschütz Spreetal Krauschwitz Delitzscher Land Weißkeißel Wiedemar Land Brandenburg Lauta Eilenburg Rackwitz Krostitz Belgern-Schildau Schkeuditz Hoyerswerda Lausitzer Seenland Sächsisches Zweistromland Rietschen Gröditz Thallwitz Ostelbien Boxberg/O.L. Jesewitz Schkeuditz Lohsa Lossatal Cavertitz Wittichenau Röderaue Hähnichen Taucha Bernsdorf Rothenburg/O.L. Dahlen Strehla Kreba-Neudorf Machern Zeithain Wülknitz Schwepnitz Oßling Leipzig Elbe-Röder-Dreieck Borsdorf Liebschützberg Niesky Bennewitz Wurzen Lampertswalde Königswartha Kreisfreie Stadt Leipzig Schönfeld Glaubitz Großenhain Mücka Ralbitz-Rosenthal Horka Thiendorf Brandis Königsbrück Schönteichen Quitzdorf am See Neukirch Wermsdorf Oschatz Riesa Radibor Großdubrau Kamenz Östliche Oberlausitz Neißeaue Markranstädt Trebsen/Mulde Neschwitz Mücka Naunhof Nünchritz Nebelschütz Leipziger Muldenland Dresdner Heidebogen Räckelwitz Hohendubrau Waldhufen Tauscha Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Kodersdorf Hirschstein Landkreis Bautzen Markkleeberg Puschwitz Malschwitz Haselbachtal Crostwitz Naundorf Ebersbach Großpösna Parthenstein Stauchitz Priestewitz Landkreis Görlitz Belgershain Laußnitz Panschwitz-Kuckau Mügeln, Stadt Grimma Landkreis Meißen Elstra Vierkirchen Schöpstal Großnaundorf Weißenberg Zwenkau -

Lehrpfade Im Landkreis Görlitz 27 Naturlehrpfade Des Landkreises Görlitz Vorgestellt
Gefördert durch: Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti Lehrpfade im Landkreis Görlitz 27 Naturlehrpfade des Landkreises Görlitz vorgestellt Herausgeber Landkreis Görlitz, 2011 LEHRPFADE IM LANDKREIS GÖRLITZ Diese Broschüre entstand im Rahmen des grenzübergreifenden deutsch-tschechischen Ziel3-Umweltbildungs- projektes »Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz in der Euroregion Neiße« . Bestandteile des Projektes sind u. a.: die Herausgabe von populärwissenschaftlichen Publikationen des Bezirkes Liberec in deutscher Sprache, die Herausgabe von zwei populärwissenschaftlichen Publikationen über den Landkreis Görlitz in deutscher und tschechischer Sprache, die Herausgabe von drei zweisprachigen Fotokalendern für die Jahre 2010, 2011/2012 und 2013 sowie Projekt begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Anliegen des Projektes ist es, Landschaften, Naturschönheiten und Schutzgüter des im Zuge der Gebiets- reform neu entstandenen Landkreises Görlitz und des angrenzenden Landschaftsschutzgebietes »Lužické hory« – »Lausitzer Gebirge« vorzustellen. Kontakt Naturschutzzentrum »Zittauer Gebirge« gemeinnützige GmbH Geschäftsführer: Herr Hans-Gert Herberg Projektpartner: Goethestraße 8 Landkreis Görlitz (Leadpartner) 02763 Zittau www.kreis-goerlitz.de Tel. 0049 3583 512512 [email protected] www.naturschutzzentrum-zittau.de Společnost pro Lužické hory Valdov 12 471 25 Jablonné v Podještědí Büro: Zdislavy z Lemberka 335 471 25 Jablonné -

16-17 Meldeliste
FV Oberlausitz Junioren Meldung Saison 2016/17 A-Junioren C-Junioren D-Junioren FC Oberlausitz Neugersdorf FC Oberlausitz Neugersdorf FC Oberlausitz Neugersdorf SpG Niesky/Görlitz SpG Görlitz/Niesky Holtendorfer SV SpG GFC Rauschwalde VfB Zittau NFV Gelb-Weiß Görlitz SpG EFV Bernstadt/Dittersbach SpG VfB Weißwasser 1909 VfB Zittau ??? dann KOL SpG Herrnhuter SV SpG ESV Lok Zittau FC Oberlausitz Neugersdorf 2. LSV Friedersdorf FC Stahl Rietschen-See FV Eintracht Niesky SpG LSV 1951 Spree SpG FSV Kemnitz SpG FSV 1990 Neus.-Spremberg SpG Schönbacher FV FSV Oppach NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. SpG FV Rot-Weiß 93 Olbersdorf Schönbacher FV B-Junioren Holtendorfer SV TSV Herwigsdorf 1891 FC Oberlausitz Neugersdorf SpG LSV 1951 Spree VfB Weißwasser 1909 SpG Niesky/Görlitz SpG Ostritzer BC SpG Bertsdorfer SV SpG VfB Weißwasser 1909 Post SV Görlitz Blau-W. Empor Deutsch Ossig SpG VfB/Lok Zittau ??? SpG SC Großschweidnitz-Löbau ESV Lok Zittau Bertsdorfer SV SpG SG Leutersdorf FC Silesia Görlitz SpG EFV Bernstadt/Dittersbach SpG SG Mücka FC Stahl Rietschen-See SpG FC Stahl Rietschen-See SpVgg. Ebersbach FSV Oderwitz 02 SpG FSV Oderwitz 02 SpG SV Aufbau Kodersdorf FV Eintracht Niesky 2. Holtendorfer SV Blau-W. Empor Deutsch Ossig GFC Rauschwalde LSV Friedersdorf SpG SV Grün-Weiß Gersdorf Herrnhuter SV SpG SG Bl.-W. Obercunnersdorf SV Lok Schleife Holtendorfer SV 2. SpG SG Leutersdorf SpG SV Neueibau ISG Hagenwerder SpG SG Rotat. Oberseifersdorf SpG SV Fortuna Trebendorf 1996 NFV Gelb-Weiß Görlitz 3. SSV Germania Görlitz TSV Herwigsdorf 1891 Ostritzer BC SpG Bl.-W. Empor Dtsch Ossig SC Großschweidnitz-Löbau SV Horken Kittlitz SpG SG Rotat.