Optimierung Des Winterdienstes Auf Hoch Belasteten Autobahnen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Oberer-Fils-Bote KW 45 ID 90513
Nummer 45 Freitag, 7. November 2014 Gemeinde Mühlhausen i.T. 29 Gemeinde Mühlhausen i.T. Jubilare Öffnungszeiten des Rathauses 12. November Karl Hanold, Wiesensteiger Straße 10 Montag - Freitag 07.30 Uhr - 12.00 Uhr 66 Jahre Montagnachmittag 14.00 Uhr - 18.00 Uhr Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Gesundheit und alles Gute! Zwei Anbieter mit ihren Verkaufsmobilen Glückwünsche auch an all diejenigen, die hier nicht genannt in Mühlhausen im Täle werden möchten. Amtliche Mitteilungen Sammel- und Abfuhrtermine 2014 Müllabfuhr: Eselhöfe und Mühlhausen i. T.: Regelmäßig kommen die mobilen Verkaufswagen der Freitag, 14. November 2014 Bäckerei Kirsamer aus Laichingen und der Landmetzge- Gelber Sack: Eselhöfe und Mühlhausen i. T.: rei Geiwiz aus Suppingen 2 x wöchentlich nach Mühl- Donnerstag, 20. November 2014 hausen im Täle und bieten ihre Waren zum Kauf an. Sie können somit dienstags und freitags zwischen ca. Altpapiersammlung: 9.40 Uhr – 11.30 Uhr an folgenden Haltestellen Backwa- Fetzer Papiertonne: Eselhöfe und Mühlhausen i. T. ren, Fleisch und Wurst kaufen: Freitag, 21. November 2014 - Warmenweg / Ecke Dürrenbergstraße Grünmassesammlung: - Gasthaus „Hirsch“ nächste Sammlung erst 2015 - Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Schönbachweg / Grünmüll: Grüngutplatz in Gosbach (Krähensteige) Gruibinger Straße (ehmaliger Gasthof „Albaufstieg“) - Kreuzäckerstraße, gegenüber Hausnummer 46 März - Oktober Mo. und Do. von 14 - 18 Uhr Ihre Gemeindeverwaltung Sa. von 13 - 18 Uhr November Mo. und Do. 14 - 17 Uhr Vollsperrung der Kohlhaustraße Sa. von 13 - 17 Uhr Dezember - Februar Aufgrund der Anlieferung ei- Sa. von 12 - 16 Uhr nes Fertighauses wird die Am Samstag, dem 27.12.2014 bleiben die Grüngutplätze Kohlhaustraße ab dem Be- geschlossen! reich der Hausnummer 28, Flst. -

Wirksamkeit Und Wirtschaftlichkeit Von Tau Mittelsprühanlagen
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Tau mittelsprühanlagen Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen Verkehrstechnik Heft V 139 Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Tau mittelsprühanlagen von Hermann Wirtz Karl Moritz Ulrike Thesenvitz Berichte der Bundesanst~lt für Straßenwesen [ Verkehrstechnik Heft V 1391 Die Bundesanstalt für Straßenwesen veröffentlicht ihre Arbeits- und Forschungs ergebnisse in der Schriftenreihe Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen. Die Reihe besteht aus folgenden Unterreihen: A -Allgemeines B - Brücken- und Ingenieurbau F - Fahrzeugtechnik M- Mensch und Sicherheit S - Straßenbau V - Verkehrstechnik Es wird darauf hingewiesen, dass die unter dem Namen der Verfasser veröffentlichten Berichte nicht in jedem Fall die Ansicht des Herausgebers wiedergeben. Nachdruck und photomechanische Wieder gabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmi gung der Bundesanstalt für Straßenwesen, Referat Öffentlichkeitsarbeit. Die Hefte der Schriftenreihe Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen können direkt beim Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Bgm.-Smidt-Str. 74-76, D-27568 Bremerhaven, Telefon (04 71) 9 45 44- 0, bezogen werden. Über die Forschungsergebnisse und ihre Veröffentlichungen wird in Kurzform im Informationsdienst BASt-Info berichtet. Dieser Dienst wird kostenlos abgegeben; Interessenten wenden sich bitte an die Bundesanstalt für Straßenwesen, Referat Öffentlichkeitsarbeit. Impressum Bericht zum Projekt 03 654 des Arbeitsprogrammes der Bundesanstalt für Straßenwesen: "Wirksamkeit und -

Oberer-Fils-Bote KW 06 ID 127701
Nummer 6 26 Gemeinde Mühlhausen i.T. Freitag, 10. Februar 2017 Gemeinde Mühlhausen i.T. Jubilare Öffnungszeiten des Rathauses 12. Februar Christa Neudel, Parkstraße 5, 70 Jahre Montag - Freitag 07.30 Uhr - 12.00 Uhr Montagnachmittag 14.00 Uhr - 18.00 Uhr Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen alles Gute! Neues am Infostand des Rathauses Amtliche Mitteilungen Folgende Broschüren liegen auf dem Rathaus am Info- stand zur kostenlosen Abholung bereit: Sammel- und Abfuhrtermine 2017 - Region Stuttgart - E-Bike 2017 - Rad Wandern Bus Reußenstein 2017 Müllabfuhr: Eselhöfe und Mühlhausen i.T. - Volksbildungswerk Westerheim - Programm 02 - 09/2017 Freitag, 17. Februar 2017 Gelber Sack - Mühlhausen i.T. Gegen Bezahlung kann Folgendes im Rathaus erworben Montag, 20. Februar 2017 werden: Gelber Sack - Eselhöfe Mittwoch, 22. Februar 2017 - Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf Altpapiersammlung 1. Filsland-Kreisfahrplan 2016/17 gültig seit 11.12.2016 für Samstag, 25. März 2017 durch den TSV 2,00 € Fetzer-Papiertonne Eselhöfe und Mühlhausen i.T. 2. Albtrauf-Mitbring-Säckle, EVP: 7,00 € Freitag, 10. Februar 2017 Biomülltüte B E K A N N T M A C H U N G Mittwoch, 15. Februar 2017 des Beschlusses über die Aufstellung des Umlegungsplans (Bereitstellung bitte ab 6.00 Uhr und gerne auch in einem nach § 69 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) Eimer mit Deckel wegen Tieren) Amtliches Bodenordnungsverfahren „Sänder“ der Gemeinde Grünmassesammlung Mühlhausen im Täle, Gemarkung Mühlhausen Dienstag, 25. April 2017 Grünmüll 1. Beschluss über die Aufstellung des Umlegungsplans Grüngutplatz in Gosbach (Krähensteige) März - Oktober Der Umlegungsausschuss der Gemeinde Mühlhausen im Mo. und Do. von 14 bis 18 Uhr Täle hat in seiner Sitzung am 01.02.2017 die Aufstellung des Sa. -
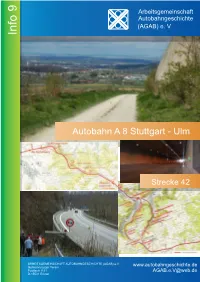
A 8 Stuttgart - Ulm
Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte (AGAB) e. V Info 9 Autobahn A 8 Stuttgart - Ulm Strecke 42 ARBEITSGEMEINSCHAFT AUTOBAHNGESCHICHTE (AGAB) e.V. Gemeinnütziger Verein www.autobahngeschichte.de Postfach 1151 [email protected] D-15531 Erkner 26. Treffen der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte e.V. Die 26. Mitgliederversammlung des Vereins Das Regierungspräsidium Stuttgart als eines fand am 21.April 2012 in Mühlhausen im Täle der vier Regierungspräsidien des Landes (Baden-Württemberg) statt. Baden-Württemberg steuert und koordiniert Tagungslokal war das Hotel “Höhenblick” sowohl die Finanzplanung als auch die Obere Sommerbergstraße 10 in 73347 technische Planung im Straßen- und Mühlhausen. Brückenbau für die Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen einschließlich des dazu- gehörenden Radwegenetzes. Zu den operativen Tätigkeiten gehören Bau und Ausbau von Bundesautobahnen und Bundes- straßen in Auftragsverwaltung für den Bund und die Bauherrenaufgaben beim Bau und Ausbau der Landesstraßen. Weiterhin gehören die Unterhaltung und ein sicherer Betrieb der Bundesautobahnen, A 6, A 7, A 8, A 81, A 831 zu den Aufgaben. Insgesamt sind fast 600 Mitarbeiterinnen und Das Tagungslokal Hotel Höhenblick Mitarbeiter in Stuttgart, bei den Dienststellen Heilbronn, Ellwangen und Göppingen, den Am Vorabend unserer Versammlung stellte Bauleitungen Bad Mergentheim, Schwäbisch zunächst der Abteilungleiter des Regierungs- Hall und Besigheim sowie bei den Autobahn- präsidiums Stuttgart, Herr Konradin Heyd, meistereien Tauberbischofsheim, Neuen- seinen Verantwortungsbereich vor: die stadt, Kirchberg, Ludwigsburg, Heidenheim Abteilung 4 „Straßenwesen und Verkehr“. und Herrenberg mit Kirchheim u.T. Mit diesen Aufgaben beschäftigt. Außerdem übt das Regierungspräsidium Stuttgart die Fachaufsicht über die 11 Landkreise sowie die Städte Stuttgart und Heilbronn aus, denen der Betrieb und die Unterhaltung von Bundes- und Landes- straßen obliegen. -

Kra GP Findbuch
INVENTARE DES KREISARCHIVS GÖPPINGEN Bestand Oberamt/Landkreis Göppingen I Kreisarchiv Göppingen Bestand Landratsamt Hauptregistratur C 6 Bauen und Wohnungswesen (1863-1980) II Inhaltsverzeichnis I Allgemeine Bauangelegenheiten, Bauverwaltung I 1Bauwirtschaft 1 I 2 Kreisbauamt 2 I 3 Hochbauamt 3 II Raumordnung, Landesplanung, Städtebau II 1 Raumordnung 4 II 2 Städtebau 23 II 3 Sicherung der Bauleitplanung, Enteignung 26 II 4 Umlegung, Grenzregelung 32 II 5 Grundstückswertermittlung 35 III Bauordnungsrecht, Baugenehmigung III 1 Bauordnungsrecht 36 III 2 Baugenehmigung 45 IV Vermessungswesen IV 1 Vermessungsangelegenheiten 56 V Wohnungs- und Siedlungswesen V 1 Allgemeines über den Wohnungsbau 64 V 2 Wohnungsbauförderung durch Bund, Land und Kreis 67 V 3 Wohnungsbauförderung durch die Gemeinde 68 V 4 Gemeinnützige Bauträger und andere Wohnungsbauunternehmen 73 V 5 Siedlungs- und Kleingartenrecht 73 V 6 Wohnraumbewirtschaftung, Wohnungsaufsicht 73 III V 7 Mietrecht, Mieterschutz 73 VI Straßen, Wege, Brücken VI 1 Bauhof, Fuhrpark 73 VI 2 Allgemeine und gemeinsame Strassenangelegenheiten 73 VI 3 Bundesfernstraßen 73 VI 4 Landes- und Kreisstrassen 73 VI 5 Gemeindestrassen 73 VI 6 Brücken, Stege, Über- und Unterführungen 73 VI 7 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 73 VII Wasserbau, Gewässerschutz VII 1 Wasserrecht 73 VII 2 Bau und Unterhalt öffentlicher Gewässer 73 VII3 Benutzung öffentlicher Gewässer, Gewässerschutz 73 Ortsindex 73 Personenindex 73 Zeitungsindex 73 IV I 1 Bauwirtschaft I 1 Bauwirtschaft C 6 - 1 1945 Wiedergründung des Lehrstuhls für Städtebau und Siedlungswesen an der Technischen Hochschule Stuttgart, 1 Fasz. 600.1 (3001/6) C 6 - 2 1948 - 1967 Architekten, Allgemeines, 1 Büschel 600.3 (3001/5) C 6 - 3 1942, 1943 Nachwuchsmangel an technischen Dienstkräften im gemeindlichen Dienst, 1 Fasz. -

Die Reichsautobahn
Michael Kriest Die Reichsautobahn Konzeption, räumliche Struktur und Denkmaleigenschaft eines historischen Verkehrsnetzes Umschlag-Vorderseite: Autobahn Berlin-München Fahrtrichtung Berlin am Sophienberg vor der Anschlussstelle Bayreuth-Süd oben: Reichsautobahn, Ende 1930er Jahre ( AUTOBAHNBAUAMT NÜRNBERG (Hrsg.) 1959) unten: Bundesautobahn A 9, 2007 (Aufnahme: Verfasser) Umschlag-Rückseite : Reichsautobahnnetz Stand Mai 1938 ( DIE STRASSE 1938, 9 ) Michael iMhof Verlag INHALTSVERZEICHNIS 1.4 Beginn von Netzplanung und Bau 66 2 Verkehrspolitische Motive für das Reichsautobahnnetz 70 2.1 Die Verkehrsverbesserung durch die Reichsautobahn 70 Vorwort 11 2.2 Transport- und verkehrswirtschaftliche Funktion der Reichsautobahn 72 2.2.1 Güterverkehr 72 EINFÜHRUNG 12 Die Bedeutung der Reichsautobahn für den Güterverkehr – Reichsauto bahn 72 und Güterverkehrspolitik – Die weitere Entwicklung im Güterverkehr 2.2.2 Militärische Motive 76 TEIL 1: KONZEPTION UND RÄUMLICHE STRUKTUR DES REICHSAUTOBAHNNETZES 14 Militär und Motorisierung – Militärische Bedeutung der Reichsautobahn 76 2.2.3 Personenverkehr 78 I Quellen und Forschungsstand 15 Die Bedeutung der privaten Motorisierung im „Dritten Reich“ – Der Volkswagen – 78 1 Quellen Reichsautobahn und Tourismus – Omnibusverkehr Ungedruckte Quellen – Gedruckte Quellen 16 2.2.4 Reichsautobahn und Verkehrsentwicklung 82 2 Forschung 16 Die Motorisierung im „Dritten Reich“ – Verkehrsentwicklung auf der Reichsautobahn 82 Motorisierung als zeitgeschichtliches Umfeld – Forschungen zum Autostraßenbau 16 2.2.5 Fazit -

Entwicklung Eines Konzepts Zur Deckung Des Streckenbezogenen LKW-Parkbedarfs in Süddeutschland Mittels GAMS
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Loske, Dominic Research Report Entwicklung eines Konzepts zur Deckung des streckenbezogenen LKW-Parkbedarfs in Süddeutschland mittels GAMS ild Schriftenreihe der FOM, No. 60 Provided in Cooperation with: ild Institut für Logistik- & Dienstleistungsmanagement, FOM Hochschule für Oekonomie & Management Suggested Citation: Loske, Dominic (2018) : Entwicklung eines Konzepts zur Deckung des streckenbezogenen LKW-Parkbedarfs in Süddeutschland mittels GAMS, ild Schriftenreihe der FOM, No. 60, FOM Hochschule für Oekonomie & Management, ild Institut für Logistik- & Dienstleistungsmanagement, Essen This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/234145 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben -

Kra GP Findbuch
INVENTARE DES KREISARCHIVS GÖPPINGEN Bestand Oberamt/Landkreis Göppingen I Kreisarchiv Göppingen Bestand Landratsamt Hauptregistratur C 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (ca. 1825-1984) II Inhaltsverzeichnis I 1 Recht und Organisation der Polizei 1 II 1 Waffen, Sprengstoffe, Gifte 40 II 2 Feuerpolizei 47 II 3 Meldewesen, Ausweise, Führungszeugnisse 145 II 4 Staatsangehörigkeit, Auswanderung 175 II 5 Ausländer und Staatenlose 183 II 6 Vereine und Versammlungen 189 II 7 Presse, Schrifttum, sonstige Veröffentlichungen 190 II 8 Sammlungen, Lotterien, Glücksspiele 191 II 9 Sonn- und Feiertage 197 II10 Polizeistunde, Tanzunterhaltungen, sonstige Lustbarkeiten 199 II11 Wahrung der Sitten 200 II12 Sonstige Ordnungsaufgaben 202 III 1 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 204 III 2 Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 208 III 3 Kraftfahrzeugzulassung 222 III 4 Gewerblicher Kraftverkehr 223 IV 1 Gewerberecht und allgemeine Gewerbeangelegenheiten 225 IV 2 Gewerbebetriebe 229 IV 3 Reisegewerbe 261 IV 4 Einzelhandel, Ladenschluß 271 IV 5 Gaststättenrecht 294 IV 6 Maße und Gewichte 340 V 1 Vorsorge und Einsatz bei Katastrophen 341 VI 1 Allgemeine Angelegenheiten des Zivilschutzes 346 VI 2 Selbstschutz 347 VI 3 Warn- und Alarmdienst 355 VI 4 Schutzbau 357 VII 1 Sicherstellung der Versorgung im Verteidigungsfall 358 VIII 1 Wehrangelegenheiten, Allgemeines 360 VIII 2 Bundeswehr, Wehrmacht 361 VIII 3 Stationierungsstreitkräfte 372 VIII 4 Wehrpflicht 386 Firmenindex 390 Ortsindex 392 Personenindex 418 Zeitungsindex 421 III I 1 Recht und Organisation der -

Herpetologische Erhebungen Im Gosbachtal Fachgutachten Zur
Herpetologische Erhebungen im Gosbachtal Fachgutachten zur Herpetofauna zwischen Gosbach und Unterdrackenstein Auftraggeber: Bürgerinitiative A8 Drackensteiner Hang e.V. Gartenstraße 11 73345 Drackenstein Auftragnehmer: Fachbüro für ökologische Planungen Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Lissak Schubartstraße 12 73092 Heiningen November 2015 Herpetologisches Fachgutachten Gosbachtal Inhalt 1 Anlas und Aufgabenstellung …..……………………………….………………………….. 2 2 Untersuchungsrahmen ……….…………………..……………………………………...... 2 2.1 Lage des Untersuchungsgebietes ….………..………………………………….…... 2 2.2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes ……………………………….………... 3 2.3 Methode ……….………………………..….…………………………………….......… 6 2.4 Witterung im Untersuchungsjahr …………..……………………………….….......… 7 3 Ergebnisse …………………………………………………………………….……………. 8 3.1 Amphibien ……………...………………………..…………………………………....… 8 3.2 Reptilien ……..……………………………………...............................…………….. 9 4 Überschlägige Wirkungsprognose und Bewertung des Bauvorhabens auf die 19 Herpetofauna …………….……………………………………………………..…………... 4.1 Baubedingte Wirkungen ……………...………………………..………………….…... 19 4.2 Anlagebedingte Wirkungen ………………………...............................……………. 19 4.3 Betriebsbedingte Wirkungen ………………………...............................…………... 20 4.4 Bewertung ………………………..................................……………………………... 20 5 Fazit und Zusammenfassung ………………………………………………………….….. 21 6 Artenschutzfachliche Empfehlungen ……………………...............................………… 22 7 Literatur und Quellen ………………………..………………………………..……………. 24 7.1 Literatur……………………………………..………………………..………...…….…. -

Oberer-Fils-Bote KW 47 ID 90515
Nummer 47 Freitag, 21. November 2014 Gemeinde Hohenstadt 23 Gemeinde Mühlhausen i.T. Jubilare 21. November Rein Saare, Kohlhaustraße 34, 65 Jahre 22. November Josef Blum, Untere Sommerbergstraße 22, 68 Jahre Öffnungszeiten des Rathauses 25. November Hilde Öun, Kohlhaustraße 34, 87 Jahre Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Gesundheit Montag - Freitag 07.30 Uhr - 12.00 Uhr und alles Gute! Montagnachmittag 14.00 Uhr - 18.00 Uhr Glückwünsche auch an all diejenigen, die hier nicht genannt werden möchten. Nummer 47 24 Gemeinde Mühlhausen i.T. Freitag, 21. November 2014 Amtliche Mitteilungen Vollsperrung der Kohlhaustraße Aufgrund der Anlieferung eines Fer- tighauses wird die Kohlhaustraße ab dem Bereich der Hausnummer Sammel- und Abfuhrtermine 2014 28, Flst. 314/2, Kreuzung zur Blu- Müllabfuhr: Eselhöfe und Mühlhausen i. T.: menstraße, am Freitag, den 21. No- Freitag, 28. November 2014 vember 2014, von 6.00 Uhr – 20.00 Gelber Sack: Eselhöfe und Mühlhausen i. T.: Uhr voll gesperrt sein. Wir bitten Donnerstag, 04. Dezember 2014 die Anlieger der Rosenstraße und der Kohlhaustraße 32 und 34, sich auf diesen Umstand Altpapiersammlung: einzustellen und ggf. ihre Fahrzeuge für den Zeitraum der Fetzer Papiertonne: Eselhöfe und Mühlhausen i. T. Sperrung innerorts (z. B. am Bürgersaal trotz Zeitbeschrän- Freitag, 21. November 2014 kung) an anderer Stelle zu parken (umparken am Donners- Grünmassesammlung: tagabend, 20.11.2014). nächste Sammlung erst 2015 Wir bitten um Ihr Verständnis! Ihr Bürgermeisteramt Grünmüll: Grüngutplatz in Gosbach (Krähensteige) März - Oktober Nachlese zum Volkstrauertag Mo. und Do. von 14 - 18 Uhr am 16. November 2014 Sa. von 13 - 18 Uhr Auch in diesem Jahr haben wir am Volkstrauertag an die Gefal- November lenen der beiden Weltkriege und Mo. -

Treaty Series Recueil Des Traits
Treaty Series Treaties and internationalagreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 490 Recueil des Traits Traites et accords internationaux .enregistris oa classes et inscrits au repertoire au Secrtariat de l'Organisation des Nations Unies United Nations * Nations Unies New York, 1965 Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 490 1964 I. Nos. 7150-7169 TABLE OF CONTENTS I Treaties and internationalagreements registered Irom 1 March 1964 to 16 March 1964 Page No. 7150. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Nether- lands : Exchange of notes (with annex) constituting an agreement concerning the graves of Netherlands servicemen who died in the United Kingdom during the Second World War. London, 27 August 1963 .. .............. 3 No. 7151. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Nether- lands : Exchange of notes constituting an agreement concerning the safeguarding of secrecy of inventions relating to defence and for which applications for patents have been made. London, 30 October 1963 .... ......... 11 No. 7152. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ecuador : Exchange of notes constituting an agreement regarding the abolition of visas. Quito, 13 September 1963 ....... ..................... ... 19 No. 7153. United States of America and Federal Republic of Germany: Agreements relating to the status of United States Forces in the Federal Repub- lic of Germany: A. Agreement on the settlement of disputes arising out of direct procurement (with exchange of notes). Signed at Bonn, on 3 August 1959 B. Agreement on the status of persons on leave. -

The Atlas of Lane Changes: Investigating Location-Dependent Lane Change Behaviors Using Measurement Data from a Customer Fleet
The Atlas of Lane Changes: Investigating Location-dependent Lane Change Behaviors Using Measurement Data from a Customer Fleet Florian Wirthmuller¨ , Jochen Hipp , Christian Reichenbacher¨ and Manfred Reichert Abstract— The prediction of surrounding traffic participants behavior is a crucial and challenging task for driver assistance and autonomous driving systems. Today’s approaches mainly focus on modeling dynamic aspects of the traffic situation and try to predict traffic participants behavior based on this. In this article we take a first step towards extending this common practice by calculating location-specific a-priori lane change probabilities. The idea behind this is straight forward: The driving behavior of humans may vary in exactly the same traffic situation depending on the respective location. E. g. drivers may ask themselves: Should I pass the truck in front of me immediately or should I wait until reaching the less curvy part of my route lying only a few kilometers ahead? Although, such information is far away from allowing behavior prediction on its own, it is obvious that today’s approaches will greatly benefit when incorporating such location-specific a-priori probabilities into their predictions. For example, our investigations show that highway interchanges tend to enhance driver’s motivation to perform lane changes, whereas curves seem to have lane change-dampening effects. Nevertheless, the investigation of all considered local conditions shows that superposition of various effects can lead to unexpected probabilities at some locations. We thus suggest dynamically constructing and maintaining a lane change probability map based on customer fleet data in order to support onboard prediction systems with additional information.