Marie-Emmanuelle Reytier Helene Weber Als Europäerin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

University Microfilms
INFORMATION TO USERS This dissertation was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating' adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again — beginning below the first row and continuing on until complete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, however, a somewhat higher quality reproduction could be made from "photographs" if essential to the understanding o f the dissertation. -
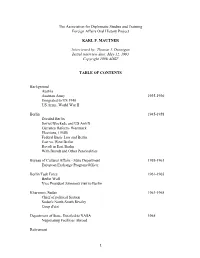
Mautner, Karl.Toc.Pdf
The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project KARL F. MAUTNER Interviewed by: Thomas J. Dunnigan Initial interview date: May 12, 1993 opyright 1998 ADST TABLE OF CONTENTS Background Austria Austrian Army 1 35-1 36 Emigrated to US 1 40 US Army, World War II Berlin 1 45-1 5, Divided Berlin Soviet Blockade and US Airlift .urrency Reform- Westmark Elections, 01 4,1 Federal Basic 2a3 and Berlin East vs. West Berlin Revolt in East Berlin With Brandt and Other Personalities Bureau of .ultural Affairs - State Department 1 5,-1 61 European E5change Program Officer Berlin Task Force 1 61-1 65 Berlin Wall 6ice President 7ohnson8s visit to Berlin 9hartoum, Sudan 1 63-1 65 .hief of political Section Sudan8s North-South Rivalry .oup d8etat Department of State, Detailed to NASA 1 65 Negotiating Facilities Abroad Retirement 1 General .omments of .areer INTERVIEW %: Karl, my first (uestion to you is, give me your background. I understand that you were born in Austria and that you were engaged in what I would call political work from your early days and that you were active in opposition to the Na,is. ould you tell us something about that- MAUTNER: Well, that is an oversimplification. I 3as born on the 1st of February 1 15 in 6ienna and 3orked there, 3ent to school there, 3as a very poor student, and joined the Austrian army in 1 35 for a year. In 1 36 I got a job as accountant in a printing firm. I certainly couldn8t call myself an active opposition participant after the Anschluss. -

April 2007 � Liebe Leserinnen Und Leser, Neu Auf Der Potsdamer
Die Stadtteilzeitung Ihre Zeitung für Schöneberg - Friedenau - Steglitz Zeitung für bürgerschaftliches Engagement und Stadtteilkultur Ausgabe Nr. 40 - April 2007 www.stadtteilzeitung-schoeneberg.de L Liebe Leserinnen und Leser, Neu auf der Potsdamer Ick sitze inner Küche... Immerhin haben sich doch einige Ring frei für die von Ihnen an den alten Spruch von den Klopsen noch erinnert - Schöneberger! darunter sogar eine Neuberliner (Friedenauer) deutsch-französi- Jetzt geht's Berg auf für Kin- sche Familie! Versprochen ist der, Jugendliche, Erwachsene versprochen, hier ist er: und Senioren aus Schöne- Ick sitze da und esse Klops berg! Schnell Umziehen, Auf- Mit eenmal kloppt's wärmen und dann ab in den Ick kieke, staune, wund're mir Ring 'ne Runde Boxen… Uff eenmal isse uff, die Tür! Nanu, denk ick, ick denk nanu Vor kurzem, am 22. Februar, Jetzt isse uff, erst war se zu? eröffnete in der Potsdamer Ick jehe raus und kieke Straße 152 der Boxclub "Wir und wer steht draußen: icke! aktiv. Boxsport & mehr.". Es ist ein soziales Kiezprojekt und Wen wundert's, dass es diverse gleichzeitig ein neuer Treffpunkt Versionen davon gibt? Wir ha- für sportliche Schöneberger. Auf ben sozusagen eine mittlere ge- ca. 500 Quadratmetern werden wählt, und Elfriede Knöttke unterschiedliche Kurse für Jung freut sich über die Grüße und ist und Alt angeboten. Ehrenamt- ganz glücklich, denn jetzt hat sie Die General-Pape-Straße beginnt (oder endet) am neuen Bahnhof Südkreuz Foto: Thomas Protz lich organisiert und für die ihre Wette gewonnen und ihr Nutzer kostenlos. Es wird sicher Günter muß eine Woche lang L jeder was für seinen "Sportge- abwaschen! Ein Areal mit Überraschungen: v. -

Im Geiste Der Beiden Testamente Aus De
RUNDBRIEF zur Förderung der Freundschaft zwischen dem Alten und dem Neuen Gottesvolk — im Geiste der beiden Testamente 11111V. Folge 1951/1952 Freiburg, Dezember 1951 Nummer 12/15 4 SONDER-AUSGABE: FRIEDE MIT ISRAEL Aus dem Inhalt: 1. Erste Schritte auf dem Wege zum Frieden mit Israel von Karlheinz Schmidthüs Seite 3 a) ,Wo ift dein Bruder Abel?' Ansprache zur Einweihung des Gedächtnismales auf dem alten Judenfriedhof in Schlüchtern von Wilhelm Praesent am 7. August 1949 Seite 4 b) „Gib, o Gott, daß in keines Menschen Herz Haß aufsteige !" Rede von Landesrabbiner Dr. Robert R.Geis auf dem Jüdischen Friedhof anläßlidi der Einweihung des Gedenksteins für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Kassel, Sonntag, den 25. Juni 1950. Seite 5 c) „Wir bitten Israel um Frieden" von Eridt Lüth Seite 7 d) Nahum Goldmann an Erich Lüth Seite 8 e) Die Erklärungen Bundeskanzler Dr. Adenauers und der Parteien zur Wieder- gutmachung . Seite 9 n Rabbiner Dr. Leo Bai& zur Regierungs- und Parteienerklärung .. Seite 11 g) Resolution des Zentralrats der Juden in Deutschland über die deutsche Regierungs- erklärung . . Seite 11 h) Jüdischer Weltkongreß zur deutschen Regierungserklärung Seite 12 1) Israel antwortet auf die Erklärung der Bundesregierung zum jüdisch-deutschen Verhältnis , Seite 12 k) „Ich schenke Deutschland den Frieden !" Aus einem offenen Brief an Erich Lüth und Rudolf Küstermeier von ihrem 1(2-Leidensgefährten Israel Gelber aus Jerusalem Seite 13 2. Deutschland und Israel von E. L. Ehrlich Seite 14 3. Der neue Staat Israel und die Christenheit. Bericht von der Düsseldorfer Tagung des Deutschen evangelischen Ausschusses für Dienst an Israel, 26. Februar bis 2. -

Dr. H.C. Helene Weber (1881–1962): „Der Reine Männerstaat Ist Das Verderben Der Völker.“ 1 – Eine Biographische Skizze Von Regina Illemann
Regina Illemann Dr. h.c. Helene Weber (1881–1962) Dr. h.c. Helene Weber (1881–1962): „Der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker.“ 1 – Eine biographische Skizze von Regina Illemann Am 17. März 1881 wurde Helene Weber 2 in Elberfeld geboren. Ihr Vater war Volksschullehrer, Ortsvorsitzender in der Zentrumspartei und nach dem frühen Tod seiner Frau allein für die sechs Kinder verantwortlich. Mit der Ausbildung zur Volksschullehrerin am Lehrerinnenseminar 1897–1900 in Aachen erwarb Weber den damals für Frauen höchstmöglichen Bildungsabschluss. 1905–1909 nahm sie ein Hochschulstudium auf, um an Höheren Schulen unterrichten zu dürfen. Als Studienrätin hatte sie Kontakt zum katholischen „Volksverein“ und engagierte sich im „Frauenstimmrechts-Verband für Westdeutschland“. 1916 gründete sie gemeinsam mit der Hedwig Dransfeld, der Präsidentin des „Katholischen Deutschen Frauenbundes“ (KDFB) in Köln eine Soziale Frauenschule als katholische Ausbildungsstätte für Fürsorgerinnen, die sie bis 1919 leitete 3. Zugleich mit der Schule gründete Weber auch den „Verein katholischer Sozialbeamtinnen“ 4. Wann und wie genau Weber in Kontakt zur katholischen Frauenbewegung gekommen war, ist nicht belegt. Sie war ihr im Weiteren Heimat und Basis, Berufung und Lebensaufgabe. Ihre umfangreiche par- teipolitische Tätigkeit stand letztlich im Dienst der Interessen der Kirche und der Bestrebungen und Ziele der katholischen Frauenbewegung. Ab 1918 arbeitete Weber im Zentralvorstand des KDFB mit. 1919 zog sie für das Zentrum in die verfassunggebende Nationalversammlung -

Österreichisches Anwaltsblatt 07-08 2019 430 Inhalt 07-08 2019
07–08 2019 AnwaltsÖSTERREICHISCHES 429–524 blatt 438 PORTRAIT DES MONATS Elisabeth Selbert – Die Sternstunde ihres Lebens 439 ABHANDLUNGEN Rückgang der Zivilverfahren – eine Suche nach den Ursachen Prozessebbe: Wo liegen die Gründe? Evaluierung des Rückgangs der Anfallszahlen bei Gericht Entwicklungstendenzen der Anwaltschaft in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Leistbarer Zugang zum Recht Highlights aus dem Wartungerlass der Gebührenrichtlinien 2019 486 IM GESPRÄCH Prof. Dr. Armin Höland – Weniger Streit in Europa www.rechtsanwaelte.at Österreichische Post AG · MZ 02Z032542 M · Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Wollzeile 1–3, 1010 Wien · ISSN 1605-2544 2019ANWALTSTAG Salzburg | 26. – 27. September © Simply Foto © Bryan Reinhart© Simply Foto EINLADUNG zum Anwaltstag 2019 vom 26. bis 27. September 2019 in Salzburg Alle Informationen und das Anmeldeformular fi nden Sie unter www.anwaltstag.at Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an [email protected] 429 Editorial Nach der Wahl ist vor der Wahl ie EU-Wahl ist geschlagen. Das bedeutet neue Mehr- der EU gehen wird. D heitsfindung auf europäischer Ebene. Die Zusammen- Bleibt es bei der Ten- setzung der neuen Kommission für die Funktionsperiode denz der Verfolgung bis 2024 ist politisch zu verhandeln. Die post-Juncker Kom- von Rechtsstaatlich- mission soll nach Presse-Meldungen noch „selbstbewusster keitsdefiziten, und und mächtiger“ werden. In Österreich steht nach turbulen- wenn ja, in welcher ten innenpolitischen Zeiten eine Neuorientierung bevor. Form? Wie wird die Andere Mitgliedstaaten -

The German Center Party and the League of Nations: International Relations in a Moral Dimension
InSight: RIVIER ACADEMIC JOURNAL, VOLUME 4, NUMBER 2, FALL 2008 THE GERMAN CENTER PARTY AND THE LEAGUE OF NATIONS: INTERNATIONAL RELATIONS IN A MORAL DIMENSION Martin Menke, Ph.D.* Associate Professor, Department of History, Law, and Political Science, Rivier College During the past two decades, scholarly interest in German political Catholicism, specifically in the history of the German Center Party has revived.1 As a spate of recent publication such as Stathis Kalyvas’s The Rise of Christian Democracy in Europe and the collection of essays, Political Catholicism in Europe, 1918-1965, 2 show, this renewed interest in German political Catholicism is part of a larger trend. All of these works, however, show how much work remains to be done in this field. While most research on German political Catholicism has focused on the period before 1918, the German Center Party’s history during the Weimar period remains incompletely explored. One of the least understood areas of Center Party history is its influence on the Weimar government’s foreign policy. After all, the Center led nine of the republic’s twenty cabinets. Karsten Ruppert, for example, relies almost exclusively on Peter Krüger’s Die Außenpolitik der Republik von Weimar,3 which emphasizes the role of Foreign Minister Gustav Stresemann almost to the exclusion of all other domestic decision-makers. Weimar’s foreign policy largely consisted of a series of responses to crises caused by political and economic demands made by the victors of the First World War. These responses in turn were determined by the imperatives of German domestic politics. -

Gruppenbild Mit Dame(N). Fotografische Darstellungen Der Politikerin Helene Weber in Deutschen Printmedien 1919–1933 Und 1949–1962
Katrin Schubert Gruppenbild mit Dame(n) Gruppenbild mit Dame(n). Fotografische Darstellungen der Politikerin Helene Weber in deutschen Printmedien 1919–1933 und 1949–1962 von Katrin Schubert www.helene-weber.de Muschiol / Welskop-Deffaa, Helene Weber 178 Katrin Schubert Gruppenbild mit Dame(n) I. Fragestellung, Quellenlage und Methode................................................................... 180 II. Ergebnis der Analyse für den Erhebungszeitraum 1919–1933 ................................ 184 II.1. Helene Weber und andere Politikerinnen in den Illustrierten Zeitschriften..................................................................................................... 184 II.2. Beispielanalyse: Illustrirte Zeitung Leipzig ................................................. 186 II.3. Die Bilder 1919–1933 in der Einzelanalyse ................................................. 189 III. Ergebnis der Analyse für den Erhebungszeitraum 1949–1962 ............................... 193 III.1. Quellen ........................................................................................................ 194 III.2. Ergebnisse Archiv des Bundespresseamts .................................................. 194 III.3. Ergebnisse Der Spiegel ............................................................................... 196 III.4. Ergebnisse des Vergleichs der Bildfunde Helene Weber – Elisabeth Schwarzhaupt - Annemarie Renger im Nachrichtenmagazin Der Spiegel 1949–1962 ...................................................................................................... -

36. 22. 1. 1962: Fraktionsvorstandssitzung 36A.1
CDU/CSU – 04. WP Fraktionsvorstandssitzung: 22. 01. 1962 36. 22. 1. 1962: Fraktionsvorstandssitzung ACDP, VIII-001-1503/4. Zeit: 16.00 Uhr–19.30 Uhr. Anwesend: Dr. von Brentano, Arndgen, Dr. Dollinger, Schmücker, Struve, Dr. Heck, Wacher; Dr. Barzel, Bauer, Bauknecht, Brand, Burgemei- ster, Etzel, Hoogen, Dr. Kopf, Majonica, Niederalt, Dr. Pferdmenges, Dr. Pflaumbaum, Frau Dr. Rehling, Dr. Schmidt, Schütz, Dr. Vogel, Dr. Weber (Koblenz); Regierung: ohne Vertreter; Gäste: Dr. Gerstenmaier, Dr. Jaeger, Dr. Kraske, Frau Dr. Weber. 1 36 a. 1. Tagesordnung des Plenums dieser Woche a) Regierungserklärung EWG (ohne Aussprache)2, b) Große Anfrage3 und Antrag der Fraktion betr. Radioaktivität4, c) SPD-Antrag betr. Mindesturlaub.5 2. Tagesordnung des Plenums nächster Woche Aussprache EWG.6 3. Kooptationsvorschläge für den Vorstand siehe Anlagen.7 1 Maschinenschriftliche Anmerkungen zur Tagesordnung mit drei Anlagen; alle diese Dokumente tragen den Vermerk »Bonn, den 22. 1. 1962«. 2 Regierungserklärung zur gemeinsamen Agrarpolitik in der EWG vom 24. 1. 1962. 3 Große SPD-Anfrage betr. Schutz der Gesundheit gegen radioaktive Strahlung (Drs. IV/26 vom 21. 11. 1961). 4 CDU/CSU-FDP-Antrag betr. Radioaktivität der Luft und des Regens (Drs. IV/15 vom 14. 11. 1961). 5 SPD-Gesetzentwurf über Mindesturlaub für Arbeitnehmer – Bundesurlaubsgesetz – (Drs. IV/142 vom 23. 1. 1962). 6 Regierungserklärung zur gemeinsamen Agrarpolitik in der EWG vom 24. 1. 1962. 7 Anlage 1: Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Fraktionsvorsitzender: Heinrich von Brentano Stellvertretende -

Diss Gradschool Submission
OUTPOST OF FREEDOM: A GERMAN-AMERICAN NETWORK’S CAMPAIGN TO BRING COLD WAR DEMOCRACY TO WEST BERLIN, 1933-72 Scott H. Krause A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2015 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher R. Browning Klaus W. Larres Susan Dabney Pennybacker Donald M. Reid Benjamin Waterhouse © 2015 Scott H. Krause ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Scott H. Krause: Outpost of Freedom: A German-American Network’s Campaign to bring Cold War Democracy to West Berlin, 1933-66 (under the direction of Konrad H. Jarausch) This study explores Berlin’s sudden transformation from the capital of Nazi Germany to bastion of democracy in the Cold War. This project has unearthed how this remarkable development resulted from a transatlantic campaign by liberal American occupation officials, and returned émigrés, or remigrés, of the Marxist Social Democratic Party (SPD). This informal network derived from members of “Neu Beginnen” in American exile. Concentrated in wartime Manhattan, their identity as German socialists remained remarkably durable despite the Nazi persecution they faced and their often-Jewish background. Through their experiences in New Deal America, these self-professed “revolutionary socialists” came to emphasize “anti- totalitarianism,” making them suspicious of Stalinism. Serving in the OSS, leftists such as Hans Hirschfeld forged friendships with American left-wing liberals. These experiences connected a wider network of remigrés and occupiers by forming an epistemic community in postwar Berlin. They recast Berlin’s ruins as “Outpost of Freedom” in the Cold War. -

Quellen- Und Literaturverzeichnis
Quellen- und Literaturverzeichnis I. Unveröffentlichte Quellen Berlin, Berlin Document Center (BDC) MF und PK. Berlin, Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung (IfGA) IV 2/13/240, 243, 301. Bonn, Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv (ParlA OBT) M 70237, 70248, 70258, 70261, 70270. Ordner 6. PR/G, 0, W. ZB 1/228,231, 259, 260, 261, 263, 265. Bonn, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PoIA AA) NL Kordt/1. Bonn, Archiv der sozialen Demokratie (AsO) Best. F. Heine/8, 9, 30. Best. Ollenhauer / Allg. Korrespondenz - Inland, 1948, L-Z. Best. Schumacher /126a, 126b, 127a, 128, 144, 147. Best. SPO-PV, Büro Schumacher /04438. NL Brill/Y. NL Fritz Hoch/Mappe 50. NL Menzel/R 1, R 2, R 3. NL C. Schmid/1161, 1162. NL Wessel/104 II, 120, 157, 387. Bremen, Staatsarchiv (StA Bremen) 3-Y.1.Nr.l00/2, 44, 49. Düsseldorj, Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv (NrwHStA) NW 57/11, 14. Freiburg, Staatsarchiv (StA Freiburg) AI/59, 60, 61, 342, 411, 412. A 2/9323. Gummersbach, Archiv des Deutschen Liberalismus (AOL) Best. FOP /2958. NL Th. Oehler N 1-291, 2729. NL Fertsch N 20-1, 3. NL Reif N 19-32. Hamburg, Staatsarchiv (StA Hamburg) Bürgerschaft II/C II b 1, 2 (Bd. 5, 6). Senatskanzlei II/3776, 3778, 3780 Bd. 1.2. I. Unveröffentlichte Quellen 339 Kiel, Christian-Albrechts-Universität, Forschungsstelle Prof. Dr. K. Jürgensen (CAV) Akte Innenministerium, VII a 1000-1001, Bd. 1. Akte Innenministerium, I 21a/LV 1000. Koblenz, Bundesarchiv (BAK) B 118/3. Kl. Erw. 147-7, 792/3. NL 86 Brill/10a, 11, 101, 102, 331, 333, 336, 337. -

The German Bundestag in the Reichstag Building
The German Bundestag in the Reichstag Building The German Bundestag in the Reichstag Building 6 Foreword by the President of the German Bundestag, Wolfgang Schäuble Hans Wilderotter 9 “Here beats the heart of democracy” Structure and function of the Bundestag 10 The ‘forum of the nation’: the Bundestag at the heart of the German Constitution 14 “Representatives of the whole people”: the Members of Parliament 22 “The President shall represent the Bundestag”: the President of the Bundestag, the Presidium and the Council of Elders 32 “Permanent subdivisions of the Bundestag”: the parliamentary groups 40 “Microcosms of the Chamber”: the committees 48 Strategy and scrutiny: study commissions, committees of inquiry, the Parliamentary Oversight Panel and the Parliamentary Commissioner for the Armed Forces 54 “The visible hub of parliamentary business”: the plenary chamber 62 “Federal laws shall be adopted by the Bundestag”: legislation and legislative processes 76 “Establishing a united Europe”: Bundestag participation in the process of European integration Content Hans Wilderotter 83 The long road to democracy Milestones in Germany’s parliamentary history 84 “... the real school of Vormärz liberalism”: parliaments in Germany before 1848 88 “We will create a constitution for Germany”: the German National Assembly in St Paul’s Church, Frankfurt am Main 106 A “written document as the Constitution of the Prussian Kingdom”: the constituent National Assembly and the Prussian House of Representatives in Berlin 122 Democracy without parliamentarianism: