Helene Weber Portrait
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
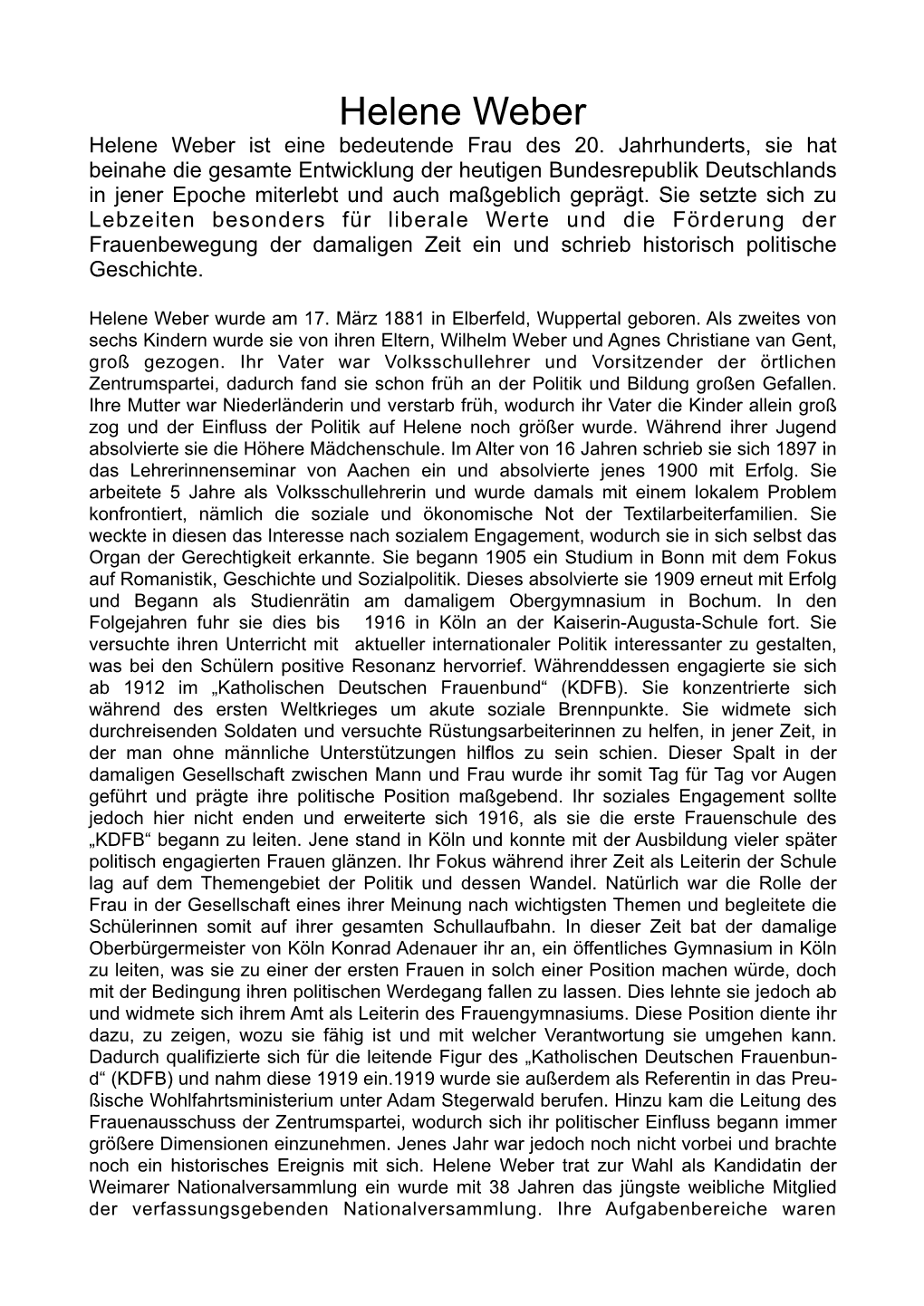
Load more
Recommended publications
-

University Microfilms
INFORMATION TO USERS This dissertation was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating' adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again — beginning below the first row and continuing on until complete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, however, a somewhat higher quality reproduction could be made from "photographs" if essential to the understanding o f the dissertation. -

Dr. H.C. Helene Weber (1881–1962): „Der Reine Männerstaat Ist Das Verderben Der Völker.“ 1 – Eine Biographische Skizze Von Regina Illemann
Regina Illemann Dr. h.c. Helene Weber (1881–1962) Dr. h.c. Helene Weber (1881–1962): „Der reine Männerstaat ist das Verderben der Völker.“ 1 – Eine biographische Skizze von Regina Illemann Am 17. März 1881 wurde Helene Weber 2 in Elberfeld geboren. Ihr Vater war Volksschullehrer, Ortsvorsitzender in der Zentrumspartei und nach dem frühen Tod seiner Frau allein für die sechs Kinder verantwortlich. Mit der Ausbildung zur Volksschullehrerin am Lehrerinnenseminar 1897–1900 in Aachen erwarb Weber den damals für Frauen höchstmöglichen Bildungsabschluss. 1905–1909 nahm sie ein Hochschulstudium auf, um an Höheren Schulen unterrichten zu dürfen. Als Studienrätin hatte sie Kontakt zum katholischen „Volksverein“ und engagierte sich im „Frauenstimmrechts-Verband für Westdeutschland“. 1916 gründete sie gemeinsam mit der Hedwig Dransfeld, der Präsidentin des „Katholischen Deutschen Frauenbundes“ (KDFB) in Köln eine Soziale Frauenschule als katholische Ausbildungsstätte für Fürsorgerinnen, die sie bis 1919 leitete 3. Zugleich mit der Schule gründete Weber auch den „Verein katholischer Sozialbeamtinnen“ 4. Wann und wie genau Weber in Kontakt zur katholischen Frauenbewegung gekommen war, ist nicht belegt. Sie war ihr im Weiteren Heimat und Basis, Berufung und Lebensaufgabe. Ihre umfangreiche par- teipolitische Tätigkeit stand letztlich im Dienst der Interessen der Kirche und der Bestrebungen und Ziele der katholischen Frauenbewegung. Ab 1918 arbeitete Weber im Zentralvorstand des KDFB mit. 1919 zog sie für das Zentrum in die verfassunggebende Nationalversammlung -

Österreichisches Anwaltsblatt 07-08 2019 430 Inhalt 07-08 2019
07–08 2019 AnwaltsÖSTERREICHISCHES 429–524 blatt 438 PORTRAIT DES MONATS Elisabeth Selbert – Die Sternstunde ihres Lebens 439 ABHANDLUNGEN Rückgang der Zivilverfahren – eine Suche nach den Ursachen Prozessebbe: Wo liegen die Gründe? Evaluierung des Rückgangs der Anfallszahlen bei Gericht Entwicklungstendenzen der Anwaltschaft in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Leistbarer Zugang zum Recht Highlights aus dem Wartungerlass der Gebührenrichtlinien 2019 486 IM GESPRÄCH Prof. Dr. Armin Höland – Weniger Streit in Europa www.rechtsanwaelte.at Österreichische Post AG · MZ 02Z032542 M · Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Wollzeile 1–3, 1010 Wien · ISSN 1605-2544 2019ANWALTSTAG Salzburg | 26. – 27. September © Simply Foto © Bryan Reinhart© Simply Foto EINLADUNG zum Anwaltstag 2019 vom 26. bis 27. September 2019 in Salzburg Alle Informationen und das Anmeldeformular fi nden Sie unter www.anwaltstag.at Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an [email protected] 429 Editorial Nach der Wahl ist vor der Wahl ie EU-Wahl ist geschlagen. Das bedeutet neue Mehr- der EU gehen wird. D heitsfindung auf europäischer Ebene. Die Zusammen- Bleibt es bei der Ten- setzung der neuen Kommission für die Funktionsperiode denz der Verfolgung bis 2024 ist politisch zu verhandeln. Die post-Juncker Kom- von Rechtsstaatlich- mission soll nach Presse-Meldungen noch „selbstbewusster keitsdefiziten, und und mächtiger“ werden. In Österreich steht nach turbulen- wenn ja, in welcher ten innenpolitischen Zeiten eine Neuorientierung bevor. Form? Wie wird die Andere Mitgliedstaaten -

The German Center Party and the League of Nations: International Relations in a Moral Dimension
InSight: RIVIER ACADEMIC JOURNAL, VOLUME 4, NUMBER 2, FALL 2008 THE GERMAN CENTER PARTY AND THE LEAGUE OF NATIONS: INTERNATIONAL RELATIONS IN A MORAL DIMENSION Martin Menke, Ph.D.* Associate Professor, Department of History, Law, and Political Science, Rivier College During the past two decades, scholarly interest in German political Catholicism, specifically in the history of the German Center Party has revived.1 As a spate of recent publication such as Stathis Kalyvas’s The Rise of Christian Democracy in Europe and the collection of essays, Political Catholicism in Europe, 1918-1965, 2 show, this renewed interest in German political Catholicism is part of a larger trend. All of these works, however, show how much work remains to be done in this field. While most research on German political Catholicism has focused on the period before 1918, the German Center Party’s history during the Weimar period remains incompletely explored. One of the least understood areas of Center Party history is its influence on the Weimar government’s foreign policy. After all, the Center led nine of the republic’s twenty cabinets. Karsten Ruppert, for example, relies almost exclusively on Peter Krüger’s Die Außenpolitik der Republik von Weimar,3 which emphasizes the role of Foreign Minister Gustav Stresemann almost to the exclusion of all other domestic decision-makers. Weimar’s foreign policy largely consisted of a series of responses to crises caused by political and economic demands made by the victors of the First World War. These responses in turn were determined by the imperatives of German domestic politics. -

Gruppenbild Mit Dame(N). Fotografische Darstellungen Der Politikerin Helene Weber in Deutschen Printmedien 1919–1933 Und 1949–1962
Katrin Schubert Gruppenbild mit Dame(n) Gruppenbild mit Dame(n). Fotografische Darstellungen der Politikerin Helene Weber in deutschen Printmedien 1919–1933 und 1949–1962 von Katrin Schubert www.helene-weber.de Muschiol / Welskop-Deffaa, Helene Weber 178 Katrin Schubert Gruppenbild mit Dame(n) I. Fragestellung, Quellenlage und Methode................................................................... 180 II. Ergebnis der Analyse für den Erhebungszeitraum 1919–1933 ................................ 184 II.1. Helene Weber und andere Politikerinnen in den Illustrierten Zeitschriften..................................................................................................... 184 II.2. Beispielanalyse: Illustrirte Zeitung Leipzig ................................................. 186 II.3. Die Bilder 1919–1933 in der Einzelanalyse ................................................. 189 III. Ergebnis der Analyse für den Erhebungszeitraum 1949–1962 ............................... 193 III.1. Quellen ........................................................................................................ 194 III.2. Ergebnisse Archiv des Bundespresseamts .................................................. 194 III.3. Ergebnisse Der Spiegel ............................................................................... 196 III.4. Ergebnisse des Vergleichs der Bildfunde Helene Weber – Elisabeth Schwarzhaupt - Annemarie Renger im Nachrichtenmagazin Der Spiegel 1949–1962 ...................................................................................................... -

36. 22. 1. 1962: Fraktionsvorstandssitzung 36A.1
CDU/CSU – 04. WP Fraktionsvorstandssitzung: 22. 01. 1962 36. 22. 1. 1962: Fraktionsvorstandssitzung ACDP, VIII-001-1503/4. Zeit: 16.00 Uhr–19.30 Uhr. Anwesend: Dr. von Brentano, Arndgen, Dr. Dollinger, Schmücker, Struve, Dr. Heck, Wacher; Dr. Barzel, Bauer, Bauknecht, Brand, Burgemei- ster, Etzel, Hoogen, Dr. Kopf, Majonica, Niederalt, Dr. Pferdmenges, Dr. Pflaumbaum, Frau Dr. Rehling, Dr. Schmidt, Schütz, Dr. Vogel, Dr. Weber (Koblenz); Regierung: ohne Vertreter; Gäste: Dr. Gerstenmaier, Dr. Jaeger, Dr. Kraske, Frau Dr. Weber. 1 36 a. 1. Tagesordnung des Plenums dieser Woche a) Regierungserklärung EWG (ohne Aussprache)2, b) Große Anfrage3 und Antrag der Fraktion betr. Radioaktivität4, c) SPD-Antrag betr. Mindesturlaub.5 2. Tagesordnung des Plenums nächster Woche Aussprache EWG.6 3. Kooptationsvorschläge für den Vorstand siehe Anlagen.7 1 Maschinenschriftliche Anmerkungen zur Tagesordnung mit drei Anlagen; alle diese Dokumente tragen den Vermerk »Bonn, den 22. 1. 1962«. 2 Regierungserklärung zur gemeinsamen Agrarpolitik in der EWG vom 24. 1. 1962. 3 Große SPD-Anfrage betr. Schutz der Gesundheit gegen radioaktive Strahlung (Drs. IV/26 vom 21. 11. 1961). 4 CDU/CSU-FDP-Antrag betr. Radioaktivität der Luft und des Regens (Drs. IV/15 vom 14. 11. 1961). 5 SPD-Gesetzentwurf über Mindesturlaub für Arbeitnehmer – Bundesurlaubsgesetz – (Drs. IV/142 vom 23. 1. 1962). 6 Regierungserklärung zur gemeinsamen Agrarpolitik in der EWG vom 24. 1. 1962. 7 Anlage 1: Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Fraktionsvorsitzender: Heinrich von Brentano Stellvertretende -

Quellen- Und Literaturverzeichnis
Quellen- und Literaturverzeichnis I. Unveröffentlichte Quellen Berlin, Berlin Document Center (BDC) MF und PK. Berlin, Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung (IfGA) IV 2/13/240, 243, 301. Bonn, Deutscher Bundestag, Parlamentsarchiv (ParlA OBT) M 70237, 70248, 70258, 70261, 70270. Ordner 6. PR/G, 0, W. ZB 1/228,231, 259, 260, 261, 263, 265. Bonn, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PoIA AA) NL Kordt/1. Bonn, Archiv der sozialen Demokratie (AsO) Best. F. Heine/8, 9, 30. Best. Ollenhauer / Allg. Korrespondenz - Inland, 1948, L-Z. Best. Schumacher /126a, 126b, 127a, 128, 144, 147. Best. SPO-PV, Büro Schumacher /04438. NL Brill/Y. NL Fritz Hoch/Mappe 50. NL Menzel/R 1, R 2, R 3. NL C. Schmid/1161, 1162. NL Wessel/104 II, 120, 157, 387. Bremen, Staatsarchiv (StA Bremen) 3-Y.1.Nr.l00/2, 44, 49. Düsseldorj, Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv (NrwHStA) NW 57/11, 14. Freiburg, Staatsarchiv (StA Freiburg) AI/59, 60, 61, 342, 411, 412. A 2/9323. Gummersbach, Archiv des Deutschen Liberalismus (AOL) Best. FOP /2958. NL Th. Oehler N 1-291, 2729. NL Fertsch N 20-1, 3. NL Reif N 19-32. Hamburg, Staatsarchiv (StA Hamburg) Bürgerschaft II/C II b 1, 2 (Bd. 5, 6). Senatskanzlei II/3776, 3778, 3780 Bd. 1.2. I. Unveröffentlichte Quellen 339 Kiel, Christian-Albrechts-Universität, Forschungsstelle Prof. Dr. K. Jürgensen (CAV) Akte Innenministerium, VII a 1000-1001, Bd. 1. Akte Innenministerium, I 21a/LV 1000. Koblenz, Bundesarchiv (BAK) B 118/3. Kl. Erw. 147-7, 792/3. NL 86 Brill/10a, 11, 101, 102, 331, 333, 336, 337. -

The German Bundestag in the Reichstag Building
The German Bundestag in the Reichstag Building The German Bundestag in the Reichstag Building 6 Foreword by the President of the German Bundestag, Wolfgang Schäuble Hans Wilderotter 9 “Here beats the heart of democracy” Structure and function of the Bundestag 10 The ‘forum of the nation’: the Bundestag at the heart of the German Constitution 14 “Representatives of the whole people”: the Members of Parliament 22 “The President shall represent the Bundestag”: the President of the Bundestag, the Presidium and the Council of Elders 32 “Permanent subdivisions of the Bundestag”: the parliamentary groups 40 “Microcosms of the Chamber”: the committees 48 Strategy and scrutiny: study commissions, committees of inquiry, the Parliamentary Oversight Panel and the Parliamentary Commissioner for the Armed Forces 54 “The visible hub of parliamentary business”: the plenary chamber 62 “Federal laws shall be adopted by the Bundestag”: legislation and legislative processes 76 “Establishing a united Europe”: Bundestag participation in the process of European integration Content Hans Wilderotter 83 The long road to democracy Milestones in Germany’s parliamentary history 84 “... the real school of Vormärz liberalism”: parliaments in Germany before 1848 88 “We will create a constitution for Germany”: the German National Assembly in St Paul’s Church, Frankfurt am Main 106 A “written document as the Constitution of the Prussian Kingdom”: the constituent National Assembly and the Prussian House of Representatives in Berlin 122 Democracy without parliamentarianism: -

Zwischen Tradition Und Emanzipation CDU-Politikerinnen in Bundesrepublikanischen Parlamenten 1945 Bis 1957
Petra Holz Zwischen Tradition und Emanzipation CDU-Politikerinnen in bundesrepublikanischen Parlamenten 1945 bis 1957 In der politikgeschichtlichen Historiographie Politikerinnen aller Parteien waren Ende der Bundesrepublik zur Nachkriegszeit kamen der 1940er/Anfang der 1950er Jahre an den Frauen lange Zeit, wenn überhaupt, nur im Diskussionen um die Ausgestaltung der rechtli- Bild der Trümmerfrau vor. Auch die historische chen Konsequenzen beteiligt, die sich aus dem Frauen- und Geschlechterforschung verortete das Gleichberechtigungsartikel ergaben. Maßgeblich Engagement von Frauen zunächst vor allem im involviert an dessen Umsetzung waren vor allem sogenannten vorpolitischen Raum. Allerdings die Politikerinnen der Regierungsfraktionen. Die wurde zur Beschreibung ihrer Aktivitäten bereits Analyse der hierbei geführten Debatten ver- ein erweiterter Partizipationsbegriff zugrunde deutlicht, dass insbesondere die Politikerinnen gelegt, der die Relevanz des politischen Han- der CDU ihr Engagement auf zweierlei Weise delns von Frauen in den bis dahin häufig als begründeten: Entweder argumentierten sie mit ›unpolitisch‹ apostrophierten Vorfeldorganisa- Rekurs auf ›Gleichheit‹ oder aber mit Verweis auf tionen, wie Vereine und Verbände, hervorhob. die ›Differenz‹ zwischen den Geschlechtern. Dadurch fielen allerdings Parlamentarierinnen wie auch generell Frauen, die sich in den etab- lierten politischen Organisationen engagierten, 1. Politische Partizipation der durch das eng gefasste Raster.1 ersten Politikerinnengeneration Demgegenüber möchte -

Theodor Heuss Der Bundespräsident Briefe 1954–1959
Theodor Heuss Der Bundespräsident Briefe 1954‒1959 Theodor Heuss Stuttgarter Ausgabe Briefe Herausgegeben von der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus Wissenschaftliche Leitung Ernst Wolfgang Becker Editionsbeirat Wolfgang Hardtwig, Hans Peter Mensing, Angelika Schaser, Andreas Wirsching De Gruyter Theodor Heuss Der Bundespräsident Briefe 1954–1959 Herausgegeben und bearbeitet von Ernst Wolfgang Becker, Martin Vogt und Wolfram Werner De Gruyter Träger des Editionsprojekts: Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus Im Himmelsberg 16, 70192 Stuttgart www.stiftung-heuss-haus.de Die Stiftung wird vom Bund aus dem Haushalt des Staatsministers für Kultur und Medien gefördert. ISBN 978-3-598-25128-3 e-ISBN 978-3-11-029842-0 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Umschlag: Foto: Theodor Heuss, 1956; Fotograf: Georg Bauer; Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, B 145 Bild-15020. Brief: Theodor Heuss an Carlo Schmid, 19. 2. 1955, in: AdsD, NL Schmid, 1/CSAA000645, abgedruckt auf S. 171. © 2013 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Satz: Dr. Rainer Ostermann, München Druck: Strauss GmbH, Mörlenbach ♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com Inhalt Vorwort des Editionsbeirates.............................. -

Marie-Emmanuelle Reytier Helene Weber Als Europäerin
Marie-Emmanuelle Reytier Helene Weber als Europäerin Helene Weber als Europäerin von Marie-Emmanuelle Reytier www.helene-weber.de Muschiol / Welskop-Deffaa, Helene Weber 216 Marie-Emmanuelle Reytier Helene Weber als Europäerin I. Einführung .................................................................................................................. 218 II. Helene Weber als Europäerin vor 1933 .................................................................... 218 II.1. Ein gemäßigter Patriotismus......................................................................... 218 II.1.1. Helene Webers Verständnis von Europa vor 1914 .......................... 218 II.1.2. Der Erste Weltkrieg, das Kriegsende und der Versailler Vertrag .... 219 II.1.3. Elsass-Lothringen............................................................................. 224 II.2. Die Tagungen der ‚Demokratischen Parteien christlicher Prägung‘ ............ 227 II.2.1. Die Gründung 1925 .......................................................................... 227 II.2.2. Entwicklung, Höhepunkte und Untergang: 1926–1932 ................... 228 III. Überleitung 1933–1945 ........................................................................................... 231 IV. Helene Weber als Europäerin nach 1945 ................................................................ 233 IV.1. Helene Weber als Delegierte des Bundestages zur beratenden Versammlung des Europarates nach 1945 ...................................................... 233 IV.1.1. Die bescheidene Stellung Helene -
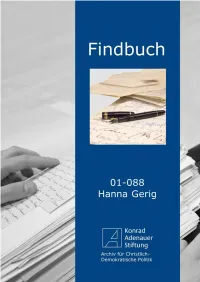
Kas 48002-544-1-30.Pdf
ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 01 – 088 HANNA GERIG SANKT AUGUSTIN 2017 I Inhaltsverzeichnis 1 Persönliches 1 2 Korrespondenz 3 3 Verfolgtenorganisationen 6 3.1 Bund der Verfolgten des Naziregimes (BVN) 6 3.2 Weitere Verfolgtenorganisationen 6 4 Materialsammlung 8 4.1 Presseausschnitte 8 4.2 Veröffentlichungen (Hefte, Broschüren, Bücher) 8 4.3 Fotos 10 4.4 Heinrich Brüning 10 Sachbegriff-Register 11 Personenregister 12 Biographische Angaben: 31.05.1900 geboren in Potsdam als Hanna Degenhardt, Vater: Oberpostsekretär Anton Degenhardt, Ortsvorsitzender des Zentrums, Mutter: Emma von Rönne bis 1916 Städtisches Lyzeum in Potsdam, danach Handelsschule und Handelshochschule in Potsdam als Gasthörerin 1917 Angestellte der Deutschen Bank in Potsdam, später Hauptverwaltung in Berlin 1924 Heirat mit dem Reichstagsabgeordneten Otto Gerig, 5 Kinder (eines verstarb früh) 1944 Otto Gerig nach dem 20. Juli 1944 im Rahmen der "Aktion Gewitter" verhaftet, am 03.10.1944 im KZ Buchenwald an Folgen der Haft verstorben 1944-1945 Engagement für die Gefangenen des NS-Regimes in den Messehallen Köln-Deutz ("Engel der Messehallen") 1945 Mitgründerin der CDU in Köln (Mitgliedsnummer 32), an der Abfassung der "Kölner Leitsätze" beteiligt 07.06.1945 Teilname an den Walberberger Gesprächen seit 1945 Mitglied der Deutschen Angestellten Gewerkschaft, später Leiterin der DAG Frauenvereinigung Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Hauptvorstand 1945-1948 Sozialreferentin bei der RHENAG - Rheinische Energie A.G. 1946-1965 Stadtverordnete