Utopie 213/214
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abschied Von Bismarck
Wirtschaft DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM BERLIN HISTORISCHES DEUTSCHES Arbeitslose während der Weltwirtschaftskrise (1932): Tiefere Ursachen der Misere Jobsuchende (2002): Vorsorge jenseits von Abschied vonREFORMEN Bismarck Mit seinem Abgabenwahn treibt der deutsche Sozialstaat Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit und Schattenwirtschaft. Ein DIW-Gutachten im Auftrag des SPIEGEL zeigt: Wenn die Lohnnebenkosten massiv sinken würden, könnten bis zu eine Million neue Jobs entstehen. ür Florian Gerster, den obersten Ar- Wirtschaftsprofessor Paul Welfens. Ähnli- zwischen Brutto- und Nettogehalt muss beitsvermittler der Republik, ist es che Szenarien kursieren auch bei der Bun- kleiner werden.“ Fein trauriges Ritual: Alle vier Wo- desvereinigung der Deutschen Arbeitge- Denn in kaum einem anderen Industrie- chen betritt er einen schlichten Saal im berverbände. land der Welt sind die Sozialabgaben in Hochhaus der Nürnberger Bundesanstalt, Gründe dafür gibt es viele: die miese den vergangenen Jahrzehnten derart ra- um mit vielen Worten eine nüchterne Weltkonjunktur. Die ängstliche Zurück- sant gestiegen wie in Deutschland: Ende Statistik zu erklären, die Zahl der Arbeits- haltung der Verbraucher. Das schlech- der fünfziger Jahre lagen die gesamten So- losen in Deutschland. te Wetter. „Der Februar“, Und so hatte der Mann, der einst als sagt Gerster, „war kalt und Sozialminister in Rheinland-Pfalz Karriere schneereich.“ Deshalb ging machte, ehe Gerhard Schröder ihn nach es den wetterabhängigen Nürnberg schickte, auch am Donnerstag Branchen schlecht. -

EUSA Boyleschuenemann April 15
The Malleable Politics of Activation Reform: the‘Hartz’ Reforms in Comparative Perspective Nigel Boyle[[email protected]] and Wolf Schünemann [[email protected]] Paper for 2009 EUSA Biennial Conference, April 25, Los Angeles. Abstract In this paper we compare the Hartz reforms in Germany with three other major labor market activation reforms carried out by center-left governments. Two of the cases, Britain and Germany, involved radically neoliberal “mandatory” activation policies, whereas in the Netherlands and Ireland radical activation change took a very different “enabling” form. Two of the cases, Ireland and Germany, were path deviant, Britain and the Netherlands were path dependent. We explain why Germany underwent “mandatory” and path deviant activation by focusing on two features of the policy discourse. First, the coordinative (or elite level) discourse was “ensilaged” sealing policy formation off from dissenting actors and, until belatedly unwrapped for enactment, from the wider communicative (legitimating) discourse. This is what the British and German cases had in common and the result was reform that viewed long term unemployment as personal failure rather than market failure. Second, although the German policy-making system lacked the “authoritative” features that facilitated reform in the British case, and the Irish policy- making system lacked the “reflexive” mechanisms that facilitated reform in the Dutch case, in both Germany and Ireland the communicative discourses were reshaped by novel institutional vehicles (the Hartz Commission in the German case, FÁS in the Irish case) that served to fundamentally alter system- constitutive perceptions about policy. In the Irish and German cases “government by commission” created a realignment of advocacy coalitions with one coalition acquiring a new, ideologically-dominant and path deviating narrative. -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 15/34 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 34. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. März 2003 Inhalt: Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 2701 A Dr. Angela Merkel CDU/CSU . 2740 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 2701 D Gerhard Rübenkönig SPD . 2741 B Steffen Kampeter CDU/CSU . 2743 D Tagesordnungspunkt I: Petra Pau fraktionslos . 2746 D Zweite Beratung des von der Bundesregie- Dr. Christina Weiss, Staatsministerin BK . 2748 A rung eingebrachten Entwurfs eines Geset- Dr. Norbert Lammert CDU/CSU . 2749 C zes über die Feststellung des Bundeshaus- haltsplans für das Haushaltsjahr 2003 Günter Nooke CDU/CSU . 2750 A (Haushaltsgesetz 2003) Petra-Evelyne Merkel SPD . 2751 D (Drucksachen 15/150, 15/402) . 2702 B Jens Spahn CDU/CSU . 2753 D 13. Einzelplan 04 Namentliche Abstimmung . 2756 A Bundeskanzler und Bundeskanzleramt Ergebnis . 2756 A (Drucksachen 15/554, 15/572) . 2702 B Michael Glos CDU/CSU . 2702 C 19. a) Einzelplan 15 Franz Müntefering SPD . 2708 A Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung Wolfgang Bosbach CDU/CSU . 2713 A (Drucksachen 15/563, 15/572) . 2758 B Franz Müntefering SPD . 2713 D Dr. Guido Westerwelle FDP . 2714 C b) Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/ Otto Schily SPD . 2718 B DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- Hans-Christian Ströbele BÜNDNIS 90/ wurfs eines Gesetzes zur Änderung der DIE GRÜNEN . 2719 A Vorschriften zum diagnoseorientierten Fallpauschalensystem für Kranken- Dr. Guido Westerwelle FDP . 2719 C häuser – Fallpauschalenänderungs- Krista Sager BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2720 C gesetz (FPÄndG) (Drucksache 15/614) . 2758 B Dr. Wolfgang Schäuble CDU/CSU . 2724 D Dr. Michael Luther CDU/CSU . 2758 D Gerhard Schröder, Bundeskanzler . -

UID 2003 Nr. 2, Union in Deutschland
^iffÄlP ftKTlONSZElTUNG: Nummer 2 16. Januar 2003 www. cdu.de GöTTINGER ERKLäRUNG INHALT Mehr Eigenverantwortung NIEDERSACHSEN Christian Wulff: Rot- mehr Freiheit, weniger Staat Grün können die Men- schen sich nicht leisten. Gemeinsam mit den bei- der „Göttinger Erklärung" - Wahlkampfauftakt den Spitzenkandidaten bei das bedeutet: „eine Politik, SEITE 4-5 den Landtagswahlen am die den Mut hat, Wahrheiten HESSEN 2. Februar, Roland Koch auszusprechen, statt sie Jetzt geht's los! Roland und Christian Wulff, trat durch Lügen zu verdecken". Koch und die CDU Angela Merkel nach der Angela Merkel: „Auf Hessen starten heiße Klausur des Bundesvor- diese Weise werden wir in Phase des Wahlkampfs stands in Göttingen vor die diesem Jahr die Weichen für SEITE 6-7 Presse: Reformen bei der Einwan- „KURSWECHSEL FÜR derung stellen, bei der inne- DOKUM ENTATION DEUTSCHLAND" - diese ren und äußeren Sicherheit Kurswechsel für Überschrift stand über den und bei den sozialen Siche- Deutschland. Göttinger Beratungen am 10. und 11. rungssystemen." Erklärung Januar und steht auch über Fortsetzung Seite 2 1 HEUTE AKTUELL GöTTINGER ERKLäRUNG • Wirtschaftsvertreter lo- ben die konstruktive Hal- Der Staat muss sich auf seine tung der Union (Seite Kernaufgaben konzentrieren 8-9) • Generalsekretär Laurenz Meyer zum Null- Fortsetzung von Seite 1 effektive Lebensarbeitszeit Wachstum der Wirtschaft Reformziel ist und bleibt - ohne Anhebung der gesetz- (Seite 9) • Dietrich Aus- wie es auch im Wahlpro- lichen Altersgrenze um drei termann: Die Aufforde- gramm der Union zur Jahre verlängert wird. Er- rung aus Brüssel ist die fi- Bundestagswahl steht: 3 reicht werden kann dies nanzpolitische Bankrott- mal 40, also die Senkung durch die Verkürzung über- erklärung von Rot-Grün des Spitzensteuersatzes, langer Ausbildungszeiten in (Seite 10-11) • Gene- der Sozialabgaben und der Schule (Abitur nach 12 Jah- ralsekretär Laurenz Mey- Staatsquote auf jeweils ren) und Hochschule sowie er zum Tarifabschluss im maximal 40 Prozent. -

10. Bundesversammlung Bundesrepublik Deutschland
10. BUNDESVERSAMMLUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BERLIN, MONTAG, DEN 23. MAI 1994 10. Bundesversammlung — Berlin, Montag, den 23. Mai 1994 Inhalt Eröffnung durch Präsidentin Dr. Rita Süssmuth 3 A Konstituierung der Bundesversammlung . 5 B Zur Geschäftsordnung Dr. Rolf Schlierer (Republikaner) 5 B Erster Wahlgang 6 C Ergebnis des ersten Wahlgangs 7 A Zweiter Wahlgang 7 C Ergebnis des zweiten Wahlgangs 7 C Dritter Wahlgang 8 A Ergebnis des dritten Wahlgangs 8 B Annahme der Wahl durch Dr. Roman Herzog 8 B Ansprache von Dr. Roman Herzog 8 B Schlußworte der Präsidentin Dr. Rita Süssmuth 9 C Liste der Mitglieder der Bundesversammlung, die an der Wahl teilgenommen haben . 10 A Liste der entschuldigten Mitglieder der Bundesversammlung 16 B 10. Bundesversammlung — Berlin, Montag, den 23. Mai 1994 10. Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland Berlin, Montag, den 23. Mai 1994 Stenographischer Bericht Von dieser Stelle aus möchte ich unserem Bundes- präsidenten, Richard von Weizsäcker, und seiner Frau Beginn: 11.00 Uhr Marianne von Weizsäcker unsere herzlichsten Grüße in den Berliner Amtssitz übermitteln Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Meine sehr geehr- (Beifall) ten Damen und Herren! Ich eröffne die 10. Bundesver- sammlung zur Wahl des siebten Präsidenten der Bun- und ihnen danken für ihren hohen Einsatz, für die von desrepublik Deutschland und heiße Sie alle herzlich uns allen hochgeachtete Arbeit für unser Land. willkommen. (Beifall) Ich begrüße die Mitglieder der Bundesversamm- Heute sind wir hier zusammengekommen, um zum lung, unter ihnen Bundeskanzler Helmut Kohl, ersten Mal nach der Vereinigung Deutschlands den Bundespräsidenten aller Deutschen zu wählen. Das (Beifall) ist ein Ereignis, das uns besonders bewegt. die Mitglieder der Bundesregierung, die Ministerprä- Pfingsten und Verfassungstag — welch geeignete- sidenten, Minister und Senatoren der Bundesländer. -

Teil A: Lobbyismus: Ein Überblick Aus Verschiedenen Perspektiven 1 Lobbyismus Im Medialen Diskurs – Ein Streifzug Durch Die Vergangenen Zehn Jahre
Otto Brenner Stiftung OBS-Arbeitsheft 70 – Marktordnung für Lobbyisten – ONLINETEIL Andreas Kolbe, Herbert Hönigsberger, Sven Osterberg Teil A: Lobbyismus: Ein Überblick aus verschiedenen Perspektiven 1 Lobbyismus im medialen Diskurs – Ein Streifzug durch die vergangenen zehn Jahre Ein Vorschlag der Otto Brenner Stiftung Frankfurt/Main 2011 TEIL A: LOBBYISMUS: EIN ÜBERBLICK AUS VERSCHIEDENEN PERSPEKTIVEN Teil A: Lobbyismus: Ein Überblick aus verschiedenen Perspektiven 1 Lobbyismus im medialen Diskurs – Ein Streifzug durch die vergangenen zehn Jahre1 Vor dem Regierungsumzug von Bonn nach Ber- gistrierten Verbände und deren Vertreter“ aus lin ist „Lobbyismus“ in der Presseberichterstat- dem Jahr 1972 als Beleg dafür gewertet, dass es tung kaum ein Thema, jedenfalls nicht in der eine Art Registrierungspflicht für Lobbyisten negativen Konnotation, die gegenwärtig domi- bereits gäbe.3 Ansonsten konzentriert sich die niert. Ab 1999 werden die meisten Lobbyismus- Berichterstattung bis Ende des Jahres 2000 Artikel zunächst mit einer Erklärung eingelei- eher deskriptiv auf Verbände und Unterneh- tet, was Lobbyismus ist, woher das Wort stammt mensrepräsentanzen, die nach Berlin gezogen und was es bedeutet. Der Fokus liegt auf der sind. Die Aufmerksamkeit gilt den millionen- Berichterstattung über Lobbyismus in Brüssel. schweren Kontaktvermittlungen von Agnes Das erste Fallbeispiel von „Lobbyeinfluss“ und Hürland-Büning und dem Gebaren des Rüs- „Lobbymacht“ in Deutschland ist die BSE-Krise tungslobbyisten Karlheinz Schreiber. Hin und und die Rolle des Bauernverbandes.2 Dieser wieder wird auch die Rolle von Abgeordneten „Skandal“ zieht eine strukturelle Veränderung in Aufsichtsräten hinterfragt. in der Organisation der Ministerien nach sich. Durch diverse Korruptionsskandale im Jahr Der Ruf nach einem Bundesministerium für Ver- 2001 rückt der „Lobbyismus“ in die Schmier- braucherschutz wird lauter, und Rot-Grün geld- bzw. -

Marktwirtschaft.De
Peter Gillies marktwirtschaft.de Frankfurter Institut Stiftung Marktwirtschaft und Politik marktwirtschaft.de Jahr 2000 das ist auch Chiffre für Hoffnungen, die nicht gerade bescheiden sind: persönliche Freiheit und Wohlstand für alle, sozialer Zusammenhalt in lebenswertem Umfeld, und dies nachhaltig und dauerhaft auch für Kinder und Enkel. Das alles dürfte zu schaffen sein, wenn wir uns darauf verständigen, in Deutschland wieder marktwirtschaft.de anzuklicken und sie uns zunutze zu machen nicht als Fetisch, sondern im Sinne Ludwig Erhards als Angebot für eine an Freiheit und Verantwortung orientierte Lebensordnung. Die hier vorgelegte Arbeit von Peter Gillies macht Marktwirtschaft auf unkonventionelle Weise anschaulich, erklärt Zusammenhänge, schärft den Blick fürs Ganze. Und sie zeigt, was jetzt zu tun ist, damit Marktwirtschaft wieder ihr Potenzial entfalten kann. Die Aufgeschlossenheit dafür wächst. Schöpferische Unruhe macht sich breit und verändert die Verhaltensweisen. Nicht nur die jungen Menschen der Internet-Generation fragen Eigenverantwortung nach und werden Politik daran messen, ob sie die Voraussetzungen für eine Gesellschaft mündiger Bürger gewährleistet. Die Zeit ist reif für den Aufbruch und für ein neues Zutrauen in die Zukunft. marktwirtschaft.de wird allenthalben ihr Kennzeichen sein. Auch bei uns. Gert Dahlmanns © 2000 Frankfurter Institut Stiftung Marktwirtschaft und Politik Kisseleffstraße 10 61348 Bad Homburg Vorstand: Gert Dahlmanns Internet: www.marktwirtschaft.de e-mail: [email protected] Karikaturen: Berndt A. Skott Gestaltung und Lektorat: Konrad Morath ISBN 3-89015-073-X 2 Vorwort Deutschland sei, so behaupten Spötter, ein wieder quälenden Fragen Antworten zu ge- glückliches Land, bewohnt von trübsinnigen ben. Wo bleibt die Moral in der Wirtschaft, Bürgern. Oder ist es umgekehrt? Jedenfalls wie entsteht Arbeit, wie sicher sind die Ren- klaffen private und öffentliche Befindlichkeit ten und wie gerecht die Steuern? Verenden wir auseinander. -

Plenarprotokoll 15/88
Plenarprotokoll 15/88 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 88. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 29. Januar 2004 Inhalt: Nachruf auf die Abgeordnete und Vorsitzende CSU: Perspektiven schaffen für das des Petitionsausschusses Marita Sehn . 7705 A Jahr der Technik 2004 (Drucksache 15/2161) . 7727 A Erweiterung der Tagesordnung . 7705 C b) Beschlussempfehlung und Bericht des Absetzung des Tagesordnungspunktes 21. 7706 B Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung Tagesordnungspunkt 3: – zu dem Antrag der Abgeordneten Michael Kretschmer, Katherina Unterrichtung durch die Bundesregierung: Reiche, weiterer Abgeordneter und Aktionsprogramm Informationsgesell- der Fraktion der CDU/CSU: Die schaft Deutschland 2006 Innovationskraft Deutschlands (Drucksache 15/2315) . 7706 B stärken – Zukunftschancen Wolfgang Clement, Bundesminister durch moderne Forschungsför- BMWA . 7706 C derung eröffnen Dr. Martina Krogmann CDU/CSU . 7709 B – zu dem Antrag der Abgeordneten Ulrike Flach, Cornelia Pieper, wei- Fritz Kuhn BÜNDNIS 90/ terer Abgeordneter und der Frak- DIE GRÜNEN . 7711 D tion der FDP: Aktionsplan für Rainer Brüderle FDP . 7713 C freie, effiziente und innovative Forschung Hubertus Heil SPD . 7715 D (Drucksachen 15/1696, 15/1932, Dr. Heinz Riesenhuber CDU/CSU . 7717 C 15/2383) . 7727 B Grietje Bettin BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN . 7720 B in Verbindung mit Petra Pau fraktionslos . 7721 B Christoph Matschie, Parl. Staatssekretär Zusatztagesordnungspunkt 1: BMBF . 7722 A a) Erste Beratung des von den Abgeord- Dr. Georg Nüßlein CDU/CSU . 7723 C neten Katherina Reiche, Dr. Maria Böhmer, weiteren Abgeordneten und Jörg Tauss SPD . 7725 A der Fraktion der CDU/CSU einge- brachten Entwurfs eines Siebten Ge- setzes zur Änderung des Hochschul- Tagesordnungspunkt 4: rahmengesetzes (7. HRGÄndG) (Drucksache 15/2385) . 7727 B a) Antrag der Abgeordneten Katherina Reiche, Thomas Rachel, weiterer Ab- b) Erste Beratung des von den Abge- geordneter und der Fraktion der CDU/ ordneten Ulrike Flach, Christoph II Deutscher Bundestag – 15. -

Stenografischer Bericht 75. Sitzung
Plenarprotokoll 15/75 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 75. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 13. November 2003 Inhalt: Benennung des AbgeordnetenStephan – zu der Unterrichtung durch die Mayer (Altötting) als stellvertretendes Mit- Bundesregierung: glied in das Kuratorium der Stiftung „Erinne- Mitteilung der Kommission an rung, Verantwortung und Zukunft“ . 6407 A den Rat und das Europäische Parlament Erweiterung der Tagesordnung . 6407 B Nukleare Sicherheit im Rahmen Absetzung der Tagesordnungspunkte 19 und der Europäischen Union 24 b . 6408 A KOM (2002) 605 endg.; Ratsdok. 15875/02 Tagesordnungspunkt 3: – zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung: a) Erste Beratung des von den Fraktionen Vorschlag für eine Richtlinie der SPD und des BÜNDNISSES 90/ (EURATOM) des Rates zur Fest- DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- legung grundlegender Verpflich- wurfs eines Zweiten Gesetzes zur tungen und allgemeiner Grund- Änderung des Erneuerbare-Ener- sätze im Bereich der Sicherheit gien-Gesetzes (EEG) kerntechnischer Anlagen (Drucksache 15/1974) . 6408 B Vorschlag für eine Richtlinie b) Antrag der Abgeordneten Ulrike (EURATOM) des Rates über die Flach, Cornelia Pieper, weiterer Abge- Entsorgung abgebrannter Brenn- ordneter und der Fraktion der FDP: elemente und radioaktiver Abfälle Energiespeicherforschung vorantrei- KOM (2003) 32 endg.; Ratsdok. ben – Höchsttechnologien für die 8990/03 Speichertechnik entwickeln (Drucksachen 15/503 Nr. 1.3, 15/1153 (Drucksache 15/1605) . 6408 B Nr. 2.20, 15/1781) . 6408 C c) Antrag der Abgeordneten Angelika Horst Kubatschka SPD . 6408 D Brunkhorst, Birgit Homburger, weite- Dr. Peter Paziorek CDU/CSU . 6410 D rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP: Perspektiven für eine markt- Michaele Hustedt BÜNDNIS 90/ wirtschaftliche Förderung erneuer- DIE GRÜNEN . 6413 C barer Energien Angelika Brunkhorst FDP . -
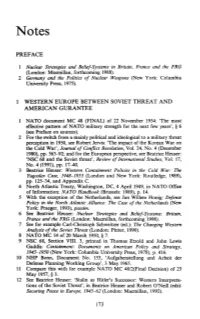
Preface 1 Western Europe Between Soviet Threat And
Notes PREFACE Nuclear Strategies and Belief-Systems in Britain, France and the FRG (London: Macmillan, forthcoming 1988). 2 Germany and the Politics of Nuclear Weapons (New York: Columbia University Press, 1975). 1 WESTERN EUROPE BETWEEN SOVIET THREAT AND AMERICAN GURANTEE NATO document MC 48 (FINAL) of 22 November 1954: 'The most effective pattern of NATO military strength for the next few years', § 6 (see Preface on sources). 2 For the switch from a mainly political and ideological to a military threat perception in 1950, see Robert Jervis: 'The impact of the Korean War on the Cold War', Journal of Conflict Resolution, Vol. 24, No. 4 (December 1980), pp. 563-92; and for the European perspective, see Beatrice Heuser: 'NSC 68 and the Soviet threat', Review of International Studies, Vol. 17, No. 4 (1991), pp. 17-40. 3 Beatrice Heuser: Western Containment Policies in the Cold War: The Yugoslav Case, 1948-1953 (London and New York: Routledge, 1989), pp. 125-34, and Appendix C. 4 North Atlantic Treaty, Washington, DC, 4 April 1949, in NATO Office ofInformation: NATO Handbook (Brussels: 1989), p. 14. 5 With the exception of the Neth(:rlands, see Jan Willem Honig: Defense Policy in the North Atlantic Alliance: The Case of the Netherlands (New York: Praeger, 1993), passim. 6 See Beatrice Heuser: Nuclear Strategies and Belief-Systems: Britain, France and the FRG (London: Macmillan, forthcoming 1998). 7 See for example Carl-Christoph Schweitzer (ed.): The Changing Western Analysis of the Soviet Threat (London: Pinter, 1990). 8 NATO MC 14 of 20 March 1950, § 7. 9 NSC 68, Section VIII. -

Kleine Anfrage Der Abgeordneten Dr
Deutscher Bundestag Drucksache 12/321 12. Wahlperiode 25.03.91 Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Ingomar Hauchler, Brigitte Adler, Robert Antretter, Rudolf Bindig, Dr. Eberhard Brecht, Dr. Andreas von Bülow, Freimut Duve, Dr. Horst Ehmke (Bonn), Katrin Fuchs (Verl), Norbert Gansel, Florian Gerster (Worms), Dr. Uwe Holtz, Gabriele Iwersen, Hans-Ulrich Klose, Walter Kolbow, Hans Koschnick, Christoph Matschie, Markus Meckel, Gerhard Neumann (Gotha), Dieter Schanz, Dieter Schloten, Günter Schluckebier, Dr. Werner Schuster, Dr. Hartmut Soell, Heinz-Alfred Steiner, Margitta Terborg, Hans-Günther Toetemeyer, Günter Verheugen, Karsten Voigt (Frankfurt), Hans Wallow, Gert Weisskirchen (Wiesloch), Verena Wohlleben, Uta Zapf, Dr. Christoph Zöpel, Peter Zumkley Multilaterale Darlehen an Brasilien und andere Entwicklungsländer Die derzeitigen Verhandlungen zwischen Brasilien als einem der am höchsten verschuldeten Entwicklungsländer und den p rivaten Geschäftsbanken über Zins- und Tilgungsrückstände haben eine Schlüsselfunktion für Um- und Entschuldung vieler anderer Ent- wicklungsländer. Sie können auch Rückwirkungen haben für das Verhältnis zwischen den Entwicklungsländern und multilateralen Entwicklungsbanken und können deren finanzielle Position be- einflussen. Wir fragen deshalb die Bundesregierung: 1. Wie haben sich die externen Schulden Brasiliens in den Jah- ren 1982, 1985, 1989 und 1990 entwickelt? 2. Welcher Anteil an den gesamten externen Schulden Brasiliens entfällt auf Schulden gegenüber privaten und öffentlichen Gläubigern — und unter diesen gegenüber bilateralen und multilateralen Gebern, insbesondere gegenüber der Weltbank (IBRD) und der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB)? Wie hoch sind die Anteile der amerikanischen und deutschen Banken am Gesamtvolumen der kommerziellen Schulden Bra- siliens? 3. Wie hoch sind die Zins- und Tilgungsrückstände Brasiliens gegenüber IBRD und IDB? Wie hoch sind die Zins- und Tilgungsrückstände Brasiliens gegenüber den privaten Gläubigern? Drucksache 12/321 Deutscher Bundestag — 12. -

Jahresbericht Der FES 2011
JAHRESBERICHT 2011 ANNUAL REPORT 2011 Perspektiven 2012 Perspectives 2012 JAHRESBERICHT 2011 ANNUAL REPORT 2011 Perspektiven 2012 Perspectives 2012 INHALT CONTENT 05 FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 06 Der Sozialen Demokratie verpfl ichtet Committed to Social Democracy 08 Zahlen und Fakten Facts and Figures 10 Geschichte History 12 Vorwort zum Jahresbericht 2011 Preface to Annual Report 2011 21 Nachruf: Trauer um Dr. Günter Grunwald 23 STRATEGISCHE ZIELE 25 Die Wirtschafts- und Sozialordnung gerecht gestalten 31 Die Globalisierung sozial gestalten 35 Politische Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken 41 Die Erneuerung der Sozialen Demokratie fördern 45 Den Dialog zwischen Gewerkschaften und Politik vertiefen 49 DIE FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG IM SPIEGEL DER PRESSE 65 SCHWERPUNKTTHEMEN 66 Mit guter Bildung mehr Gerechtigkeit schaffen 68 Wege aus der Krise: Die Zukunft Europas sichern 70 Umbrüche im arabischen Raum: Den Wandel begleiten 73 ARBEITSBEREICHE 74 Politische Bildung 78 Studienförderung 79 Wirtschafts- und Sozialpolitik 80 Zentrale Aufgaben 81 Zentrale Arbeits- und Gesprächskreise 84 Internationale Arbeit 87 Bibliothek 88 Archiv der sozialen Demokratie 89 Unselbständige Stiftungen/Sondervermögen 91 ANHANG 92 Organisationsplan 94 Jahresabschluss zum 31.12.2011 100 Zum Selbstverständnis der Politischen Stiftungen 101 Mitglieder des Vorstandes 102 Mitglieder des Vereins 104 Mitglieder des Kuratoriums 105 Mitglieder des Auswahlausschusses 106 Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten 114 Anschriften 116 Impressum FRIEDRICH- EBERT- STIFTUNG 06 Der Sozialen Demokratie verpfl ichtet Committed to Social Democracy 08 Zahlen und Fakten Facts and Figures 10 Geschichte History 12 Vorwort zum Jahresbericht 2011 Preface to Annual Report 2011 21 Nachruf: Trauer um Dr. Günter Grunwald 6 FES DER SOZIALEN DEMOKRATIE VERPFLICHTET WER WIR SIND 1925 als politisches Vermächtnis Friedrich Eberts gegründet, ist die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) heute die traditionsreichste politische Stiftung in Deutschland.