Martin Haller Und Sein Wirken in Hamburg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Franz Bach. Architekt Und Unternehmer Franz Bach
HWS_SU_Bach_20.1.2011_END.qxd 20.01.2011 22:37 Uhr Seite 1 Aus der Reihe „Mäzene für Wissen- Mit dem 100-jährigen Jubiläum der schaft“ sind bisher erschienen: Mönckebergstraße in der Freien und Hansestadt Hamburg wurde der Öf- Band 1 fentlichkeit zuletzt im Jahr 2009 ins Die Begründer der Hamburgischen Gedächtnis gerufen, wer die Erbauer Wissenschaftlichen Stiftung der großen Kontorhäuser in dieser bemerkenswerten Geschäftsstraße ge- Band 2 wesen sind. Franz Bach hat ihre Ar- Sophie Christine und Carl Heinrich chitektur maßgeblich geprägt. Darü- Laeisz. Eine biographische Annähe- ber hinaus war er an verschiedenen rung an die Zeiten und Themen anderen Orten der Stadt als Baumeis- ihres Lebens ter tätig. Band 3 Eduard Lorenz Lorenz-Meyer. Die vorliegende Biographie, die erste Ein Hamburger Kaufmann und über Franz Bach, zeichnet das außer- Künstler gewöhnliche Leben dieses Mannes nach: Sein Talent, seine Architektur Band 4 und sein Unternehmergeist werden Hermann Franz Matthias Mutzen- ebenso beleuchtet wie sein soziales becher. Ein Hamburger Versiche- und kulturelles Engagement als Ham- rungsunternehmer burger Bürger, der zwei Künstlern – Band 5 Heinrich Heine und Gottfried Sem- Die Brüder Augustus Friedrich per – eine Gedenkstätte errichtete und Gustav Adolph Vorwerk. und 1907 zu den Begründern der Zwei Hamburger Kaufleute Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung gehörte. Band 6 Franz Bachs Lebensgeschichte ist Albert Ballin zugleich ein spannender Streifzug Band 7 durch die Hamburger Architekturge- Ernst Friedrich Sieveking. schichte im wilhelminischen Kaiser- Erster Präsident des Hanseatischen reich. Oberlandesgerichts Band 8 Franz Bach. Architekt und Unternehmer Franz Bach Franz Bach: Architekt und Unternehmer Architekt Bach: Franz Architekt und Unternehmer HWS_Bach_25.1.2011_END_korr.qxd 25.01.2011 23:43 Uhr Seite 1 Franz Bach Architekt und Unternehmer von Carmen Krause HWS_Bach_25.1.2011_END_korr.qxd 25.01.2011 23:43 Uhr Seite 2 Mäzene für Wissenschaft hg. -

Ir:" ::;L;I;;;;Liriri:I:L;; R I Z I H
;ii:!i'' ;r'r'":::"':'ir:" ::;l;i;;;;liriri:i:l;; r i z i H Wissenschafrliche Einrichtung an der Universfrät Hamburg geim Schlump 83 20144 Hamburs Nutzungsbedingungen der retrodigitalisierten Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg Die retrodigitalisierten Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Zeitgeschich- te in Hamburg (FZH) werden zur nichtkommerziellen Nutzung gebührenfrei an- geboten. Die digitalen Medien srnd im lnternet frei zugänglich und können für persönliche und wissenschaftliche Zwecke heruntergeladen und verwendet wer- den. Jede Form der kommerziellen Verwendung (einschließlich elektronischer For- men) bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der FZH, vorbehaltlich des Rechtes, die Nutzung im Einzelfall zu untersagen. Dies gilt insbesondere für die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken. Die Verwendung zusammenhängender Teilbestände der retrodigitalisierten Ver- öffentlichungen auf nichtkommerziellen Webseiten bedarf gesonderter Zustim- mung der FZH. Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall die Nutzung auf Webseiten und in Publikationen zu untersagen- Es ist nicht gestattet, Texte, Bilder, Metadaten und andere lnformationen aus den retrodigitalisierten Veröffentlichungen zu ändern, an Dritte zu lizenzieren oder zu verkaufen. Mit dem Herunterladen von Texten und Daten erkennen Sie diese Nutzungs- bedingungen an. Dies schließt die Benutzerhaftung für die Einhaltung dieser Bedingungen beziehungsweise bei missbräuchlicher Verwendung jedweder Art ein. Kontakt: Forschungsstelle für Zeitgeschichte -

Die Begründer Der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung Wissenschaftlichen Begründer Der Hamburgischen Die Wissenschaftlichen Stiftung Einbettet
„Für Zucker ist er zu dumm, der kann studieren!“, so wird die Äußerung der Seniorin eines Hamburger Handels- hauses kolportiert. Offensichtlich brach- te ein solches Umfeld der Wissenschaft nicht gerade besondere Wertschätzung entgegen. Dennoch gelang es Senator Dr. Werner von Melle, zusammen mit dem Bankier Max Moritz Warburg, bei vielen vorausschauenden Donatoren eine Summe von knapp vier Millionen Mark einzusammeln, so dass am 12. April 1907 die HAMBURGISCHE WIS- SENSCHAFTLICHE STIFTUNG ge- gründet werden konnte. Dies war ein entscheidender Schritt hin zu einer Hamburger Universität, deren Grün- dung dann 1919 vollzogen wurde. Da- mit war sie die erste demokratische Universitätsgründung in der deutschen Geschichte. Der vorliegende Band würdigt erstmals alle Persönlichkeiten, die sich in der Gründungsphase der Stiftung um de- ren finanzielle Ausstattung und ihr Funktionieren verdient gemacht ha- ben. Viele von ihnen sind weit über Hamburg hinaus bekannt geworden, andere jedoch vollständig in Vergessen- heit geraten. Sie gehörten größtenteils zur Hamburg wirtschaftlich, politisch und sozial prägenden Bürgerschicht. Dennoch wird deutlich, dass sich in ih- ren Biographien höchst unterschiedli- che Charaktere und Schicksale zeigen. Eingeleitet wird der Band durch den Essay „Aktuelle Vergangenheit“, der die Stiftungsgründer in den kulturellen Die Begründer der Hamburgischen und wissenschaftspolitischen Kontext Hamburgs um die Jahrhundertwende Die Begründer der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung Wissenschaftlichen Begründer der Hamburgischen Die Wissenschaftlichen Stiftung einbettet. Die Begründer der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung von Johannes Gerhardt Mäzene für Wissenschaft hg. von Ekkehard Nümann Gefördert von Mathias Bach Den Familien gewidmet, die durch ihre hochherzigen Stiftungen vor 108 Jahren die Gründung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stif- tung ermöglicht und den Grundstein dafür gelegt haben, dass die Stiftung auch heute noch Forschung, Lehre und Bildung fördern kann. -
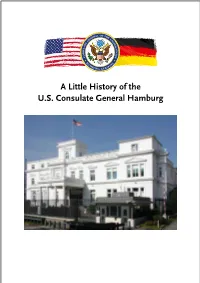
A Little History of the U.S. Consulate General Hamburg Imprint
E UUNNIITTEEDD H SS T TT F AA O TT O EE S LL SS A A R R E E N Y N N E Y Y E N E G G N N G A E A E E M T T T M A A R A L L ER L U U U E S S G S N N , N G O O O , C C G, C CIRGH E UUNNIITTEEDD NPBZIU H SS H LMAEUMI T TT F AA O TT O EE S LL SS A A R R E E N Y N N E Y Y E N E G G N N G A E A E E M T T T M A A R A L L ER L U U U E S S G S N N , N G O O O , C C G, C RGH ZIUCI H LMAEUMINPB A Little History of the U.S. Consulate General Hamburg Imprint Publisher: U.S. Consulate General Hamburg Public Affairs Alsterufer 27/28 20354 Hamburg, Germany Editor: Dr. Heiko Herold Copyright 2019 U.S. Consulate General Hamburg Photo credits: Title page, page 4, 6, 8, 14: Dr. Heiko Herold, U.S. Department of State; page 10 top: U.S. Department of State; page 5: Staatsarchiv Hamburg, 111-1 / CLVII Lit. Jb Nr. 20 Vol. 18 page 7: Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv, Sammlung Commerzbibliothek, S/749; page 9: Staatsarchiv Hamburg, 141-21=7/231, 141-21=7/24, 141-21=7/245; page 10 bottom: Willi Beutler, Denkmalschutzamt Hamburg Bildarchiv, Nr. -
Universität. Hamburg, Werner Von Melle Und Ein Jahrhundert
Stadt – Mann – Universität Hamburg, Werner von Melle und ein Jahrhundert-Lebenswerk Teil 1: Der Mann und die Stadt von Myriam Isabell Richter Mäzene für Wissenschaft hg. von Ekkehard Nümann Gefördert von der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung und von der Hermann Reemtsma Stiftung Den Familien gewidmet, die durch ihre hochherzigen Stiftungen vor 109 Jahren die Gründung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung ermöglicht und den Grundstein dafür gelegt haben, dass die Stiftung auch heute noch Forschung, Lehre und Bildung fördern kann. Inhalt Vorwort des Herausgebers . S. 3 1. Quellenlage . S. 4 2. Der Familien- und Firmengründer Georg Friedrich Vorwerk . S. 6 3. Zur Kindheit und Jugend der Vorwerk-Brüder . S. 15 4. Eine Reise von Augustus Friedrich nach Nordamerika und Kuba . S. 23 5. Die Firmen in Chile und Hamburg . S. 28 6. Friedrich, Adolph und deren Ehefrauen in den Erinnerungen dreier Enkel . S. 44 7. „Villa Josepha“ und „Haupthaus“ . S. 54 8. Gustav Adolph als Bau- und Gartengestalter . S. 60 9. Entwicklungen nach dem Tod der Brüder . S. 67 10. Anhänge . S. 70 11. Literatur . S. 72 12. Namensregister . S. 74 Alte Treue bewahr’t, doch ehret nicht Alles, was alt ist, […] Königlich nenn’ ich den Kaufmann, der nicht mit klingendem Gold nur, Der durch Leben und Geist Schönes befördert und schützt. Heinrich Geffcken1 Und doch – was würde aus all unserm Bemühen, die Geschichte der Menschheit zu erfassen, kämen uns nicht als „Leitmuscheln“ ihres Entwicklungsganges die Monumente zu Hilfe? Ein jedes Denkmal, ob es äußerliche Schicksale erfährt oder nicht, ist ein Meilenzeiger der Geschichte, das kleinste selbst eine Fackel, die ein Stück Weges erhellt. -
Die Hamburger Speicherstadt
Stadtentwicklung zur Moderne Die entstehung großstädtischer Hafen- und Bürohausquartiere Urban Development towards Modernism the Birth of the Metropolitan Harbour and Commercial Districts Stadtentwicklung zur Moderne / Urban Development towards Modernism towards Stadtentwicklung zur Development Moderne / Urban IV s L tee omi nalk io at n en sch t U De S e D Hefte · ICOMOS · Hefte DeS DeUtschen nationalkomitees lIV ICOMOS · JournalS Of tHe GerMan national Committee lIV ICOMOS ICOMOS · CahierS du Comité national alleManD lIV Stadtentwicklung zur Moderne – Die Entstehung großstädtischer Hafen- und Bürohausquartiere Urban Development towards Modernism – The Birth of the Metropolitan Harbour and Commercial Districts INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENtos Y SITIOS мЕждународный совЕт по вопросам памятников и достопримЕчатЕльных мЕст Frank Pieter Hesse (Hrsg.) Stadtentwicklung zur Moderne Die Entstehung großstädtischer Hafen- und Bürohausquartiere Urban Development towards Modernism The Birth of the Metropolitan Harbour and Commercial Districts Internationale Fachtagung, veranstaltet von ICOMOS Deutschland und der Kulturbehörde Hamburg / Denkmalschutzamt in Zusammenarbeit mit der HafenCity Universität Hamburg und der Sutor-Stiftung International Conference organized by ICOMOS Germany and the Hamburg Ministry of Culture / Department for Heritage Preservation in Cooperation with the HafenCity University and the Sutor Foundation Hamburg, 13. /14. Oktober -

Ihr Bdj-Newsletter
AUSGABE 29 • SOMMER 2019 Herausgegeben durch BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG No1 – IHR BDJ-NEWSLETTER Auf der richtigen 02 Wir lassen Sie nicht 03 Projektdeckung 06 Neues aus der 08 Spur im Regen stehen statt Puzzlespiel BDJ-Welt Innovation ermöglicht technische Risikoabsicherung gegen Schäden Großbauprojekte und Schlusswort / Ratings Überwachung von Lokomotiven durch Starkregen Highlights der BDJ-Projektdeckung Impressum Umzug nach 116 Jahren Großes Theater für BDJ Der Laeiszhof in der Hamburger Altstadt fördernden Räumlichkeiten, hat uns mit seiner beeindruckenden Kon- veraltete Konferenztechnik torhaus-Architektur stets das Gefühl von taten ihr Übriges – es muss- Heimat vermittelt und er war ein Syno- te etwas geschehen. nym für die langjährige Unternehmenstra- dition von BDJ. Daher stellt sich natürlich Der Schritt war mutig, zeit- die Frage, warum musste man da raus? Ein lich aufwändig und teuer. Umzug ist ein Aufbruch und die Chance Der Umzug von mehr als 80 einer Neugestaltung. BDJ hat sie genutzt. Mitarbeitern am Standort Hamburg zum 1. Juli 2018 lief Warum müssen wir da raus? Diese Frage jedoch wie am Schnürchen. haben wir uns nach über 110 Jahren am bisherigen Standort an der Trostbrücke Die Zentrale von BDJ findet auch gestellt, als wir vor einigen Jahren sich nun in einer noch begannen, uns mit Umzugsgedanken zu besseren Lage, mitten beschäftigen. Nun sind wir vier Jahre wei- in der Neustadt, ter, haben uns nach Abwägen zwischen ruhig an den Co- verschiedenen Standorten aus vollem Her- lonnaden, nahe zen für das neue Büro entschieden, sind der Binnen- umgezogen, haben uns eingerichtet und alster und dem schlagen erste Wurzeln. Jungfernstieg Wir verfügen über einen neuen, großzügigen Konferenz- gelegen. -

Hermann Franz Matthias Mutzenbecher. Ein Hamburger
Hermann Franz Matthias Mutzenbecher Ein Hamburger Versicherungsunternehmer Hermann Franz Matthias Mutzenbecher Ein Hamburger Versicherungsunternehmer von Hans Joachim Schröder Mäzene für Wissenschaft hg. von Ekkehard Nümann Gefördert von Frau Monika Hanke Den Familien gewidmet, die durch ihre hochherzigen Stiftungen vor 100 Jahren die Gründung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung ermöglicht und den Grundstein dafür gelegt haben, dass die Stiftung auch heute noch Forschung, Lehre und Bildung fördern kann. Inhalt Vorwort des Herausgebers . S. 3 1. Voraussetzungen . S. 4 2. Vorfahren . S. 6 3. Geburt, Kindheit, Jugendzeit . S. 9 4. Erste Berufsjahre, Heirat . S. 18 5. Aus dem „großen“ Tagebuch . S. 23 6. Der Mutzenbecher-Konzern . S. 32 7. Das Europahaus . S. 42 8. Franz Matthias Muthenbecher . S. 47 9. Die letzten Lebensjahre von H. F.M. Mutzenbecher . S. 53 10. Anhänge . S. 59 11. Literatur . S. 62 Vorwort des Herausgebers Im Jahr 2007 feierte die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung ihr 100- jähriges Jubiläum. Der vorliegende Band ist Teil der zu diesem Anlass ins Leben gerufenen Schriftenreihe „Mäzene für Wissenschaft“. In ihr wird die Geschichte der Stiftung dargestellt; außerdem werden Stifterpersönlich- keiten und Kuratoriumsmitglieder in Einzelbänden gewürdigt. Die Absicht, diese Reihe ins Leben zu rufen, entspricht dem dankbaren Gefühl den Personen gegenüber, die vor mehr als 100 Jahren den Mut hatten, die Stiftung zur Förderung der Wissenschaften in Hamburg zu gründen und erreichten, dass Hamburg eine Universität erhielt. -

Die Hungerunruhen in Hamburg Im Juni 1919 – Eine Zweite Revolution?
Uwe Schulte-Varendorff Die Hungerunruhen in Hamburg im Juni 1919 – eine zweite Revolution? Verein für Hamburgische Geschichte Beiträge zur Geschichte Hamburgs | Band 65 Hamburg University Press Die Hungerunruhen in Hamburg im Juni 1919 – eine zweite Revolution? Beiträge zur Geschichte Hamburgs Herausgegeben vom Verein für Hamburgische Geschichte Band 65 Uwe Schulte-Varendorff Die Hungerunruhen in Hamburg im Juni 1919 – eine zweite Revolution? Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky Impressum Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Die Online-Version dieser Publikation ist auf den Verlagswebseiten frei verfügbar (open access). Die Deutsche Nationalbibliothek hat die Netzpublikation archiviert. Diese ist dauerhaft auf dem Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek verfügbar. Open access über die folgenden Webseiten: Hamburg University Press – http://hup.sub.uni-hamburg.de/purl/HamburgUP_BGH65_Schulte-Varendorff Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek – http://deposit.d-nb.de ISBN 978-3-937816-63-0 (Printausgabe) ISSN 0175-4831 (Printausgabe) © 2010 Hamburg University Press, Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Deutschland Gestaltung des Covers: Benjamin Guzinski, Hamburg Abbildungen auf dem Cover: Vorn: Nach Beendigung der Beschießung des Rathauses versammeln sich Menschen auf dem Rathausplatz, um sich über die Lage zu informieren (Ende Juni 1919). Quelle: StAHH, Plankammer, 221-5 1918.21.1. Hinten: Volkswehrwache vor dem Gebäude des „Hamburger Echo“ (Januar 1919): Quelle: StAHH, Plankammer, 221-5 1918.9.1. Produktion: Elbe-Werkstätten GmbH, Hamburg, Deutschland http://www.ew-gmbh.de Inhalt Einleitung . 7 Die Vorgeschichte – die Hungerunruhen in Hamburg vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zum Juni 1919 . -

Edmund Siemers. Unternehmer Und Stifter
Edmund Siemers Unternehmer und Stifter von Johannes Gerhardt Mäzene für Wissenschaft hg. von Ekkehard Nümann Gefördert von der Edmund Siemers-Stiftung und der Familie Siemers Den Familien gewidmet, die durch ihre hochherzigen Stiftungen vor 107 Jahren die Gründung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung ermöglicht und den Grundstein dafür gelegt haben, dass die Stiftung auch heute noch Forschung, Lehre und Bildung fördern kann. Inhalt Vorwort des Herausgebers . S. 3 1. Quellenlage . S. 4 2. Der Familien- und Firmengründer Georg Friedrich Vorwerk . S. 6 3. Zur Kindheit und Jugend der Vorwerk-Brüder . S. 15 4. Eine Reise von Augustus Friedrich nach Nordamerika und Kuba . S. 23 5. Die Firmen in Chile und Hamburg . S. 28 6. Friedrich, Adolph und deren Ehefrauen in den Erinnerungen dreier Enkel . S. 44 7. „Villa Josepha“ und „Haupthaus“ . S. 54 8. Gustav Adolph als Bau- und Gartengestalter . S. 60 9. Entwicklungen nach dem Tod der Brüder . S. 67 10. Anhänge . S. 70 11. Literatur . S. 72 12. Namensregister . S. 74 Vorwort des Herausgebers . 4 Vorwort Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Fischer-Appelt . 5 1. Prolog . 8 2. Herkunft . 11 3. Der Privatmann . 23 Jugendjahre . 23 Heirat und Ehe . 28 Die vier Kinder . 36 4. Der Unternehmer . 42 Ein junger Feuerkopf im Petroleumgeschäft . 42 Die Firma G. J. H. Siemers & Co. unter der Ägide von Edmund Siemers 46 Die Transportrevolution und der Einstieg ins Reedereigeschäft . 48 Der Ausstieg aus dem Petroleumgeschäft à contrecœur . 52 Salpeter, das „weiße Gold“ – der Einstieg in eine boomende Branche . 56 Die Wiederaufnahme des Reedereigeschäfts . 60 Edmund Siemers und die Luftschiffe . 65 Edmund Siemers in der Kritik – Grundstücksgeschäfte in der Altstadt-Nord . -

Hamburg 1918.1919 Aufbruch in Die Demokratie IMPRESSUM
Hamburg 1918.1919 Aufbruch in die Demokratie IMPRESSUM: Herausgeberin: Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburger Straße 31 22083 Hamburg Text: Sönke Knopp, HafenCity Universität Hamburg Redaktion: Dr. Hans-Werner Fuchs Layout: atelier freilinger & feldmann Druck: Grafischer Betrieb Eilbek GmbH, Hamburg © Hamburg 2018; alle Rechte vorbehalten Das Themenjahr ist ein Projekt der Freien und Hansestadt Hamburg in Kooperation mit der Stiftung Historische Museen Hamburg. Veranstaltungen, Abbildungen, Bildnachweise und weitere Informationen finden Sie auf der Website zum Themenjahr. © 2018 Stiftung Historische Museen Hamburg, Corporate Design by atelier freilinger & feldmann, Website by Make Studio Bildnachweis: Umschlag: Demonstration auf dem Hamburger Heiligengeistfeld am 24.11.1918 © Staatsarchiv Hamburg, S. 4: © Freie und Hansestadt Hamburg – Behörde für Schule und Berufsbildung (Foto: Michael Zapf), S. 7: Erste Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft am 24.3.1919: © Staatsarchiv Hamburg, S. 9: Freiwillige zur Unterstützung der Bremer Räterepublik sammeln sich vor dem Hamburger Rathaus, Februar 1919: © Staatsarchiv Hamburg, S. 12: Demonstration von Seeleuten und Hafenarbeitern vor dem Hamburger Rathaus, Dez. 1918: © Staatsarchiv Hamburg, S. 15: Dr. Heinrich Laufenberg und Wilhelm Heise, Vorsitzende des Arbeiter- und Soldatenrates: © Staatsarchiv Hamburg, S. 19: Laufenberg spricht vor demonstrierenden Arbeitslosen, 27.12.1918: © Staatsarchiv Hamburg, S. 23: Protestkundge- bung gegen den Generalstreik, 1919: © Staatsarchiv Hamburg, S. 24: Dr. jur. Carl Wilhelm Petersen (1868-1933): Fotografie, bereitgestellt von Claudia G. Petersen, S. 24: Demonstration vor dem Hamburger Rathaus: © Staatsarchiv Hamburg, S. 25: Torpedoboot an den Landungsbrücken, November 1918: © Staatsarchiv Ham- burg, S. 25: Demonstration in Hamburg. Zeichnung von Hans Leip, 1918, Fotografie: © SHMH, S. 25: Nachrichten- und Presseabteilung des Arbeiter- und Soldaten- rates, Nov. 1918: © Staatsarchiv Hamburg, S. -

Hamburg in Der NS-Zeit
.:- .:::::::::::::::::::-:::::::::!1:!::::!: I Forsch u ngsstel le .:::t.:::::::::l'::::::::-. I {ür Zeitgeschichte in Hamburg Wissenschaft Iiche Einrichtung an der Universität Hamburg Beim Schlump 83 20144 Hamburg N utzu n gsbed i ng u n gen der retrod ig italis ierten Veröffentlic h u n gen der Forschungsstelle für Zeitgeschlchte in Hamburg Die retrodigitalisierten Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Zeitgeschich- te in Hamburg (FZH) werden zur nichtkommerziellen Nutzung gebührenfrei an- geboten. Die digiialen Medien sind im lnternet frei zugänglich und können für persönliche und wissenschaftliche Zwecke heruntergeladen und verwendet wer- den. Jede Form der kommerziellen Verwendung (einschließlich elektronischer For- men) bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der FZH, vorbehaltlich des Rechtes, die Nutzung im Einzelfall zu untersagen. Dies gilt insbesondere für die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken. Die Verwendung zusammenhängender Teilbestände der retrodigitalisierten Ver- öffentlichungen auf nichtkommerziellen Webseiten bedarf gesonderter Zustim- mung der FZH. Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall die Nutzung auf Webseiten und in Publikationen zu untersagen. Es ist nicht gestattet, Texte, Bilder, Metadaten und andere lnformationen aus den retrodigitalisierten Veröffentlichungen zu ändern, an Dritte zu lizenzieren oder zu verkaufen. Mit dem Herunterladen von Texten und Daten erkennen Sie diese Nutzungs- bedingungen an. Dies schließt die Benutzerhaftung für die Einhaltung dieser Bedingungen beziehungsweise