Franz Bach. Architekt Und Unternehmer Franz Bach
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
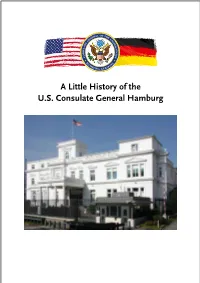
A Little History of the U.S. Consulate General Hamburg Imprint
E UUNNIITTEEDD H SS T TT F AA O TT O EE S LL SS A A R R E E N Y N N E Y Y E N E G G N N G A E A E E M T T T M A A R A L L ER L U U U E S S G S N N , N G O O O , C C G, C CIRGH E UUNNIITTEEDD NPBZIU H SS H LMAEUMI T TT F AA O TT O EE S LL SS A A R R E E N Y N N E Y Y E N E G G N N G A E A E E M T T T M A A R A L L ER L U U U E S S G S N N , N G O O O , C C G, C RGH ZIUCI H LMAEUMINPB A Little History of the U.S. Consulate General Hamburg Imprint Publisher: U.S. Consulate General Hamburg Public Affairs Alsterufer 27/28 20354 Hamburg, Germany Editor: Dr. Heiko Herold Copyright 2019 U.S. Consulate General Hamburg Photo credits: Title page, page 4, 6, 8, 14: Dr. Heiko Herold, U.S. Department of State; page 10 top: U.S. Department of State; page 5: Staatsarchiv Hamburg, 111-1 / CLVII Lit. Jb Nr. 20 Vol. 18 page 7: Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv, Sammlung Commerzbibliothek, S/749; page 9: Staatsarchiv Hamburg, 141-21=7/231, 141-21=7/24, 141-21=7/245; page 10 bottom: Willi Beutler, Denkmalschutzamt Hamburg Bildarchiv, Nr. -
Die Hamburger Speicherstadt
Stadtentwicklung zur Moderne Die entstehung großstädtischer Hafen- und Bürohausquartiere Urban Development towards Modernism the Birth of the Metropolitan Harbour and Commercial Districts Stadtentwicklung zur Moderne / Urban Development towards Modernism towards Stadtentwicklung zur Development Moderne / Urban IV s L tee omi nalk io at n en sch t U De S e D Hefte · ICOMOS · Hefte DeS DeUtschen nationalkomitees lIV ICOMOS · JournalS Of tHe GerMan national Committee lIV ICOMOS ICOMOS · CahierS du Comité national alleManD lIV Stadtentwicklung zur Moderne – Die Entstehung großstädtischer Hafen- und Bürohausquartiere Urban Development towards Modernism – The Birth of the Metropolitan Harbour and Commercial Districts INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENtos Y SITIOS мЕждународный совЕт по вопросам памятников и достопримЕчатЕльных мЕст Frank Pieter Hesse (Hrsg.) Stadtentwicklung zur Moderne Die Entstehung großstädtischer Hafen- und Bürohausquartiere Urban Development towards Modernism The Birth of the Metropolitan Harbour and Commercial Districts Internationale Fachtagung, veranstaltet von ICOMOS Deutschland und der Kulturbehörde Hamburg / Denkmalschutzamt in Zusammenarbeit mit der HafenCity Universität Hamburg und der Sutor-Stiftung International Conference organized by ICOMOS Germany and the Hamburg Ministry of Culture / Department for Heritage Preservation in Cooperation with the HafenCity University and the Sutor Foundation Hamburg, 13. /14. Oktober -

Ihr Bdj-Newsletter
AUSGABE 29 • SOMMER 2019 Herausgegeben durch BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG No1 – IHR BDJ-NEWSLETTER Auf der richtigen 02 Wir lassen Sie nicht 03 Projektdeckung 06 Neues aus der 08 Spur im Regen stehen statt Puzzlespiel BDJ-Welt Innovation ermöglicht technische Risikoabsicherung gegen Schäden Großbauprojekte und Schlusswort / Ratings Überwachung von Lokomotiven durch Starkregen Highlights der BDJ-Projektdeckung Impressum Umzug nach 116 Jahren Großes Theater für BDJ Der Laeiszhof in der Hamburger Altstadt fördernden Räumlichkeiten, hat uns mit seiner beeindruckenden Kon- veraltete Konferenztechnik torhaus-Architektur stets das Gefühl von taten ihr Übriges – es muss- Heimat vermittelt und er war ein Syno- te etwas geschehen. nym für die langjährige Unternehmenstra- dition von BDJ. Daher stellt sich natürlich Der Schritt war mutig, zeit- die Frage, warum musste man da raus? Ein lich aufwändig und teuer. Umzug ist ein Aufbruch und die Chance Der Umzug von mehr als 80 einer Neugestaltung. BDJ hat sie genutzt. Mitarbeitern am Standort Hamburg zum 1. Juli 2018 lief Warum müssen wir da raus? Diese Frage jedoch wie am Schnürchen. haben wir uns nach über 110 Jahren am bisherigen Standort an der Trostbrücke Die Zentrale von BDJ findet auch gestellt, als wir vor einigen Jahren sich nun in einer noch begannen, uns mit Umzugsgedanken zu besseren Lage, mitten beschäftigen. Nun sind wir vier Jahre wei- in der Neustadt, ter, haben uns nach Abwägen zwischen ruhig an den Co- verschiedenen Standorten aus vollem Her- lonnaden, nahe zen für das neue Büro entschieden, sind der Binnen- umgezogen, haben uns eingerichtet und alster und dem schlagen erste Wurzeln. Jungfernstieg Wir verfügen über einen neuen, großzügigen Konferenz- gelegen. -

Sophie Christine Und Carl Heinrich Laeisz. Eine Biographische Annäherung an Die Zeiten Und Themen Ihres Lebens
Durch die Rückbenennung der Mu- sikhalle Hamburg in Laeiszhalle im Januar 2005 ist in der Hansestadt ein Name, mit dessen Aussprache so mancher seine Probleme hat, wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. Die vorliegende Biographie über Sophie Christine und Carl Heinrich Laeisz zeichnet das faszinierende Leben die- ses Reeder-Ehepaares nach, die sich als Mäzene nicht nur bei der Stiftung des immer noch wichtigsten Kon- zerthauses in Hamburg hervorgetan haben, sondern die auch zu den Do- natoren der HAMBURGISCHEN WISSENSCHAFTLICHEN STIF- TUNG gehören. In ihrem Leben spiegeln sich in nuce zentrale Tendenzen hamburgischer Geschichte des 19. Jahrhunderts wi- der: bürgerliches Engagement sowie Einordnung der Hansestadt in die Weltwirtschaft. Die Biographie wird ohne die aus älteren Firmengeschich- Sophie Christine und ten notorische Heroisierung erzählt. Im Vordergrund steht vielmehr das Carl Heinrich Laeisz Interesse am „duldenden, strebenden und handelnden Menschen“ (Jacob Burckhardt). Eine biographische Annäherung Sophie Christine und Carl Heinrich Laeisz: Eine biographische Annäherung an die Zeiten und Themen ihres Lebens Themen ihres und an die Zeiten Annäherung biographische Laeisz: Eine Heinrich Sophie Christine und Carl an die Zeiten und Themen ihres Lebens Sophie Christine und Carl Heinrich Laeisz Eine biographische Annäherung an die Zeiten und Themen ihres Lebens von Johannes Gerhardt Mäzene für Wissenschaft hg. von Ekkehard Nümann Gefördert von der Reederei F. Laeisz Den Familien gewidmet, die durch ihre hochherzigen Stiftungen vor 100 Jahren die Gründung der HAMBURGISCHE WISSENSCHAFT- LICHE STIFTUNG ermöglicht und den Grundstein dafür gelegt haben, dass die Stiftung auch heute noch Forschung, Lehre und Bildung fördern kann. Vorwort des Herausgebers Im Jahr 2007 feiert die HAMBURGISCHE WISSENSCHAFTLICHE STIFTUNG ihr 100-jähriges Jubiläum. -

Martin Haller Und Sein Wirken in Hamburg
Baukunst als Ausdruck politischer Gesinnung – Martin Haller und sein Wirken in Hamburg Dissertation Zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie der Universität Hamburg vorgelegt von Klaus Mühlfried aus Hamburg Hamburg 2005 1. Gutachter Prof. Dr. Hermann Hipp 2. Gutachter Prof. Dr. Volker Plagemann Tag des Vollzugs der Promotion 13. Juli 2005 Inhaltsverzeichnis A Einleitung: Das Material und die Art seiner Auswertung, S. 7-19 1 Martin Hallers Bedeutung für Hamburg, S. 7 2 Die Quellenlage, S. 11 3 Methodik und Zielsetzung, S. 15 B Der kultur- und sozialgeschichtliche Hintergrund von Martin Hallers Schaffen, S. 20-92 1 Die Problematik historistischen Bauens, S. 20 1.1 Das Urteil unserer Gegenwart, S. 20 1.2 Die Stellung des 19. Jahrhunderts zur eigenen Architektur, S. 29 2 Bürgertum und Bürgerlichkeit, S. 36 3 Hamburg – ein Sonderfall in der deutschen Geschichte? S. 40 3.1 Die ideologischen Grundlagen eines gängigen Selbstbildes, S. 40 3.2 Kommerzielles Denken als Wesensmerkmal hamburgischer Mentalität – Tatsachen, Ursachen, Urteile, S. 41 3.3 Selbstbewusstsein als Merkmal hamburgischer Mentalität, S.46 3.4 Besonderheiten des politischen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt, S. 53 3.5 Die Bedeutung des Militärischen für die Mentalität der Ham- burger, S. 60 3.6 Zeremonialität und Understatement in der Hamburger Ober- schicht, S. 64 3.7 Bürgerlicher Prunk, S. 69 1 3.8 Wissenschaft und Kunst, S. 75 3.9 Zusammenfassung, S. 91 C Hauptkomponenten des politischen Weltbildes Martin Hallers, S. 93-149 1 Martin Haller in der Gesellschaft seiner Vaterstadt: Bürgerlichkeit und vaterstädtischer Patriotismus, S. 93 2 Die verpflichtende Kraft des Nationalgefühls, S.