Wikipediakorrekturen 22
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Versuche Der Einflußnahme Der SED Auf Die Politischen Parteien Der Bundesrepublik Nach Dem Mauerbau
Jochen Staadt Versuche der Einflußnahme der SED auf die politischen Parteien der Bundesrepublik nach dem Mauerbau Expertisenauftrag Quellenlage Quellenbewertung Ziele der SED-Westpolitik gegenüber den Parteien des Bundestages Institutionen der SED-Westpolitik Fallbeispiele 1. Die Denunziations-Kampagne gegen Herbert Wehner 2. Versuche der Einflußnahme der SED auf Bundestagswahlen 3. Versuche innerparteiliche Differenzen auszunutzen Hinweise zu den vorgelegten Dokumenten des weiteren Expertisenauftrages Zusammenfassung Dokumentenanhang Expertisenauftrag Der Auftrag beinhaltete ursprünglich neben dieser Thematik noch zwei weitere allgemeine Fragestellungen: Die Infiltration in die Neue Linke in den 60er Jah- ren und Versuche der Einflußnahme auf westdeutsche Schriftsteller und Künst- ler. Die Expertise (Dokumentation) sollte auf der Grundlage von Archivbestän- den der ehemaligen DDR erstellt werden. Die zerklüftete Quellensituation zu den letztgenannten Themen und der archivalische Erschließungsstand bei der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdien- stes der ehemaligen DDR läßt jedoch eine zusammenhängende Darstellung dieser Themenkomplexe noch nicht zu. Es werden deshalb am Ende dieser Untersuchung lediglich Einzelaspekte hierzu berührt und durch Dokumente unterschiedlicher Provenienz beleuchtet. Die vorliegende Expertise entstand mit nachhaltiger und geduldiger Unterstützung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv und der Behörde -

531 Günter Wirth
ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 01 – 531 GÜNTER WIRTH SANKT AUGUSTIN 2019 I Inhaltsverzeichnis 1 Reden, Artikel, Manuskripte 1 1.1 Veröffentlichungen zu Potsdam 7 1.2 Fremdmanuskripte 9 2 Korrespondenz 10 3 CDU der DDR 20 4 Zentrumspartei 23 5 sonstige Parteien 24 6 Berlin 25 6.1 Stadtverordnetenversammlung 25 6.1.1 Ständige Kommission Kultur 25 7 Kulturbund 27 7.1 Bundeskongresse 27 7.2 Präsidiumssitzungen 27 7.3 Präsidialratssitzungen 28 7.4 Gliederungen und Sekretariate 28 7.5 Club der Kulturschaffenden "Johannes R. Becher" 28 7.6 Varia 29 8 sonstige Organisationen und Vereinigungen 30 8.1 Friedensrat der DDR 30 9 Kirche und Religion 32 9.1 Kirchengeschichte 32 9.1.1 Reformation 32 9.2 Kirchenpolitik 33 9.3 Evangelische Kirche 34 9.3.1 Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR 35 9.3.1.1 Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg 36 9.3.1.2 sonstige Mitgliedskirchen 36 9.3.2 Bund Evangelischer Pfarrer in der DDR 36 9.3.3 EKD 37 9.3.4 Kirchentage 37 9.3.5 Evangelische Kirche im Ausland 37 9.3.6 Lutherischer Weltbund 38 9.4 Katholizismus 38 9.4.1 Berliner Konferenz Europäischer Katholiken 39 9.5 Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) 39 9.6 Ökumene 39 9.6.1 Ökumenischer Rat der Kirchen 39 9.6.1.1 Vollversammlungen 39 9.6.1.2 Zentralauschuss 40 9.7 Christliche Literatur 40 9.8 Judentum 40 9.9 Varia 41 10 Christliche Friedenskoferenz (CFK) 43 10.1 Korrespondenz, Vermerke, Berichte 43 II Inhaltsverzeichnis 10.2 International 44 10.3 Allchristliche Friedensversammlung (ACFV) 45 10.4 Ausschuss zur Fortsetzung -

Stefan Appelius Als Pazifistin in Bonn: Alma Kettigs Weg in Der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion
Stefan Appelius Als Pazifistin in Bonn: Alma Kettigs Weg in der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion 1. Die Kontroverse um die Wiederaufrüstung Theo Pirker beschreibt das politische Klima in der Bundesrepublik mit Blick auf den Bundestagswahlkampf im Jahre 1953 sehr zutreffend mit der Feststellung, der Antikommunismus habe in der breiten Masse der Bevöl- kerung Westdeutschlands in jenen Jahren die Position des Antisemitismus eingenommen, in Form eines tiefen, weltanschaulich verhärteten und durch Propaganda stets aufs neue aktualisierbaren Vorurteils.1 Der Wahltag am 6. September 1953 brachte der SPD mit lediglich 28,8 % der Stimmen eine vernichtende Niederlage ein und der jungen Wittener Sozialdemokratin Alma Kettig den Einzug in den Bundestag. Alma Kettig hatte nur widerwillig und rein formal auf einem hinteren Platz der nord- rheinwestfälischen SPD-Landesliste kandidiert. Durch den Verlust sicher geglaubter Direktmandate "zog" die SPD-Landesliste in NRW erheblich besser als zunächst berechnet und bescherte so in den frühen Morgen- stunden des 7. September 1953 einer völlig überraschten Frau die Nach- richt, ihre parlamentarische Laufbahn habe soeben begonnen: "In Witten gab es fast einen kleinen Aufstand. Viele hatten ja gar nicht mitbekommen, daß ich kandidierte. Ich hatte gerade ein kleines Appartement gemietet, meine erste eigene Wohnung! Dafür hatte ich lange gespart. 20 Jahre lang hatte ich möbliert gewohnt. Als ich gerade Fenster putzte, wurde ich ans Telefon gerufen. 'Sitzt du oder stehst du?' fragten mich die Genossen aus dem Bezirksbüro. 'Wir möchten dir gratulieren'. Ich dachte, sie gratulieren mir zur Wohnung. 'Nein', sagten sie, 'zu ganz etwas anderem; du bist Bundestagsabgeordnete!' Ich konnte das zunächst gar nicht glauben. 'Allmächtiger Strohsack', dachte ich, 'was denn nun?'"2 1 Theo Pirker, 1965, S.181. -

UID Jg. 15 1961 Nr. 15, Union in Deutschland
2 6796 G BONN • 13. APR I L 1 961 NR.15 . 15. JAHRGANG UNIONirtJ^^utschlaripL INFORMATIONSDIENST der Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozialen Union Wohnraum für alle Zukunftsaufgabe der nächsten Jahre: Vom Wohnungsbau zum Städtebau -«.Obgleich die außerordentlichen Erfolge der Wohnungsbaupolitik der Bun- jähriger Wohnungsbaupolitik nichts Bes- desregierung für sich selbst sprechen, versucht die SPD mit allen Mitteln diese seres wisse, als die Wohnungsnot der Leistungen herabzuwürdigen. Einen Höhepunkt der unsachlichen Angriffe breiten Volksschichten zu verniedlichen. brachte die Bundestagsdebatte zum Haushalt des Wohnungsbauministeriums Warum haben Sie nicht die Frage an mich gerichtet, weshalb nicht noch mehr am 16. März 1961. Minister Lücke hielt der Opposition vor, in welch gefähr- Wohnungen gebaut werden? Sie haben liche Nachbarschaft sie sich mit ihrer Kritik begibt. doch seit Jahren behauptet, der Woh- nungsbau breche zusammen. Warum Die Rede des Bundeswohnungsbaumini- stelle — rechthaberischer Minister — Ver- haben Sie mir nicht gesagt, daß wir mit sters vor dem Parlament, in der für jeden niedlicher der echten Wohnungsnot, ver- den Baupreisen fertig werden müßten, augenfällig die Erfolge der Bundesregie- raten einen Stil, den Sie sicherlich in daß wir Bauarbeiter beschaffen müßten, rung im Wohnungsbau aufgezeigt wur- Ihrem privaten Beruf gebrauchen können, daß wir mit diesen Dingen fertig werden den, hat über den Tag der Debatte hinaus der aber dieses Hauses unwürdig ist. müßten? Wo sind die Fragen? Wo ist Bedeutung. Aus diesem Grund folgen Wie weit Sie gekommen sind, darf ich Ihre Bemerkung, daß ich mehr Wohnun- Ihnen vielleicht mit dem Verlesen einer gen des sozialen Wohnungsbaus bauen CDU/CSU-Bundestagsabgeordneter Rundfunkmeldung dartun: müßte? Das wären echte, das wären sach- Dr. -

1 44 10. April 1959: Fraktionssitzung
SPD – 03. WP Fraktionssitzung: 10. April. 1959 44 10. April 1959: Fraktionssitzung AdsD, SPD-BT-Fraktion 3. WP 88.1 Überschrift: »Kurzprotokoll der Fraktionssitzung der SPD am Donnerstag, den 10. 4. 1959«. Tagesordnung: Reiseberichte 1. Besuch der Genossen Erler, Paul, Mattick und Metzger in Belgrad und Prag; Be- richterstatter: Erler und Paul 2. Reise der Genossen Deist und Kurlbaum nach Südostasien; Berichterstatter: Heinrich Deist 3. Reise der Genossen Blachstein, Birkelbach, Bleiß und Ludwig nach Algerien; Be- richterstatter: Paul Bleiß 4. Reise des Genossen Harri Bading nach dem Irak; Berichterstatter: Harri Bading Vorsitz: Fritz Erler, anschließend Heinrich Deist Fritz Erler berichtet über die Reise nach Jugoslawien.2 Gespräche wurden geführt mit Kardelj, Vlachovicz, Popovicz, Bebler und Tito.3 Zum Thema Berlin vertraten die Gesprächspartner die Auffassung, daß eine Lösung in größeren Zusammenhängen (europäische Sicherheit, Disengagement) vorzuziehen sei, notfalls müsse aber eine isolierte Lösung, evtl. unter Einschaltung der UNO, ins Auge gefaßt werden. Eine andere Nuancierung war bei Tito selbst festzustellen, der eine isolierte Lösung weder für nützlich noch möglich hielt: sie würde nur Anlaß zu neuen Konflikten sein. Ein Disengagement wurde lebhaft begrüßt. Gesprochen wurde auch über eine evtl. Beteiligung Jugoslawiens an den Mächteverhandlungen, da es mindestens genauso be- troffen sei wie Polen und die ČSSR. Das Thema atomwaffenfreie Zone wurde von den Gesprächspartnern nicht von selbst aufgeworfen, man zeigte sich aber dieser Frage gegenüber sehr aufgeschlossen. Erler verglich im Gespräch in diesem Zusammenhang das Bedroht-Fühlen Jugoslawiens durch Albanien mit dem Bedroht-Fühlen Ulbrichts durch Westberlin. Tito warf u. a. bei Erörterung des Deutschlandplans die Frage auf, warum von uns freie Wahlen erst in der dritten Etappe verlangt würden. -
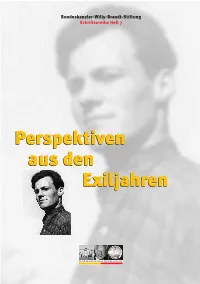
BWBS/Heft 7/Inhalt
Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Schriftenreihe Heft 7 PerspektivenPerspektiven aus den Exiljahren BUNDESKANZLER-WILLY-BRANDT-STIFTUNG HERAUSGEBER Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Der Vorstand Präsident a. D. Dr. Gerhard Groß (Vorsitzender) Prof. Dr. Dieter Dowe Prof. Dr. Gregor Schöllgen REDAKTION Dr. Wolfram Hoppenstedt, Dr. Bernd Rother, Carsten Tessmer © 2000 by Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung im Rathaus Schöneberg John-F.-Kennedy-Platz D-10825 Berlin Telefon 030/78 77 07-0 Telefax 030/78 77 07-50 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.willy-brandt.org GESTALTUNG Löning Werbeagentur, Berlin REALISATION UND DRUCK Wenng Druck Gmbh, Dinkelsbüh Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany 2000 ISSN 1434-6176 ISBN 3-933090-06-7 Einhart Lorenz (Hrsg.) P erspektiven aus den Exiljahren W issenschaftlicher Workshop in Zusammenarbeit mit dem Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin am 9. Februar 2000 Schriftenreihe der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Heft 7 í INHALT W illy Brandt – Stationen seines Lebens Seite 7 Gerhard Gross Grusswort des Vorstandsvorsitzenden der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung Seite 9 Einhart Lorenz Einführung Seite 13 Knut Kjeldstadli Die Norwegische Arbeiterbewegung in Willy Brandts Seite 19 norwegischen Jahren Einhart Lorenz Der junge Willy Brandt, die Judenverfolgung und die Frage einer jüdischen Heimstätte in Palästina Seite 33 Klaus Misgeld Willy Brandt und Schweden – Schweden und Willy Brandt Seite 49 4 Helga Grebing Entscheidung für die SPD – und was dann? Bemerkungen zu den politischen Aktivitäten der Linkssozialisten aus der SAP in den ersten Jahren „nach Hitler“ Seite 71 P eter Brandt Willy Brandt und die Jugendradikalisierung der späten sechziger Jahre – Anmerkungen eines Historikers und Zeitzeugen Seite 79 5 BPK „Ich scheue mich nicht, hier noch einmal zu sagen: Die Jahre in Norwegen und im übrigen Norden haben für mich viel bedeutet. -

Widerstand Und Internationale Solidarität. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation
Veröffentlichungen des Instituts für soziale Bewegungen Schriftenreihe A: Darstellungen Band 18 Redaktion dieses Bandes: Benjamin Ziemann Dieter Nelles Widerstand und internationale Solidarität Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Für Barbara und Toni Das Titelbild zeigt die Titelabbildung aus der illegalen ITF-Zeitung für deutsche Seeleute, Hafenarbeiter und Binnenschiffer, Nr. 12 (1937) (Archiv der sozialen Demokratie, Friedrich-Ebert-Stiftung) Die Drucklegung des vorliegenden Bandes wurde gefördert durch die Gewerkschaft ÖTV, Wupppertal-Niederberg, und ver.di, Fachgruppe Schiffahrt, sowie durch die Philosophisch-Politische Akademie e.V., Bonn Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Nelles, Dieter : Widerstand und internationale Solidarität : Die Internationale Transportarbeiter- Föderation (ITF) im Widerstand gegen den Nationalsozialismus / Dieter Nelles. 1. Aufl. – Essen : Klartext-Verl., 2001 (Veröffentlichungen des Instituts für soziale Bewegungen : Schriftenreihe A: Darstellungen ; Bd. 18) Zugl.: Universität / Gesamthochschule Kassel, Diss., 2000 ISBN 3-88474-956-0 1. Auflage, August 2001 Gesamtausstattung: Klartext Verlag, Essen © Klartext Verlag, Essen ISBN 3-88474-956-0 Alle Rechte vorbehalten Inhalt Vorwort . 7 I. Einleitung 1. Forschungsstand, Fragestellungen und Zielsetzung . 9 2. Konzeption und Aufbau der Untersuchung . 29 3. Quellen . 34 4. Begriffe . 35 II. Rahmenbedingungen und Milieu des Widerstands: Seeleute im Nationalsozialismus 1. Die deutsche Seeschiffahrt im Herrschaftssystem des „Dritten Reiches“ . 39 2. Arbeitsmarkt und Arbeitsvermittlung . 45 2.1. Arbeitsmarkt. 45 2.2. Seemännische Berufsgruppen . 49 2.3. Arbeitsvermittlung . 52 3. Arbeitsverfassung und Arbeitsbedingungen. 54 3.1. Arbeitsverfassung und Arbeitsbeziehungen . 54 3.2. Arbeits- und Lebensbedingungen der Seeleute im „Dritten Reich“ . 57 4. Soziale Zusammensetzung, Identität und Milieu der Seeleute . 62 5. Die nationalsozialistische Organisierung der Seeleute . 74 6. Formen der Opposition . -

Bericht Und Antrag Des 2
Deutscher Bundestag Drucksache 7/ 3246 7. Wahlperiode 19.02.75 Sachgebiet 12 Bericht und Antrag des 2. Untersuchungsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der CDU/CSU betr. Einsetzung eines Untersuchungsausschusses — Drucksache 7/2193 — A. Bericht der Abgeordneten Dr. Hirsch und Gerster (Mainz) Seite Erstes Kapitel Einsetzung des Ausschusses und Gang des Verfahrens A. Einsetzung des Ausschusses und dessen Auftrag 5 I. Einsetzungsbeschluß 5 II. Verfahrensregeln 5 III. Mitglieder des Untersuchungsausschusses 6 B. Vorgeschichte und Parallelverfahren 6 I. Vorgeschichte 6 II. Parallelverfahren 6 C. Ablauf des Untersuchungsverfahrens 7 I. Konstituierung, Berichterstatterbenennung 7 II. Beweisaufnahme 7 Drucksache 7/3246 Deutscher Bundestag — 7. Wahlperiode Zweites Kapitel Ergebnis der Untersuchung Seite 1. Abschnitt: Begründung zur allgemeinen Einstellungs- und Umsetzungs- praxis im Bundeskanzleramt und im Bundesministerium des Innern sowie in deren Geschäftsbereichen unter dem Gesichts- punkt der Sicherheitsüberprüfung und der fachlichen Qualifi- kation (Eins. Beschl. Nr. 1, 2 / 3. Bew. Beschl. Nr. 6 bis 8, 1 bis 4) Einstimmige Auffassung der Mitglieder des Ausschusses A. Sicherheitsüberprüfung 8 (Eins. Beschl. Nr. 1 a, 2) B. Fachliche Qualifikationserfordernisse 14 (Eins. Beschl. Nr. 1 b, 2) 2. Abschnitt: Begründung zu den Untersuchungsgegenständen „Guillaume" und „Aktenvernichtung im BND" (Auffassung der Mehrheit) — Abg. Dr. Hirsch, FDP — A. Vorbemerkung zur Vollständigkeit der Aktenvorlage 18 B. Der Untersuchungsgegenstand „Guillaume" 19 I. Die Einstellung Guillaumes in das Bundeskanzleramt unter dem Gesichtspunkt der fachlichen Qualifikation (Eins. Beschl. Nr. 1 b, 2/ 3. Bew. Beschl. Nr. 5) 19 1. Der berufliche Werdegang Guillaumes bis zu seiner Einstel- lung in das Bundeskanzleramt 19 2. Der Einstellungsvorgang im Bundeskanzleramt 19 II. Die Sicherheitsüberprüfung bei der Einstellung Guillaumes im Bundeskanzleramt (Eins. -

1 18. August 1961: Fraktionssitzung
FDP – 03. WP Fraktionssitzung: 18. 08. 1961 18. August 1961: Fraktionssitzung ADL, Bestand Wolfgang Mischnick, A40-739. Überschrift: »Kurzprotokoll über die Sitzung der Fraktion am 18. August 1961«. Zeit: 9.20–10.52 Uhr. Vorsitz: Mende. Anwe- sende Fraktionsmitglieder: keine Angaben. Sitzungsverlauf: A. Geschäftliche Mitteilungen. B. Vorbereitung der Aussprache über die Regierungserklärung von Bundeskanzler Ade- nauer über die Lage Berlins. [A.] TOP I: Geschäftliche Mitteilungen 1. Der Bundeskanzlererklärung, 11 Uhr im Plenum, folgt eine Erklärung des Regie- renden Bürgermeisters Brandt1. Darauf schließen sich die Erklärungen der drei Fraktionsvorsitzenden in der Reihenfolge Krone2, Ollenhauer3, Dr. Mende an. Schließlich geben Schneider4 (Bremerhaven) noch eine persönliche oder sachliche Erklärung für die Gesamtdeutsche Partei und Behrisch5 für die DFU6 ab. Die Erklä- rungen werden im Rundfunk und Fernsehen übertragen. Für die Kanzlererklärung sind 45 Minuten, für die Brandt-Rede ebenfalls 45 Minuten und für die Erklärungen der drei Fraktionsvorsitzenden je 15 Minuten vorgesehen. 2. Am Dienstag, den 22. August, findet eine Fraktions- und Bundestagssitzung statt. In Nürnberg findet am Sonntag eine Besprechung der Referenten zum Bundeswahl- kongreß statt. Es werden anwesend sein: Döring, Dr. Bucher, Mischnick, Frau Dr. 7 Kiep-Altenloh , Dr. Dehler, Dr. Starke u. a. 3. Die Wahlversammlungen sind wegen des steigenden Interesses der Bevölkerung überfüllt. So war das Interesse insbesondere in Hamburg, Wilhelmshaven, Iserlohn, Dortmund sehr groß. 4. Der FDP-Appell an Bundespräsident Lübke zur Vorverlegung der Bundestagswahl und der damit verbundenen Wahlkampfverkürzung wurde wegen der dadurch ge- gebenen Anfechtungsmöglichkeit abgelehnt. Statt dessen plädierte auch Lübke für einen fairen Wahlkampf. 5. Dr. Dehler und Frau Dr. Dr. h. c. Marie-Elisabeth Lüders sollten so viel wie möglich ihre Ämter in den Vordergrund stellen, um einen Ausgleich der Regierungsämter der anderen Parteien zu geben. -

Texte 71 Orthodoxien K
Texte Klaus Kinner (Hrsg.) Linke zwischen den Orthodoxien Von Havemann bis Dutschke Linke zwischen den Orthodoxien Linke 71 71 Rosa-Luxemburg-Stiftung Texte 71 Rosa-Luxemburg-Stiftung KLAUS KINNER (HRSG.) Linke zwischen den Orthodoxien Von Havemann bis Dutschke Karl Dietz Verlag Berlin Klaus Kinner (Hrsg.): Linke zwischen den Orthodoxien. Von Havemann bis Dutschke (Reihe: Texte / Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 71) Berlin: Karl Dietz Verlag 2011 ISBN 978-3-320-02267-9 © Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2011 Satz: Elke Jakubowski Umschlag: Heike Schmelter Druck und Verarbeitung: MediaService GmbH Druck und Kommunikation Printed in Germany Inhalt Einleitende Bemerkungen des Herausgebers 7 Kapitel I LOTHAR BISKY Wir haben die Entdeckungen noch vor uns 8 STEFAN BOLLINGER Geschichte, Programme und Politik Linkes Suchen, ewiges Hoffen und die Notwendigkeit, hier und heute Politik zu machen 15 JÜRGEN HOFMANN Bruch mit dem Stalinismus Rückblick auf eine notwendige Debatte 48 EDELBERT RICHTER Der linke Flügel der DDR-Bürgerbewegung 63 ANDREAS HEYER Robert Havemanns »Morgen« und der postmaterielle Utopiediskurs Zum Ausgleich von Ökologie, Marxismus und genossenschaftlichen Strukturen 70 ANDREAS HEYER Rudolf Bahros »Alternative« Ökologie, Demokratie und ein neuer Marxismus im Gewand der Utopie 93 Kapitel II HELGA GREBING Linkssozialisten – Entscheidung für die Sozialdemokratie 106 PHILIPP KUFFERATH Vom Parteinachwuchs der SPD zum Protagonisten der Neuen Linken Die Geschichte des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (1946–1968) 118 BJÖRN ALLMENDINGER -

Gertrud Meyer Eine Politische Biografie
Universität Flensburg Gertrud Meyer Eine politische Biografie Inauguraldissertation Zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie vorgelegt der Universität Flensburg von Gertrud Lenz aus Cochem Gutachter Prof. Dr. Uwe Danker Prof. Dr. Robert Bohn im Dezember 2010 Inhaltsübersicht A. Einleitung .............................................................................................................................. 7 I. Thematische und methodische Aspekte .............................................................................. 7 II. Quellenlage ...................................................................................................................... 19 III. Sekundärliteratur ............................................................................................................ 22 B. Hauptteil .............................................................................................................................. 27 IV. Kindheit im Lübecker Arbeitermilieu ............................................................................ 27 V. Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Lübeck ................................................... 39 VI. Exil in Norwegen ........................................................................................................... 83 VII. Assistentin des Mediziners und Psychoanalytikers Wilhelm Reich ........................... 212 VIII. Flüchtlingsarbeit und SAP-Arbeit in New York, Oslo und Stockholm .................... 240 IX. Kriegsende und Nachkriegszeit -

Dies Ist Die Überschriftsebene 1
Der Deutsche Bundestag 1949 bis 1989 in den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR Gutachten an den Deutschen Bundestag gemäß § 37 (3) des Stasi-Unterlagen-Gesetzes Berlin, im März 2013 Inhaltsübersicht Ausführliches Inhaltsverzeichnis 5 A. Einführung und Zusammenfassung 9 1. Auftrag und Vorgeschichte 9 2. Struktur und Ergebnisse des Gutachtens 10 3. Ausblick 15 B. Theoretische Einordnung: Die ideologiegeleitete Perspektive des MfS auf die Bundestagsparteien im Spiegel der Dissertationen, Diplom- und Abschlussarbeiten an der MfS-Hochschule 17 1. Einführung 17 2. Die besondere Situation der SPD 20 3. Parteiströmungen in der SPD aus Sicht der HV A 24 4. Umsetzung geheimdienstlicher Analysen in konkrete Maßnahmen gegen SPD und CDU 25 5. Fazit 28 C. Der Deutsche Bundestag und seine Mitglieder im Spiegel der MfS-Überlieferung. Eine Archivbegehung 30 1. SIRA: Der Deutsche Bundestag, seine Mitglieder und Gremien in der elektronischen Datenbank der MfS-Auslandsspionage 30 2. „Rosenholz“: Bundestagsabgeordnete in der zentralen Kartei der MfS- Auslandsspionage 162 3. „Aktive Maßnahmen“: Einflussnahme und Desinformation 265 4. Telefonüberwachung 281 5. Bundestagsabgeordnete und ihre Einreisen in die DDR 299 6. Die Rolle von Entführungen in die DDR und Haft-Erfahrungen von Abgeordneten in der DDR 311 7. Der Deutsche Bundestag im Blickfeld anderer östlicher Geheimdienste 315 D. Anhang 319 Spionageberichte über den Deutschen Bundestag: Die Informationen der HV A für die Partei- und Staatsführung 319 Literaturverzeichnis 372 Abkürzungsverzeichnis 381 Personenverzeichnis 386 Ausführliches Inhaltsverzeichnis A. Einführung und Zusammenfassung 9 1. Auftrag und Vorgeschichte 9 2. Struktur und Ergebnisse des Gutachtens 10 3. Ausblick 15 B. Theoretische Einordnung: Die ideologiegeleitete Perspektive des MfS auf die Bundestagsparteien im Spiegel der Dissertationen, Diplom- und Abschlussarbeiten an der MfS-Hochschule 17 1.