BWBS/Heft 7/Inhalt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Den Socialdemokratiska Memoaren Som Retorisk Genre: Exemplen Palm, Erlander Och Persson
”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Den socialdemokratiska memoaren som retorisk genre: exemplen Palm, Erlander och Persson “From Darkness We Rise Towards the Light” The Social Democratic Memoir as a Rhetoric Genre: the Examples of Palm, Erlander and Persson Magnus Gustafson Masteruppsats i litteraturvetenskap Termin: HT 2014/2015 Kurs: LV 2311 Nivå: Master Handledare: Christer Ekholm Abstract Master’s Thesis in Comparative Literature Title: ”From Darkness We Rise Towards the Light” The Social Democratic Memoir as a Rhetoric Genre: the Examples of Palm, Erlander and Persson Author: Magnus Gustafson Academic Term and Year: Autumn 2014/2015 Department: Literature, History of Ideas and Religion Supervisor: Christer Ekholm Examiner: Dag Hedman Keywords: Political Memoirs, Rhetorical Reading, August Palm, Tage Erlander, Göran Persson Although Social Democratic Memoirs comprise an extensive material, these texts have not attracted any systematic analysis as a distinct and yet varied form of textual genre. The focus in this MA-paper is the Swedish Social Democratic Memoir as a rhetoric genre. The main primary material is memoirs of the pioneer August Palm (1849–1922), the father of the nation Tage Erlander (1901–1985) and the political leader Göran Persson (1949–), published 1905, 1972–82 and 2007, respectively. The general aim is to find out what is the driving power of the memoirs and, more specifically, to shed light on the images of the party history and the history of the welfare state. The method is a comparative analysis of these texts. The overarching rhetoric of Social Democratic Memoirs relate to a general ideological theme corresponding to the progression from darkness to light. -
Gemeinsame Versammlung 389
9. 6. 54 AMTSBLATT — GEMEINSAME VERSAMMLUNG 389 GEMEINSAME VERSAMMLUNG ORDENTLICHE SITZUNGSPERIODE MAI 1954 PROTOKOLLE DER SITZUNGEN PROTOKOLL DER SITZUNG VOM DIENSTAG, 11. MAI 1954 VORSITZENDER: HERR SCHI AVI Togni, Debre, Bertrand, Caron, Mollet, De- Alterspräsident housse, Laffargue, Sassen und Müller. Eröffnung der ordentlichen Sitzungsperiode 1953/54 Die Sitzung wird um 11 Uhr unterbrochen. Die Sitzung wird um 10.50 Uhr eröffnet. Die Sitzung wird um 11.10 Uhr wieder er öffnet. Die ordentliche Sitzungsperiode 1953/54 wird für eröffnet erklärt. Prüfung der Mandate Es spricht der Alterspräsident. Als Berichterstatter nimmt das Wort Abg. Laffargue. Mandatsniederlegung Die Versammlung stimmt dem Prüfungs ergebnis des Ausschusses zu, wonach die Prüfung Die Versammlung nimmt die Mandatsnieder der folgenden 18 italienischen und 2 belgischen legung der Abgg. Spaak und Vermeylen zur Mitglieder keine Beanstandungen ergeben hat: Kenntnis. Ezio Amadeo, Antonio Boggiano Pico, Enrico Carboni, Antonio Carcaterra, Giuseppe Caron, Aleide De Gasperi, Nicolas Dethier, Amintore Prüfung der Mandate Fanfani, Henri Fayat, Alessandro Gerini, Teresio Guglielmone, Ugo La Malfa, Giovanni Malagodi, Folgende Abgg. werden durch Los zu Mit Giuseppe Pella, Stefano Perrier, Alessandro gliedern des Ausschusses zur Prüfung der Man Schiavi, Vincenzo Selvaggi, Alberto Simonini, date bestimmt: Attilio Terragni, Giuseppe Togni. 390 EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL 9. 6. 54 Wahl des Präsidiums Ausschuß für Fragen der Investitionen: Das Wort nimmt Abg. Struye. Pierre Billotte, P. A. Blaisse, Roger Car~ cassonne, Antonio Carcaterra, Heinrich Deist, Äbg. De Gasperi wird durch Akklamation Pierre De Smet, Nicolas Dethier, Jean Fohr- zum Präsidenten gewählt. mannj Teresio Guglielmöne, P. J. Kapteyn, Georges Laffargue, Nicolas Margue, Jean Ma- Präsident De Gasperi nimmt die Wahl an roger, Francöis de Menthon, Roger Motz, Giu und übernimmt den Vorsitz. -

The Godesberg Programme and Its Aftermath
Karim Fertikh The Godesberg Programme and its Aftermath A Socio-histoire of an Ideological Transformation in European Social De- mocracies Abstract: The Godesberg programme (1959) is considered a major shift in European social democratic ideology. This article explores its genesis and of- fers a history of both the written text and its subsequent uses. It does so by shedding light on the organizational constraints and the personal strategies of the players involved in the production of the text in the Social Democra- tic Party of Germany. The article considers the partisan milieu and its trans- formations after 1945 and in the aftermaths of 1968 as an important factor accounting for the making of the political myth of Bad Godesberg. To do so, it explores the historicity of the interpretations of the programme from the 1950s to the present day, and highlights the moments at which the meaning of Godesberg as a major shift in socialist history has become consolidated in Europe, focusing on the French Socialist Party. Keywords: Social Democracy, Godesberg Programme, socio-histoire, scienti- fication of politics, history of ideas In a recent TV show, “Baron noir,” the main character launches a rant about the “f***g Bad Godesberg” advocated by the Socialist Party candidate. That the 1950s programme should be mentioned before a primetime audience bears witness to the widespread dissemination of the phrase in French political culture. “Faire son Bad Godesberg” [literally, “doing one’s Bad Godesberg”] has become an idiomatic French phrase. It refers to a fundamental alteration in the core doctrinal values of a politi- cal party (especially social-democratic and socialist ones). -

Why the European Union Promotes Democracy Through Membership Conditionality Ryan Phillips
Why the European Union Promotes Democracy through Membership Conditionality Ryan Phillips Government & International Relations Department, Connecticut College, 270 Mohegan Avenue, New London, CT 06320, USA, E-mail: [email protected] Prepared for 2017 EUSA Conference – Miami, FL DO NOT CITE OR CIRCULATE Abstract Explanations of why the European Union promotes democracy through membership conditionality provide different accounts of its normative rationale. Constructivists argue that the EU’s membership policy reflects a norm-driven commitment to democracy as fundamental to political legitimacy. Alternatively, rationalists argue that membership conditionality is a way for member states to advance their economic and security interests in the near abroad. The existing research, however, has only a weak empirical basis. A systematic consideration of evidence leads to a novel understanding of EU membership conditionality. The main empirical finding is that whereas the constructivist argument holds true when de facto membership criteria were first established in the 1960s, the rationalist argument more closely aligns with the evidence at the end of the Cold War when accession requirements were formally codified as part of the Copenhagen Criteria (1993). Keywords: democracy promotion, political conditionality, enlargement, European Union, membership Word Count: 7177 1 Introduction On October 12, 2012 in the Norwegian capital of Oslo, Thorbjørn Jagland declared, ‘The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. The Union and its forerunners have for over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe’ (Jagland 2012). In awarding the EU the Nobel Peace Prize, the former prime minister voiced a common view of the organization as well as its predecessors, namely that it has been a major force for the advancement of democracy throughout Europe. -

10 Ecosy Congress
10 TH ECOSY CONGRESS Bucharest, 31 March – 3 April 2011 th Reports of the 9 Mandate ECOSY – Young European Socialists “Talking about my generation” CONTENTS Petroula Nteledimou ECOSY President p. 3 Janna Besamusca ECOSY Secretary General p. 10 Brando Benifei Vice President p. 50 Christophe Schiltz Vice President p. 55 Kaisa Penny Vice President p. 57 Nils Hindersmann Vice President p. 60 Pedro Delgado Alves Vice President p. 62 Joan Conca Coordinator Migration and Integration network p. 65 Marianne Muona Coordinator YFJ network p. 66 Michael Heiling Coordinator Pool of Trainers p. 68 Miki Dam Larsen Coordinator Queer Network p. 70 Sandra Breiteneder Coordinator Feminist Network p. 71 Thomas Maes Coordinator Students Network p. 72 10 th ECOSY Congress 2 Held thanks to hospitality of TSD Bucharest, Romania 31 st March - 3 rd April 2011 9th Mandate reports ECOSY – Young European Socialists “Talking about my generation” Petroula Nteledimou, ECOSY President Report of activities, 16/04/2009 – 01/04/2011 - 16-19/04/2009 : ECOSY Congress , Brussels (Belgium). - 24/04/2009 : PES Leaders’ Meeting , Toulouse (France). Launch of the PES European Elections Campaign. - 25/04/2009 : SONK European Elections event , Helsinki (Finland). Speaker on behalf of ECOSY. - 03/05/2009 : PASOK Youth European Elections event , Drama (Greece). Speaker on behalf of ECOSY. - 04/05/2009 : Greek Women’s Union European Elections debate , Kavala (Greece). Speaker on behalf of ECOSY. - 07-08/05/2009 : European Youth Forum General Assembly , Brussels (Belgium). - 08/05/2009 : PES Presidency meeting , Brussels (Belgium). - 09-10/05/2009 : JS Portugal European Election debate , Lisbon (Portugal). Speaker on behalf of ECOSY. -

Versuche Der Einflußnahme Der SED Auf Die Politischen Parteien Der Bundesrepublik Nach Dem Mauerbau
Jochen Staadt Versuche der Einflußnahme der SED auf die politischen Parteien der Bundesrepublik nach dem Mauerbau Expertisenauftrag Quellenlage Quellenbewertung Ziele der SED-Westpolitik gegenüber den Parteien des Bundestages Institutionen der SED-Westpolitik Fallbeispiele 1. Die Denunziations-Kampagne gegen Herbert Wehner 2. Versuche der Einflußnahme der SED auf Bundestagswahlen 3. Versuche innerparteiliche Differenzen auszunutzen Hinweise zu den vorgelegten Dokumenten des weiteren Expertisenauftrages Zusammenfassung Dokumentenanhang Expertisenauftrag Der Auftrag beinhaltete ursprünglich neben dieser Thematik noch zwei weitere allgemeine Fragestellungen: Die Infiltration in die Neue Linke in den 60er Jah- ren und Versuche der Einflußnahme auf westdeutsche Schriftsteller und Künst- ler. Die Expertise (Dokumentation) sollte auf der Grundlage von Archivbestän- den der ehemaligen DDR erstellt werden. Die zerklüftete Quellensituation zu den letztgenannten Themen und der archivalische Erschließungsstand bei der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdien- stes der ehemaligen DDR läßt jedoch eine zusammenhängende Darstellung dieser Themenkomplexe noch nicht zu. Es werden deshalb am Ende dieser Untersuchung lediglich Einzelaspekte hierzu berührt und durch Dokumente unterschiedlicher Provenienz beleuchtet. Die vorliegende Expertise entstand mit nachhaltiger und geduldiger Unterstützung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv und der Behörde -

From Democratic Socialism and Rational Planning To
NORDIC COUNTRIES IN FINNISH PERSPECTIVE FROM DEMOCRATIC SOCIALISM AND RATIONAL PLANNING TO POSTMODERN IDENTITY POLITICS AND MARKET-ORIENTATION Ideological Development of the Social Democrats in Sweden and Finland in the Late 20th Century Sami Outinen D.Soc.Sc., University of Helsinki Democratic socialism and planning of term goal was a “socialist society” and “equality the economy between people”, which would be achieved by This article will deconstruct the ideological de- seeking the support of the majority of citizens. velopment of the Swedish Social Democratic Finland’s Social Democrats also favoured the ex- Party SAP (officially, “the Social Democratic pansion of public services, state companies and Workers’ Party of Sweden”) and the Social cooperatives, “democratic economic planning Democratic Party of Finland SDP. This will […] including the effective regulation of capital be done by analysing their own alternative movements” and “the societal control of com- scopes of action in relation to the concepts mercial banks and insurance companies”.1 The of major ideologies and economic theories SAP committed similarly in 1975 at its Party such as socialism, capitalism, economic plan- Conference to long-term planning of the econ- ning, market economy, postmodernism and omy (planmässig hushållning). It positioned Keynesianism as well as researching how Nor- itself as the representative of democratic social- dic social democrats redefined their conven- ism between communist planned economy and tional ideological meanings. capitalism.2 Accordingly, one of the motives for The SDP stressed at the Party Conference in stressing democratic socialism by the SDP was 1975 that democratic socialism was the basis to win the support of the radicalised post-war of its programmatic identity. -
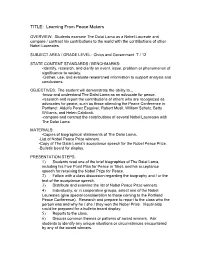
The Nobel Peace Prize
TITLE: Learning From Peace Makers OVERVIEW: Students examine The Dalai Lama as a Nobel Laureate and compare / contrast his contributions to the world with the contributions of other Nobel Laureates. SUBJECT AREA / GRADE LEVEL: Civics and Government 7 / 12 STATE CONTENT STANDARDS / BENCHMARKS: -Identify, research, and clarify an event, issue, problem or phenomenon of significance to society. -Gather, use, and evaluate researched information to support analysis and conclusions. OBJECTIVES: The student will demonstrate the ability to... -know and understand The Dalai Lama as an advocate for peace. -research and report the contributions of others who are recognized as advocates for peace, such as those attending the Peace Conference in Portland: Aldolfo Perez Esquivel, Robert Musil, William Schulz, Betty Williams, and Helen Caldicott. -compare and contrast the contributions of several Nobel Laureates with The Dalai Lama. MATERIALS: -Copies of biographical statements of The Dalai Lama. -List of Nobel Peace Prize winners. -Copy of The Dalai Lama's acceptance speech for the Nobel Peace Prize. -Bulletin board for display. PRESENTATION STEPS: 1) Students read one of the brief biographies of The Dalai Lama, including his Five Point Plan for Peace in Tibet, and his acceptance speech for receiving the Nobel Prize for Peace. 2) Follow with a class discussion regarding the biography and / or the text of the acceptance speech. 3) Distribute and examine the list of Nobel Peace Prize winners. 4) Individually, or in cooperative groups, select one of the Nobel Laureates (give special consideration to those coming to the Portland Peace Conference). Research and prepare to report to the class who the person was and why he / she / they won the Nobel Prize. -

Download Download
Iconographisk Post • Nordisk tidskrift för bildtolkning Nordic Review of Iconography Nr 3/4, 2020. issn 2323-5586. pp. 157–205. Iconographisk Post Fred Andersson Nordisk tidskrift för bildtolkning Ph.D. in Art History, Adjunct prof. (Docent), Senior lecturer, Art History & Visual Nordic Review of Iconography studies, Åbo Akademi University, Finland. Email: [email protected] Nr 3/4, 2020 Iconography of the Labour Movement. Part 2: Socialist Iconography, 1848–1952 innehåll / contents Abstract: This is Part 2 of a two-part study which aims at preliminary conclusions re- garding the iconography of the international labour movement. Earlier research in the Förord / Editorial 3 fields of social history, art history and visual rhetorics has been consulted for this pur- pose. After 1848, emerging socialist parties and labour unions depended on republican Søren Kaspersen “Quale sit intus in his” – A Note about Abbot Suger's 9 iconography for their manifestation of collective identity. The republican virtues of Bronze Doors in Saint-Denis Liberty, Equality and Fraternity remained important, but Fraternity was gradually re- placed or merged with Unity and Solidarity. In a process akin to the identification of Anders Ödman the goddess of Liberty with a more common “Marianne”, the representation of Unity Östra Sallerups kyrka i Frosta härad, Skåne: 27 and manual work in socialist iconography became focused on images of individual kolonisation och kulturella kontakter male or female workers. In earlier prints and illustrations, these representations have Ragnhild M. Bø strong affinities with how the concept of labour was personified in official monuments Miracle, Moral and Memory: Situating the Miracles 53 of the same period. -

531 Günter Wirth
ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 01 – 531 GÜNTER WIRTH SANKT AUGUSTIN 2019 I Inhaltsverzeichnis 1 Reden, Artikel, Manuskripte 1 1.1 Veröffentlichungen zu Potsdam 7 1.2 Fremdmanuskripte 9 2 Korrespondenz 10 3 CDU der DDR 20 4 Zentrumspartei 23 5 sonstige Parteien 24 6 Berlin 25 6.1 Stadtverordnetenversammlung 25 6.1.1 Ständige Kommission Kultur 25 7 Kulturbund 27 7.1 Bundeskongresse 27 7.2 Präsidiumssitzungen 27 7.3 Präsidialratssitzungen 28 7.4 Gliederungen und Sekretariate 28 7.5 Club der Kulturschaffenden "Johannes R. Becher" 28 7.6 Varia 29 8 sonstige Organisationen und Vereinigungen 30 8.1 Friedensrat der DDR 30 9 Kirche und Religion 32 9.1 Kirchengeschichte 32 9.1.1 Reformation 32 9.2 Kirchenpolitik 33 9.3 Evangelische Kirche 34 9.3.1 Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR 35 9.3.1.1 Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg 36 9.3.1.2 sonstige Mitgliedskirchen 36 9.3.2 Bund Evangelischer Pfarrer in der DDR 36 9.3.3 EKD 37 9.3.4 Kirchentage 37 9.3.5 Evangelische Kirche im Ausland 37 9.3.6 Lutherischer Weltbund 38 9.4 Katholizismus 38 9.4.1 Berliner Konferenz Europäischer Katholiken 39 9.5 Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) 39 9.6 Ökumene 39 9.6.1 Ökumenischer Rat der Kirchen 39 9.6.1.1 Vollversammlungen 39 9.6.1.2 Zentralauschuss 40 9.7 Christliche Literatur 40 9.8 Judentum 40 9.9 Varia 41 10 Christliche Friedenskoferenz (CFK) 43 10.1 Korrespondenz, Vermerke, Berichte 43 II Inhaltsverzeichnis 10.2 International 44 10.3 Allchristliche Friedensversammlung (ACFV) 45 10.4 Ausschuss zur Fortsetzung -

Stefan Appelius Als Pazifistin in Bonn: Alma Kettigs Weg in Der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion
Stefan Appelius Als Pazifistin in Bonn: Alma Kettigs Weg in der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion 1. Die Kontroverse um die Wiederaufrüstung Theo Pirker beschreibt das politische Klima in der Bundesrepublik mit Blick auf den Bundestagswahlkampf im Jahre 1953 sehr zutreffend mit der Feststellung, der Antikommunismus habe in der breiten Masse der Bevöl- kerung Westdeutschlands in jenen Jahren die Position des Antisemitismus eingenommen, in Form eines tiefen, weltanschaulich verhärteten und durch Propaganda stets aufs neue aktualisierbaren Vorurteils.1 Der Wahltag am 6. September 1953 brachte der SPD mit lediglich 28,8 % der Stimmen eine vernichtende Niederlage ein und der jungen Wittener Sozialdemokratin Alma Kettig den Einzug in den Bundestag. Alma Kettig hatte nur widerwillig und rein formal auf einem hinteren Platz der nord- rheinwestfälischen SPD-Landesliste kandidiert. Durch den Verlust sicher geglaubter Direktmandate "zog" die SPD-Landesliste in NRW erheblich besser als zunächst berechnet und bescherte so in den frühen Morgen- stunden des 7. September 1953 einer völlig überraschten Frau die Nach- richt, ihre parlamentarische Laufbahn habe soeben begonnen: "In Witten gab es fast einen kleinen Aufstand. Viele hatten ja gar nicht mitbekommen, daß ich kandidierte. Ich hatte gerade ein kleines Appartement gemietet, meine erste eigene Wohnung! Dafür hatte ich lange gespart. 20 Jahre lang hatte ich möbliert gewohnt. Als ich gerade Fenster putzte, wurde ich ans Telefon gerufen. 'Sitzt du oder stehst du?' fragten mich die Genossen aus dem Bezirksbüro. 'Wir möchten dir gratulieren'. Ich dachte, sie gratulieren mir zur Wohnung. 'Nein', sagten sie, 'zu ganz etwas anderem; du bist Bundestagsabgeordnete!' Ich konnte das zunächst gar nicht glauben. 'Allmächtiger Strohsack', dachte ich, 'was denn nun?'"2 1 Theo Pirker, 1965, S.181. -

Frauen Auf Die Göttinger Straßen(Schilder)
frauen auf die göttinger straßen(schilder) gleichstellung.goettingen.de pionierinnen 53 Göttinger Straßen sind nach ihnen benannt: nach bekannten und unbekann- teren Frauen, nach Frauen, die in Göttingen gelebt haben, oder nach jenen, deren wohltäterinnen Wirken in Deutschland und der Welt so bedeutend war, dass auch in Göttingen an sie erinnert werden soll. vorkämpferinnen …und es gibt noch viele, die es ebenfalls wert sind, durch eine Straßenbenennung geehrt zu werden. Von diesen Frauen lesen Sie in dieser Broschüre und im Netz unter gleichstellungsbuero. goettingen.de frauen auf die göttinger straßen(schilder) auf den spuren der frauen 2 Liebe Leserin, lieber Leser, 3 auf knapp 15 % von Göttingens Straßenschildern, die Personennamen zieren, befi nden sich die Namen Die Broschüre soll den politischen Willen zur Erreichung der Zielmarke stärken und durch die Vorschläge von ganz unterschiedlichen Frauen, auf die Göttingen stolz ist. Die vorliegende Veröff entlichung widmet für Neubenennungen unterstützen: frauen auf die göttinger straßen(schilder) sich diesen vielfältigen Frauenbiografi en. Sie gibt Orientierung, wo in Göttingen Straßen mit Frauennamen Die Zusammenstellung ergab sich aus einer Kooperation mit dem Institut für Diversitätsforschung, insbe- zu fi nden sind und macht diese Frauen sichtbar. Ob als Einwohner*in oder Besucher*in, Sie erhalten eine sondere mit Masterstudentin Anna Krützfeldt. Sie recherchierte das Material und bereitete die Lebensläufe gleichstellungspolitische Sicht auf die (Göttinger) Frauengeschichte und den Göttinger Stadtplan. auf. Der einleitende Beitrag des Instituts widmet sich der gesellschaftlichen Bedeutung des Themas, der Der neuen Frauenbewegung und damit der Erkenntnis, dass „auch“ Frauen Geschichte schreiben, ist es zu „Repräsentation von Frauen im öff entlichen Raum“. verdanken, dass das Wirken von Frauen in die öff entliche Wahrnehmung gerückt ist.