Damit Ihr Hoffnung Habt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Parliamentary Cultures : British and German Perspectives
CONTENTS EDITOR'S PREFACE ....................................................................... 10 WELCOME ................................................................................................. 13 Adam Ladbury, British Council ................................................................. 13 Professor JÜfgen Sch1aeger, Centre for British Studies, Humbo1dt University .................................................................................. 14 Sir Pau1 Lever, British Ambassador in Germany ....................................... 15 KEYNOTE SPEECHES ..................................................................... 17 The Constitutiona1 Revolution in Britain since May 1997 The Lord Chancellor The Rt Hon the Lord Irvine of Lairg ................... 17 The Bundestag in the Reichstag: Reflections on Par1iamentary Work in Berlin in the 21 sI Century Rudo1f Seiters MdB, Viee-President ofthe German Bundestag ............ 27 Diseussion ................................................................................................... 41 SESSION I PARLIAMENTS IN BRITAIN AND GERMANY: THE CULTURES OF PARLIAMENTS AND THE CHALLENGES OF MODERNISATION ...... 52 The Modemisation ofParliament: Themes and Challenges Clive Soley MP, Chair Parliamentary Labour Party and Chair Modemisation ofthe House ofCommons Seleet Committee ................ 53 Diseussion ................................................................................................... 63 6 The Modemisation of ParIiament: Themes and Challenges Hans-Ulrich Klose -
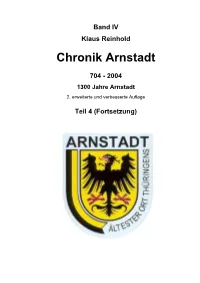
Chronik Band 4
Band IV Klaus Reinhold Chronik Arnstadt 704 - 2004 1300 Jahre Arnstadt 2. erweiterte und verbesserte Auflage Teil 4 (Fortsetzung) Hebamme Anna Kessel (Weiße 50) verhalf am 26.10.1942 dem viertausendstem Kind in ihrer langjährigen beruflichen Laufbahn zum Leben. 650 „ausgebombte“ Frauen und Kinder aus Düsseldorf trafen am 27.10.1942 mit einem Son- derzug in Arnstadt ein. Diamantene Hochzeit feierte am 28.10.1942 das Ehepaar Richard Zeitsch (86) und seine Ehefrau Hermine geb. Hendrich (81), Untergasse 2. In der Nacht vom Sonntag, dem 1. zum 2.11.1942, wurden die Uhren (um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr) um eine Stunde zurückgestellt. Damit war die Sommerzeit zu Ende und es galt wieder Normalzeit. Zum ersten Mal fand am 14.11.1942 in Arnstadt eine Hochzeit nach dem Tode statt. Die Näherin Silva Waltraud Gertrud Herzer heiratete ihren am 9.8.1941 gefallenen Verlobten, den Obergefreiten Artur Erich Hans Schubert mit dem sie ein Töchterchen namens Jutta (7 30.8.1939 in Arnstadt) hatte. Die Heirat erfolgte mit Wirkung des Tages vor dem Tode, also 8.8.1941. Die Tochter wurde „durch diese Eheschließung legitimiert“. 1943 Der Sturm 8143 des NS-Fliegerkorps baute Anfang 1943 auf dem Fluggelände Weinberg bei Arnstadt eine Segelflugzeughalle im Werte von 3500 RM. Die Stadt gewährte einen Zuschuß von 1000 RM und trat dem NS-Fliegerkorps als Fördermitglied mit einem Jahres- beitrag von 100,00 RM bei. Der fast 18-jährige Schüler Joachim Taubert (7 24.2.1925 in Arnstadt) wurde am 6.1.1943, 9.00 Uhr, in der Wohnung seiner Mutter, der Witwe Gertrud Elisabeth Taubert geb. -

Info Thüringen 90/93 Englisch.Qxd
Info Thüringen 90/93 englisch.qxd 18.05.2010 13:27 Uhr Seite 1 THÜRINGEN BLÄTTER ZUR LANDESKUNDE he peaceful revo- the 6th century, the lution in the DDR Ludowingian landgra- Tand the subse- viate of Thuringia of quent reunification in- the 12th and 13th cen- augurated the renais- tury and even earlier sance for Thuringia as historic contexts. In the political administra- 19th century, demands tive unit. In this sense to unify Thuringia be- 1989/90 signifies a dis- came louder and were tinctive turning-point gradually accomodated in the history of the during the 20th cen- federal state. Over the tury. In 1920, seven centuries, the region duchies and prince- between Harz and the doms amalgamated to Thuringian Forest, the Free State of Thu- Werratal and Pleißen- ringia with Weimar as land is a prime ex- its capital. After the end ample of German par- of World War II in 1945, ticularism. Yet, a sense the Prussian territories of “unity within diver- were joined together sity” persisted among and therewith the town the Thuringian people. of Erfurt became the This relates back to the capital of the young Thuringian kingdom of state. However, due to The Free State of Thuringia 1990/93 the implementation of the DDR’s “de- deeply rooted identity. This found ex- mocratic centralism”, the Free State of pression during the peaceful revolution Thuringia was dissolved again in 1952. in 1989, when one of the very first de- In its place, the districts of Erfurt, Gera mands was the re-establishment of Thu- and Suhl were established. -

Die SPD Als Königsmacher Und Heimlicher Wahlgewinner Koalitionsbildung in Thüringen 2009 – Eine Fallstudie
Regierungsforschung.de Das wissenschaftliche Online-Magazin der NRW School of Governance Tobias Baier / Ann‐Cathrine Böwing / Maximilian Hösl / Sarah Lüning / Jan‐Hendrik Weinhold Schwarz/Rot: Die SPD als Königsmacher und heimlicher Wahlgewinner Koalitionsbildung in Thüringen 2009 – Eine Fallstudie 27. Mai 2011 Redaktion Herausgeber (V.i.S.d.P.) Matthias Bianchi, M.A. Univ.‐Prof. Dr. Karl‐Rudolf Korte Tel. +49 (0) 203 / 379 ‐ 2706 Fax +49 (0) 203 / 379 ‐ 3179 Redaktionsanschrift matthias.bianchi@uni‐due.de Redaktion Regierungsforschung.de NRW School of Governance Wissenschaftliche Koordination Institut für Politikwissenschaft Kristina Weissenbach, M.A. Lotharstraße 53 Tel. +49 (0) 203 / 379 ‐ 3742 47057 Duisburg Fax +49 (0) 203 / 379 ‐ 3179 Tel. +49 (0) 203 / 379 ‐ 2706 kristina.weissenbach@uni‐due.de Fax +49 (0) 203 / 379 – 3179 [email protected] Sekretariat Anita Weber Tel. +49 (0) 203 / 379 ‐ 2045 www.nrwschool.de Fax +49 (0) 203 / 379 ‐ 3179 www.forschungsgruppe‐regieren.de anita.weber@uni‐due.de www.politik.uni‐duisburg‐essen.de Regierungsforschung.de Inhaltsverzeichnis: 1 Einleitung .............................................................................................................................................. 2 2 Das Wahlergebnis – potenzielle Koalitionen ........................................................................................ 3 2.1 Wahlausgang ................................................................................................................................. 3 2.2 Institutionelle -

Hessen Und Thüringen – Nachbarn Und Partner
hessisches hauptstaatsarchiv Hessen und Thüringen – Nachbarn und Partner BEGLEITHEFT ErgänzEndEr BEitrag zUr aUSStELLUNG »20 JahrE FriEdLichE Revolution Und DeutSchE EinhEit« Foto: picture-alliance / dpa HESSEN UND THÜRINGEN – NACHBARN UND PARTNER BEGLEITHEFT ERGÄNZENDER BEITRAG ZUR AUSSTELLUNG »20 JAHRE FRIEDLICHE ReVOluTION UND DeuTSCHE EINHEIT« INHALT GRussWORT MINISTERPRÄSIDENT ROLAND KOCH 4 1. EINleITUNG 6 2. HesseN UND THÜRINGEN WÄHREND Des KALTEN KRIEGes 13 2.1. DeR KALTE KRIEG 13 2.2. DIE INNERDeuTSCHE GRENZe 15 2.3 THÜRINGEN ZWISCHEN 1945 UND 1989 19 2.4 HesseN ZWISCHEN 1945 UND 1989 25 2.5 HessISCH-THÜRINGISCHE BEZIEHUNGEN WÄHREND Des KALTEN KRIEGes 30 3. DIE »WeNDE« IN THÜRINGEN 35 3.1. OPPOSITION UND WIDERSTAND VOR 1989 35 3.2. DIE FRIEDLICHE ReVOluTION UND GRÜNDUNG Des LANDes THÜRINGEN 40 4. HesseNS HIlfe FÜR THÜRINGEN 51 5. VON DER »HesseNHIlfe« ZUR LANGFRISTIGEN KOOPERATION 63 GRussWORT Liebe Leserin, lieber Leser, was in Deutschland vor zwanzig Jahren geschah, hatten viele Menschen ersehnt, aber kaum zu hoffen gewagt: Die Mauer fiel, die Grenzen zwischen Ost- und Westdeutschland wurden geöffnet. 2009 und 2010 erinnern wir an den Mauerfall und die deutsche Wiederverei- nigung. Wir sehen dabei auch auf den historischen wie auf den zeitgenössischen Kontext. Vor 70 Jahren hat Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Welt- krieg begonnen. In dessen Folge kam es zur Teilung Deutschlands wie zur Teilung Europas. Erst die Auflösung des Ostblocks und der emotional große Moment der deutschen Wiedervereinigung 1989/90 haben die europäische Einigung beflügelt und entscheidend voran gebracht. Die Europäische Union kann 2009 mit Stolz auf nunmehr fünf Jahre erfolgreicher EU-Osterweiterung zurückblicken. -

Thüringer Landtag Plenarprotokoll 5/2 5
Thüringer Landtag Plenarprotokoll 5/2 5. Wahlperiode 30.10./04.11.2009 2. Sitzung Freitag, den 30.10.2009 Mittwoch, den 04.11.2009 Erfurt, Plenarsaal Wahl der Ministerpräsidentin 21 Wahlvorschlag der Fraktion der CDU - Drucksache 5/36 - Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU - Drucksache 5/36 - erhält in geheimer Wahl bei 86 abgegebenen gültigen und einer ungültigen Stimme mit 44 Jastimmen, 39 Neinstimmen und 3 Enthaltungen nicht die erforderliche Mehrheit. Die Sitzung wird für 15 Minuten unterbrochen. Im zweiten Wahlgang erhält der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU - Drucksache 5/36 - in geheimer Wahl bei 86 abgegebenen gültigen und einer ungültigen Stimme mit 44 Jastimmen, 38 Neinstimmen und 4 Enthaltungen erneut nicht die erforderliche Mehrheit. Auf Antrag der Fraktion DIE LINKE gemäß § 41 Abs. 6 GO wird die Sitzung für 10 Minuten unterbrochen. Nach dem Ende der Sitzungsunterbrechung schlägt die Fraktion DIE LINKE den Abgeordneten Bodo Ramelow für das Amt des Mi- nisterpräsidenten des Freistaats Thüringen vor. Die Sitzung wird erneut für 10 Minuten unterbrochen. Während der Sitzungsunterbrechung wird der Wahlvorschlag der Fraktion DIE LINKE - Drucksache 5/45 - verteilt. Im dritten Wahlgang erhält in geheimer Wahl bei 87 abgegebenen gültigen Stimmen der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU - Druck- sache 5/36 - 55 Stimmen und der Wahlvorschlag der Fraktion DIE LINKE - Drucksache 5/45 - 27 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Damit ist die Abgeordnete Christine Lieberknecht gemäß Artikel 70 Abs. 3 Satz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen i.V.m. § 47 Satz 3 GO zur Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen gewählt. Vereidigung der Minister- 24 präsidentin Die Ministerpräsidentin leistet den gemäß Artikel 71 Abs. -

Dieter Althaus Ministerpräsident Freistaat Thüringen Im Gespräch Mit Werner Reuß
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks Sendung vom 26.09.2006, 20.15 Uhr Dieter Althaus Ministerpräsident Freistaat Thüringen im Gespräch mit Werner Reuß Reuß: Verehrte Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum alpha-forum, heute vom Mitteldeutschen Rundfunk in Erfurt aus, der Landeshauptstadt des Freistaates Thüringen. Bei uns zu Gast ist der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, Dieter Althaus. Ich freue mich, dass er hier ist, herzlich willkommen, Herr Ministerpräsident. Althaus: Guten Tag. Reuß: "Politik ist die Kunst, dem lieben Gott so zu dienen, dass es dem bösen Teufel nicht missfällt", so sagt ein Sprichwort. Ist das so? Ist Politik eine Gratwanderung? Was ist Politik für Dieter Althaus? Althaus: Für mich ist das jetzt natürlich das ganze Leben. Ich bin mit der Wiedervereinigung eingestiegen, damals mit dem Bewusstsein, etwas verändern zu wollen. Ich glaube, Politik muss immer wieder versuchen, die Spielregeln, die in der Gesellschaft bestehen, zu überprüfen, zu verändern, sodass sich die Gesellschaft möglichst frei gestalten kann. Zum Zweiten muss Politik auch ein großes Kommunikationsvermögen beweisen: Was da getan wird, muss auch vermittelt werden. Drittens muss Politik auch vorgelebt werden. Das heißt, derjenige, der Politik gestaltet, muss wissen, dass er als Mensch auch in besonderer Weise wahrgenommen wird. Insofern ist mit der Politik und aus der Politik heraus auch eine Vorbildrolle verbunden. Reuß: Etiketten sind nicht unproblematisch, sie neigen dazu, zum Klischee zu werden, aber ich will es dennoch mal probieren: Die "Frankfurter Rundschau" lobte Sie einmal als "überraschend offensiv". Der "Fokus" bezeichnete Sie als "Thüringer Dynamo" und die "Süddeutsche Zeitung" nannte Sie einen "zielstrebigen Pfadfinder der Macht". Fühlen Sie sich so richtig beschrieben? Althaus: Das sind alles Facetten, die sicher eine wichtige Aussagefunktion haben. -

Perspectives on the Year 2016 Table of Contents
PERSPECTIVES ON THE YEAR 2016 TABLE OF CONTENTS 3 25 Editorial Departments of the Konrad-Adenauer-Stiftung 5 Our 2016 Topics European and International Cooperation | 26 Politics and Consulting | 28 What Defines Us – What Unites Us |6 Civic Education | 30 Migration and Integration | 8 Academic Promotion and Culture | 32 The Future of Europe – Europe, our Future | 10 Academy | 34 Liberal Society References and Research Services, and Powerful Democracy | 12 Archives of Christian-Democratic Politics | 36 The Future of the West | 14 38 Digitisation and the Prosperity of Tomorrow | 16 Annual Accounts as of December 31, 2015 Urban and Rural Life | 18 42 Board of Directors 20 43 The Konrad-Adenauer-Stiftung Members 44 About Us | 21 Board of Trustees The Konrad-Adenauer-Stiftung in 2016 | 22 45 Our 2016 Laureates | 24 Publications (Selection) 46 Academic Promotion Committees 47 Publication Information Dr. Hans-Gert Pöttering Michael Thielen Former President of the Secretary General of the European Parliament, Konrad-Adenauer-Stiftung Chairman of the Konrad-Adenauer-Stiftung DEAR READER, 2016 could go down in history as a year of political ordeals. Mounting populism (not just in Germany), Brexit and its consequences for the European community of nations, the chal- lenges of flight, migration and integration, as well as the outcome of the US presidential election left one with the sense that the world could completely go off the rails. Germany is entangled in these far-reaching crises, which have shaken the familiar political, economic and cultural order in Europe and the world to its core. Parts of society look to the future with fear and concern; others in turn exploit these uncertainties and use it to their advantage. -

KAS Annual Report 2008, Perspectives 2009
MEMBERS OF THE KONRAD-ADENAUER-STIF TUNG Bettina Adenauer-Bieberstein Dr. Hermann Kues MdB Hans-Peter Repnik 60 Honorary Consul of the Parliamentary State Secretary at the Former parliamentary state secretary Republic of Iceland Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth Herbert Reul MEP Otto Bernhardt MdB Member of the Committee on Chairman of the Professor Dr. Industry, Research and Energy Hermann-Ehlers-Stiftung Norbert Lammert MdB in the European Parliament President of the German Bundestag Professor Dr. Professor Dr. Wolfgang Böhmer MdL Professor Dr. Gerd Langguth Heinz Riesenhuber MdB Prime Minister of the Former state secretary Former German minister, President of State of Saxony-Anhalt the German Parliamentary Society Professor Dr. Carl Otto Lenz Dr. Christoph Böhr MdL Former advocate general at the Professor Dr. Günter Rinsche TIONS A Former chairman of the CDU European Court of Justice Former chairman of the CDU/CSU parliamentary group in the state group in the European People‘s Party parliament of Rhineland-Palatinate Christine Lieberknecht MdL in the European Parliament UBLIC Minister of Health, Family and Social P Elmar Brok MEP Affairs of the Free State of Thuringia Professor Dr. Andreas Rödder Member of the Committee on Professor of Contemporary History Foreign Affairs, European Parliament Dr. Gisela Meister-Scheufelen at the Mainz University Ministry director at the Finance Ministry E S S E S, R Emine Demirbüken-Wegner of the State of Baden-Württemberg Dr. Norbert Röttgen MdB Member of the Berlin Parliament, First Parliamentary Secretary of the Spokeswoman youth and family policy Dr. Angela Merkel MdB CDU/CSU parliamentary group in the , A D D German Chancellor German Bundestag Eberhard Diepgen MES Former governing mayor of Berlin Philipp Mißfelder MdB Adolf Roth A Chairman of the Young Christian N Former chairman of the Budget Rainer Eppelmann Democrats Committee of the German Bundestag Chairman of the Government-funded organisation devoted to the examination Hildegard Müller Professor Dr. -

Musterstimmzettel Wahlkreis 26 Erfurt
Stimmzettel für die Wahl zum Thüringer Landtag im Wahlkreis 26 Erfurt III am 14. September 2014 Sie haben 2 Stimmen hier 1 Stimme hier 1 Stimme für die Wahl für die Wahl eines/einer Wahlkreis- einer Landesliste (Partei) abgeordneten - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien - Wahlkreisstimme Landesstimme 1 Walsmann, Marion Christlich Demokratische Union Deutschlands 1 Christlich Juristin Demokratische CDU CDU Union Christine Lieberknecht, Mike Mohring, Deutschlands Birgit Diezel, Christian Carius, Christina Tasch Erfurt 2 Ramelow, Bodo DIE LINKE 2 DIE DIE Kaufmann, MdL DIE LINKE LINKE LINKE Bodo Ramelow, Susanne Hennig-Wellsow, Margit Jung, Christian Schaft, Katharina König Erfurt 3 Dr. Beese, Wolfgang Sozialdemokratische Partei Deutschlands 3 Sozial- Seminarrektor demokratische SPD SPD Partei Heike Taubert, Christoph Matschie, Deutschlands Dorothea Marx, Uwe Höhn, Eleonore Mühlbauer Erfurt 4 Kemmerich, Thomas L. Freie Demokratische Partei 4 Freie Jurist FDP Demokratische FDP Partei Uwe Barth, Franka Hitzing, Dirk Bergner, Thomas Kemmerich, Marian Koppe Erfurt 5 Adams, Dirk BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5 Dipl.-Ing. Versorgungstechnik (FH) BÜNDNIS 90/ GRÜNE GRÜNE DIE GRÜNEN Anja Siegesmund, Dirk Adams, Astrid Rothe-Beinlich, Roberto Kobelt, Erfurt Madeleine Henfling Alternative für Deutschland 6 AfD Björn Höcke, Oskar Helmerich, Corinna Herold, Wiebke Muhsal, Jens Krumpe DIE REPUBLIKANER 7 REP Detlev Stauch, Torsten Wirsching, Dr. Heinz-Joachim Schneider, Hans-Jürgen Krause FREIE WÄHLER in Thüringen -
Annual Report 2009 | Perspectives 2010
MEMBERS OF THE KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. Bettina Adenauer-Bieberstein Professor Dr. Professor Dr. Dr. h.c. mult. Honorary Consul of the Republic Norbert Lammert MP Heinz Riesenhuber MP 63 of Iceland President of the German Bundestag Former federal minister, President of the German Bundestag Society Otto Bernhardt Professor Dr. Gerd Langguth Chairman of the Former state secretary Professor Dr. Günter Rinsche Hermann-Ehlers-Stiftung Former chairman of the CDU/CSU Professor Dr. Carl Otto Lenz group in the European People’s Party Professor Dr. Former advocate general at the in the European Parliament Wolfgang Böhmer MdL European Court of Justice Prime Minister of the State of Professor Dr. Andreas Rödder Christine Lieberknecht MdL Saxony-Anhalt Professor of Contemporary History at Minister of Health, Family and Social the Mainz University Dr. Christoph Böhr Affairs of the Free State of Thuringia Former chairman of the CDU Dr. Norbert Röttgen MP Dr. Gisela Meister-Scheufelen parliamentary group in the state Federal Minister of the Environment, Ministry director of the Finance Ministry parliament of Rhineland-Palatinate Nature Conservation and Nuclear Safety of the State of Baden-Württemberg Elmar Brok MEP Adolf Roth Dr. Angela Merkel MP Member of the Committee on Foreign Former chairman of the Budget German Chancellor Affairs, European Parliament Committee of the German Bundestag Emine Demirbüken-Wegner Philipp Mißfelder MP Professor Dr. Annette Schavan MP Chairman of the Young Christian Member of the Berlin Parliament, Federal Minister -
Names, Facts, Annual Accounts 37
Names, Facts, Annual Accounts 37 Capital Account Annual Accounts as of December 31, 2016 Assets December 31, 2016 December 31, 2015 € Thousand € A. Fixed assets Intangible assets 321,822.00 255 Property, plant and equipment 23,482,783.78 21,574 Financial assets 12,004,193.63 12,332 B. Special assets 6,595,299.18 6,573 C. Current assets Inventories 55,779.60 44 Names, Receivables and other current assets 3,302,071.19 4,384 Cash at banks and on hand 12,917,203.25 15,935 Facts, D. Prepaid expenses 229,876.40 222 Annual Balance sum 58,909,029.03 61,319 Accounts Liabilities December 31, 2016 December 31, 2015 € Thousand € A. Own funds 5,285,058.92 5,242 B. Reserves 1,491,185.80 1,099 C. Earnmarked funds 1,918,543.30 1,908 D. Subsidies for asset financing 35,541,778.99 33,880 E. Other liabilities 10,370,231.02 12,161 F. Deferred income 4,302,231.00 7,029 Balance sum 58,909,029.03 61,319 These annual accounts were audited and certified by the BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. The Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. publishes its balance sheet, a statement of income and expenses, as well as the complete certificate of the auditor in both the annual financial statement of the foundation and in the electronic Federal Gazette on the Internet (www.ebundesanzeiger.de). 38 Names, Facts, Annual Accounts Names, Facts, Annual Accounts 39 Income Statement/ Annual Accounts as of December 31, 2016 Overview Expenditure Account Expected Income and Expenses Grants and subsidies December 31, 2016 December 31, 2015 € Thousand € Federal government grants 159,147,940.30