Hessen Und Thüringen – Nachbarn Und Partner
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Thüringer CDU in Der SBZ/DDR – Blockpartei Mit Eigeninteresse
Bertram Triebel Die Thüringer CDU in der SBZ/DDR – Blockpartei mit Eigeninteresse Bertram Triebel Die Thüringer CDU in der SBZ/DDR Blockpartei mit Eigeninteresse Herausgegeben im Auftrag der Unabhängigen Historischen Kommission zur Geschichte der CDU in Thüringen und in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl von 1945 bis 1990 von Jörg Ganzenmüller und Hermann Wentker Herausgegeben im Auftrag der Unabhängigen Historischen Kommission zur Geschichte der CDU in Thüringen und in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl von 1945 bis 1990 von Jörg Ganzenmüller und Hermann Wentker Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Weiterverwertungen sind ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer- Stiftung e.V. unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme. © 2019, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin Umschlaggestaltung: Hans Dung Satz: CMS der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Druck: Kern GmbH, Bexbach Printed in Germany. Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland. ISBN: 978-3-95721-569-7 Inhaltsverzeichnis Geleitworte . 7 Vorwort . 13 Einleitung . 15 I. Gründungs- und Transformationsjahre: Die Thüringer CDU in der SBZ und frühen DDR (1945–1961) 1. Die Gründung der CDU in Thüringen . 23 2. Wandlung und Auflösung des Landesverbandes . 32 3. Im Bann der Transformation: Die CDU in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl bis 1961 . 46 II. Die CDU in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl – Eine Blockpartei im Staatssozialismus (1961–1985) 1. Die Organisation der CDU . 59 1.1. Funktion und Parteikultur der CDU . 60 1.2. Der Apparat der CDU in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl . 62 1.3. -

Parliamentary Cultures : British and German Perspectives
CONTENTS EDITOR'S PREFACE ....................................................................... 10 WELCOME ................................................................................................. 13 Adam Ladbury, British Council ................................................................. 13 Professor JÜfgen Sch1aeger, Centre for British Studies, Humbo1dt University .................................................................................. 14 Sir Pau1 Lever, British Ambassador in Germany ....................................... 15 KEYNOTE SPEECHES ..................................................................... 17 The Constitutiona1 Revolution in Britain since May 1997 The Lord Chancellor The Rt Hon the Lord Irvine of Lairg ................... 17 The Bundestag in the Reichstag: Reflections on Par1iamentary Work in Berlin in the 21 sI Century Rudo1f Seiters MdB, Viee-President ofthe German Bundestag ............ 27 Diseussion ................................................................................................... 41 SESSION I PARLIAMENTS IN BRITAIN AND GERMANY: THE CULTURES OF PARLIAMENTS AND THE CHALLENGES OF MODERNISATION ...... 52 The Modemisation ofParliament: Themes and Challenges Clive Soley MP, Chair Parliamentary Labour Party and Chair Modemisation ofthe House ofCommons Seleet Committee ................ 53 Diseussion ................................................................................................... 63 6 The Modemisation of ParIiament: Themes and Challenges Hans-Ulrich Klose -

Deutsche Demokratische Republik Kennzeichen Mit Zwei Buchstaben
Deutsche Demokratische Republik Kennzeichen mit zwei Buchstaben Der komplette Kode der zweistelligen Buchstabenkombinationen mit Stand 31.05.1990 (Kennzeichen 1990) lautet Fahrzeugart (Fz-Art) Nummer Kräder, Motorroller, Kleinkrafträder 1 Personenkraftwagen 2 Kleinbusse, Busse, KOM 3 Lastkraftwagen 4 Traktoren, Zugmaschinen 5 Spezial-Kfz, Arbeitsmaschinen 6 Einachsanhänger 7 Mehrachsanhänger 8 Bezirk Chemnitz s. Bezirk Karl-Marx-Stadt Bezirk Cottbus Von Bis Fz-Art Auch für Fz-Art Kreis ZA 00-01 ZA 15-00 1 3-8 Forst ZA 00-01 ZA 10-15 2 - Luckau ZA 10-16 ZA 18-00 2 - Spremberg ZA 15-01 ZA 25-00 1 - Guben ZA 18-01 ZA 25-50 2 3-8 Hoyerswerda ZA 25-01 ZA 50-00 1 3-8 Hoyerswerda ZA 25-51 ZA 30-00 2 7 Weißwasser ZA 30-01 ZA 38-15 2 - Finsterwalde ZA 38-16 ZA 46-50 2 7 Liebenwerda ZA 46-51 ZA 52-20 2 - Herzberg ZA 50-01 ZA 71-00 1 - Lübben ZA 52-21 ZA 56-00 2 3-8 Jessen ZA 56-01 ZA 61-00 2 7 Weißwasser ZA 61-01 ZA 99-99 2 3-8 Hoyerswerda ZA 71-01 ZA 73-00 1 3-8 Hoyerswerda ZA 73-01 ZA 83-00 1 3-8 Calau Von Bis Fz-Art Auch für Fz-Art Kreis ZA 83-01 ZA 99-99 1 - Lübben ZB 00-01 ZB 20-00 2 7 Liebenwerda ZB 00-01 ZB 30-00 1 - Cottbus ZB 20-01 ZB 40-00 2 7 Calau ZB 30-01 ZB 60-00 1 - Senftenberg ZB 40-01 ZB 60-00 2 - Cottbus ZB 60-01 ZB 80-00 2 - Finsterwalde ZB 60-01 ZB 70-00 1 3-8 Calau ZB 70-01 ZB 85-00 1 - Luckau ZB 80-01 ZB 99-99 2 7 Forst ZB 85-01 ZB 99-99 1 5-8 Spremberg ZC 00-01 ZC 10-00 3-8 - Spremberg ZC 00-01 ZC 30-00 1 3-8 Hoyerswerda ZC 10-01 ZC 20-00 3-8 - Weißwasser ZC 20-01 ZC 30-00 3-8 - Herzberg ZC 30-01 ZC 40-00 3-8 - Jessen ZC -

Message from the New Chairman
Subcommission on Devonian Stratigraphy Newsletter No. 21 April, 2005 MESSAGE FROM THE NEW CHAIRMAN Dear SDS Members: This new Newsletter gives me the pleasant opportunity to thank you for your confidence which should allow me to lead our Devonian Subcommission successfully through the next four years until the next International Geological Congress in Norway. Ahmed El Hassani, as Vice-Chairman, and John Marshall, as our new Secretary, will assist and help me. As it has been our habit in the past, our outgoing chairman, Pierre Bultynck, has continued his duties until the end of the calendar year, and in the name of all the Subcommission, I like to express our warmest thanks to him for all his efforts, his enthusi- asm for our tasks, his patience with the often too slow progress of research, and for the humorous, well organized and skil- ful handling of our affairs, including our annual meetings. At the same time I like to thank all our outgoing Titular Members for their partly long-time service and I express my hope that they will continue their SDS work with the same interest and energy as Corresponding Members. The new ICS rules require a rather constant change of voting members and the change from TM to CM status should not necessarily be taken as an excuse to adopt the lifestyle of a “Devonian pensioner”. I see no reason why constantly active SDS members shouldn´t become TM again, at a later stage. On the other side, the rather strong exchange of voting members should bring in some fresh ideas and some shift towards modern stratigraphical tech- niques. -

Palaeovolcanic and Present Magmatic Structures Along the N-S Trending Regensburg-Leipzig-Rostock Zone
Palaeovolcanic and present magmatic structures along the N-S trending Regensburg-Leipzig-Rostock zone kumulative Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften doctor rerum naturalium - Dr. rer. nat. vorgelegt dem Rat der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena von Diplom-Geophysiker Tobias Nickschick geboren am 18.11.1985 in Wernigerode Gutachter: 1. Prof. Dr. Lothar Viereck 2. Prof. Dr. Florian Bleibinhaus Tag der Veteidigung: 18.01.2017 Vorwort Diese Abschlussarbeit entstand während meiner Anstellung und Tätigkeit als wissenschaftlicher Mit- arbeiter in der Sektion 3.2 Organische Geochemie am Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoFor- schungsZentrum GFZ durch die Drittmittelfinanzierung der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG in einem gemeinsamen Projekt mit der Universität Leipzig. Diese kumulative Dissertation ist in zwei in sich geschlossene Teile aufgeteilt. Der erste Teil befasst sich mit dem übergreifenden Thema der Dissertation, der Regensburg-Leipzig-Rostock-Störungszone, der zweite Teil befasst sich mit den von meinen Coautoren und mir verfassten Fachpublikationen zu ausgewählten Einzefallbeispielen innerhalb des Gesamtrahmens. Um das Gesamtlayout dieser Dissertation nicht zu stören, werden die insgesamt vier Publikationen, von denen drei bereits publiziert sind und eine eingereicht ist, in einem separaten Teil zuammengefasst präsentiert, womit der Auflage der Promotionsordnung die Originalversionen der Publikationen zu prä- sentieren, erfüllt wird. Der erste Teil wurde von mir als alleinigem Autor verfasst, die Artikel, die im zweiten Teil zusammengefasst sind, entstanden in einem Autorenkollektiv. Die Anteile des jeweiligen Kollegen an der Erstellung der Publikationen sind im Anschluss an diese Arbeit zu finden. Da die Artikel sprachlich aufgrund des Autorenkollektivs auf die 1. Person Plural zurückgreifen, wird diese auch im ersten Teil verwendet. -
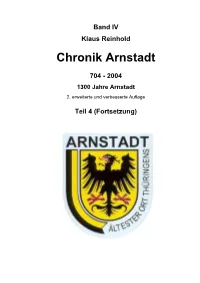
Chronik Band 4
Band IV Klaus Reinhold Chronik Arnstadt 704 - 2004 1300 Jahre Arnstadt 2. erweiterte und verbesserte Auflage Teil 4 (Fortsetzung) Hebamme Anna Kessel (Weiße 50) verhalf am 26.10.1942 dem viertausendstem Kind in ihrer langjährigen beruflichen Laufbahn zum Leben. 650 „ausgebombte“ Frauen und Kinder aus Düsseldorf trafen am 27.10.1942 mit einem Son- derzug in Arnstadt ein. Diamantene Hochzeit feierte am 28.10.1942 das Ehepaar Richard Zeitsch (86) und seine Ehefrau Hermine geb. Hendrich (81), Untergasse 2. In der Nacht vom Sonntag, dem 1. zum 2.11.1942, wurden die Uhren (um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr) um eine Stunde zurückgestellt. Damit war die Sommerzeit zu Ende und es galt wieder Normalzeit. Zum ersten Mal fand am 14.11.1942 in Arnstadt eine Hochzeit nach dem Tode statt. Die Näherin Silva Waltraud Gertrud Herzer heiratete ihren am 9.8.1941 gefallenen Verlobten, den Obergefreiten Artur Erich Hans Schubert mit dem sie ein Töchterchen namens Jutta (7 30.8.1939 in Arnstadt) hatte. Die Heirat erfolgte mit Wirkung des Tages vor dem Tode, also 8.8.1941. Die Tochter wurde „durch diese Eheschließung legitimiert“. 1943 Der Sturm 8143 des NS-Fliegerkorps baute Anfang 1943 auf dem Fluggelände Weinberg bei Arnstadt eine Segelflugzeughalle im Werte von 3500 RM. Die Stadt gewährte einen Zuschuß von 1000 RM und trat dem NS-Fliegerkorps als Fördermitglied mit einem Jahres- beitrag von 100,00 RM bei. Der fast 18-jährige Schüler Joachim Taubert (7 24.2.1925 in Arnstadt) wurde am 6.1.1943, 9.00 Uhr, in der Wohnung seiner Mutter, der Witwe Gertrud Elisabeth Taubert geb. -

Regierende Fürsten Und Landesregierungen in Thüringen 1485-1952
Hans Herz Regierende Fürsten und Landesregierungen in Thüringen 1485-1952 Vorbemerkung Die kleinstaatlichen Verhältnisse im neuzeitlichen Thüringen werden bis 1918 von den regierenden Häusern der Wettiner, der Schwarzburger und der Reußen bestimmt. Durch häufige Landesteilungen bildeten sich bei den aus dem Stammhaus Wettin hervorgegangenen sächsisch-ernestinischen Herzogtümern seit 1485, in den Gebieten der Grafen/Fürsten von Schwarzburg seit 1571 und in denen der Herren, späteren Grafen und Fürsten von Reuß seit 1564 zahlreiche Einzelstaaten heraus. Die Dauer der Existenz dieser Territorialstaaten war sehr unterschiedlich, und die Gebietsteile wechselten gemäß der Vereinbarungen bei den Erbteilungen innerhalb des jeweiligen Hauses häufig ihre Zugehörigkeit zu den einzelnen Territorien. Dieses schwer überschaubare Bild der territorialstaatlichen Struktur übersichtlicher zu machen, ist das Anliegen vorliegender Regentenverzeichnisse. Die Verzeichnisse werden nach den einzelnen Staaten bzw. staatsähnlichen Gebilden gegliedert, um ein rasches Nachschlagen der regierenden Landesherren in Bezug auf die Einzelstaaten zu ermöglichen. In den Verzeichnissen wird auf vollständige genealogische Daten verzichtet. Diese können den entsprechenden Tabellen der landesherrlichen Häuser entnommen werden. Die Daten wurden vorwiegend erfasst nach: 1. für die Ernestiner: Otto Posse: Die Wettiner. Genealogie des Gesamthauses Wettin ernestinischer und albertinischer Linie.. Im Auftrage des Gesamthauses hrsg. von Otto Posse, Leipzig-Berlin 1897, Taf. 7-21, neu hrsg. von Manfred Kobuch, Leipzig 1994 sowie Ernst Devrient: Thüringische Geschichte, 2. Auflage, Berlin-Leipzig 1921 (Sammlung Göschen); Friedrich Schneider und Armin Tille; Einführung in die Thüringische Geschichte, Jena 1931; 2. für die Schwarzburger: Friedrich Apfelstedt: Das Haus Kevernburg-Schwarzburg von seinem Ursprunge bis auf unsere Zeit, Sondershausen 1890; Heinz Deubler: Die Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt (Sonderausgabe. -

Der Gefährliche Weg in Die Freiheit Fluchtversuche Aus Dem Ehemaligen Bezirk Potsdam
Eine Publikation der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung Hannelore Strehlow Der gefährliche Weg in die Freiheit Fluchtversuche aus dem ehemaligen Bezirk Potsdam Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Außenstelle Potsdam Inhalt Vorwort 6 Kapitel 3 Fluchtversuche mit Todesfolge Quelleneditorische Hinweise 7 Fluchtversuch vom 22.11.1980 42 Kapitel 1 Ortslage Hohen-Neuendorf/Kreis Die Bezirksverwaltung Oranienburg der Staatssicherheit in Potsdam 8 Fluchtversuch vom 12.2.1987 52 Kapitel 2 im Bereich der Grenzübergangsstelle (GÜST) Der 13. August 1961 Rudower Chaussee – Mauerbau – 20 Fluchtversuch vom 7.2.1966 56 bei Staaken Quellenverzeichnis Kapitel 1 und 2 40 Fluchtversuch vom 14.4.1981 60 Bereich Teltow-Sigridshorst Quellenverzeichnis Kapitel 3 66 4 Kapitel 4 Kapitel 5 Gelungene Fluchtversuche Verhinderte Fluchtversuche durch Festnahmen Flucht vom 11.3.1988 68 über die Glienicker Brücke Festnahme vom 4.3.1975 102 an der GÜST/Drewitz Flucht vom 19.9.1985 76 im Grenzbereich der Havel Festnahme vom 27.10.1984 110 in der Nähe der GÜST/Nedlitz Flucht vom 4.1.1989 84 im Raum Klein-Ziethen/Kreis Festnahme vom 8.7.1988 114 Zossen in einer Wohnung im Kreis Kyritz 90 Flucht vom 26.7.73 Festnahme vom 8.6.1975 120 von 9 Personen durch einen Tunnel unter Schusswaffenanwendung im Raum Klein Glienicke an der GÜST/Drewitz Quellenverzeichnis Kapitel 4 101 Quellenverzeichnis Kapitel 5 128 Dokumententeil 129 Die Autorin 190 Impressum 191 5 Vorwort Froh und glücklich können wir heute sein, dass die Mauer, die die Menschen aus dem Osten Deutschlands jahrzehntelang von der westlichen Welt trennte, nicht mehr steht. -

15 Jahre Thüringer Landtag Im Rückblick Einstiger Abgeordneter Aus Den Gründerjahren Im Freistaat Thüringen
Holger Zürch Mit freiem Volk auf freiem Grunde 15 Jahre Thüringer Landtag im Rückblick einstiger Abgeordneter aus den Gründerjahren im Freistaat Thüringen Mit Fotos von Holger Zürch Von Holger Zürch im April 2013 für Qucosa.de bearbeitete, gekürzte Version der Original-Ausgabe. Das Buch erschien 2006 im Engelsdorfer Verlag Leipzig (ISBN-10: 3939404012 - ISBN-13: 9783939404019) © 2013 für diese Online-Ausgabe, Texte und Fotos: Holger Zürch Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die über das Zitatrecht bei vollständiger Quellenangabe hinausgeht, ist honorarpflichtig und bedarf der schriftlichen Genehmigung des Rechte-Inhabers. Der Inhalt wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt – dennoch sind alle Angaben ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. andtags-Abgeordnete sind Berufs-Politiker auf Zeit – so wollen es die Spielregeln L unserer Demokratie. Wer ein Landtags-Mandat erringt, engagiert sich befristet im Auftrag seiner Wähler für das Allgemeinwohl. Das nächste Wahl-Ergebnis und vor allem der innerparteilich festgelegte Platz auf der Landesliste der eigenen Fraktion entscheiden stets aufs Neue über die berufspolitische Zukunft jedes einzelnen Abgeordneten. In diesem Buch kommen bekannte und weniger bekannte Politiker aller politischen Lager in Thüringen zu Wort, die die Gründerjahre im Freistaat seit Wiedererstehen des Landes mitgeprägt haben. Mit ihren vielfältigen und oft sehr detailreichen Erinnerungen rufen sie die höchst ereignisreiche Zeit seit Oktober 1990 wach. Wie lebt es sich als „Interessen-Vertreter auf Abruf“? Welche persönlichen Erfahrungen vermittelte das Abgeordneten-Dasein – noch dazu in den Jahren umfangreichster Veränderungen seit 1990? Und wie sieht das Leben nach dem oft unfreiwilligen Abschied aus der Berufs-Politik aus? Holger Zürch hat darüber mit einstigen Abgeordneten und Ministern gesprochen, die zwischen 1990 und 2004 dem Thüringer Landtag angehörten. -

00 Front Last.Indd
? Introduction It is commonly recognised that the German Democratic Republic (GDR) was a dictatorship. Under the auspices of the Socialist Unity Party (So- zialistische Einheitspartei Deutschlands or SED), whose dominant posi- tion in government was never legitimated by free democratic elections, judicial, executive and legislative powers were also never rigorously separated, compromising the rule of law and allowing the infringe- ment of basic human and civil rights in the name of the party’s ideo- logical goals.1 The nature of the SED dictatorship, as it changed over the forty years of the GDR’s existence, remains nonetheless a ma er of considerable debate among historians seeking to explain both the causes of the state’s longevity and its ultimate collapse. Using material largely unexamined since the collapse of the GDR, this book addresses the role of low-level political and economic functionaries in the or- ganisation and management of the collective farms (Landwirtscha liche Produktionsgenossenscha en or LPGs), and in the implementation and development of agricultural policy from the agitation campaigns of the ‘Socialist Spring’ in 1960 to the development of industrial-scale agricul- ture during the 1970s and 1980s in Bezirk Erfurt.2 In so doing it aims to illuminate the changing practice of authority (Herrscha ) at the grass roots and contribute to our understanding of the interrelated history of politics and society in the middle two decades of the GDR’s existence, as the SED regime gradually a ained an unprecedented level of stabil- ity, yet found itself increasingly vulnerable to fi nancial collapse. The implementation of SED agricultural policy occurred via an ad- ministrative network that was by no means simply a well-oiled conduit of dictatorial authority but was itself evolving. -

Germany 1945’ by Richard Bessel ISBN 9781416526193 Aust RRP $24.99
Excerpt from ‘Germany 1945’ by Richard Bessel ISBN 9781416526193 Aust RRP $24.99 Read an excerpt: Introduction 1 INTRODUCTION: TO HELL AND BACK The mood of catastrophe - for us wearers of the star [of David], nine-tenths joyful, one-tenth fearful - but even when it comes to fear people say 'Better a terrible end [than no end at all]! - is growing stronger. Victor Klemperer Now I hope that everything goes back to the way it was. It is wonderful when one can lie down in bed in the evening in peace. Hopefully the war will soon be over, the soldiers will be able to come home. Gerda J. At midnight on New Year's Eve, as 1945 began, German radio broadcast Adolf Hitler's last New Year's message to the German people. To a nation that faced certain defeat, he yet again asserted his faith in ultimate victory, concluding with his 'unshakeable belief that the hour is near in which victory finally will come to that which is the most worthy of it: the Greater German Reich'.3 Popular reactions to Hitler's message were astonishingly positive, although laced with disappointment that the leader had not offered any details of how victory might be achieved, whether through new weapons or new offensives, or how the Allied bombing campaign which was causing such destruction to Germany's cities might be halted.4 Less than two weeks later, on 12 January, the great Soviet offensive began, and sealed the fate of the 'Thousand-Year Reich'. By the end of January, the Wehrmacht had suffered its highest ever monthly total of casualties as the numbers of German military dead reached their peak of over 450,000 - far in excess of the 185,000 Wehrmacht members who died in January 1943, the month of the defeat at Stalingrad.5 Never before had so many people been killed in Germany in so short a time. -

Tranformationspfade in Ostdeutschland
Inhalt Abkürzungen 7 Vorwort 13 Einleitung Gerhard Lehmbruch Zwischen Institutionentransfer und Eigendynamik: Sektorale Transformationspfade und ihre Bestimmungsgründe 17 Teil I · Infrastruktursektoren Tobias Robischon Letzter Kraftakt des Staatsmonopols: Der Telekommunikationssektor 61 Klaus König und Jan Heimann Sieg der Üblichkeit: Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 87 Martin Richter Zwischen Konzernen und Kommunen: Die Strom- und Gaswirtschaft 113 Teil II · Staatsnahe Dienstleistungen Renate Mayntz Koordinierte und dezentrale Angleichung: Akademieforschung und Hochschulen 145 Philip Manow Zerschlagung der Polikliniken und Transfer korporativer Regulierung: Das Gesundheitswesen 165 Susanne Hepperle Durchsetzung des westdeutschen Ordnungsmodells: Rundfunk und Fernsehen 191 Teil III · Marktnahe Dienstleistungen Arne Kapitza Verlegerische Konzentration und redaktionelle »Ostalgie«: Die Printmedien 241 Angelo Caragiuli Wettbewerb als Motor des Institutionentransfers: Das Bankenwesen 267 Heike Jacobsen Ungesteuerte Expansion auf der grünen Wiese: Der Einzelhandel 301 Teil IV · Produzierende Sektoren Gerhard Lehmbruch und Jörg Mayer Kollektivwirtschaften im Anpassungsprozeß: Der Agrarsektor 331 Roland Czada »Modell Deutschland« am Scheideweg: Die verarbeitende Industrie im Sektorvergleich 367 Autorinnen und Autoren 411 Sachregister 415 Abkürzungen ACZ Agrochemisches Zentrum ADN Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (DDR) AdW Akademie der Wissenschaften AG Aktiengesellschaft AKS Aqua-Kommunal-Service GmbH AOK Allgemeine Ortskrankenkasse