Carsten Burk
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ansichten Der Altenau
Ansichten der Altenau Bilder von Michael Weber und Texte von Hartmut Lux 1 Dieses Buch entstand mit freundlicher Unterstützung durch: Ansichten der Altenau Selbstverlag Michael Weber, Grüner Weg 14, D-33178 Borchen-Nordborchen www.weber-bilder.de Erste Auflage im November 2004. Bildbearbeitung: RLS Jakobsmeyer GmbH. Druck: M.P. Media-Print Informationstechnologie GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Copyrights © 2004 by Michael Weber. Bilder: Copyrights © 2004 by Michael Weber. Texte: Copyrights © 2004 by Hartmut Lux. Printed in Germany. 2 Meinem Neffen Max Weber (geb. am 6. Juni 2003) Dagegen aber behaupte ich, daß ein unmittelbares Interesse an der Schönheit der Natur zu nehmen (nicht bloß Geschmack haben, um sie zu beurteilen) jederzeit ein Kennzeichen einer guten Seele sei. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft (1790), §42 3 Das Wasser der Altenau stürzt in Nordborchen, kurz vor der Mündung in die Alme, über einen Damm in die Lohne. 4 Vorwort Wer würde fotografieren – über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren immer wieder einen bestimmten Baum (Michael Weber: „Ansichten eines Kastanienbaums“) oder wie nun vorliegend: einen Fluss, die Altenau, in all ihren verschiedenen Erscheinungsformen - wenn er nicht im äußeren Anblick etwas erlebte, einen inneren Gehalt, mit dem man wie in ein Gespräch eintritt. Ebenso wird, wer Lyrik verfasst, zum Sinneseindruck, zur Sinneserfahrung (die wechselweise Bedeutung des Wörtchens ‚Sinn’ verwirklichend) eben diese ‚innere’, begrifflich-sinnhafte Seite zum Ausdruck bringen wollen. Michael Webers Fotografien mit lyrischen Beigaben zu Aus: „Ansichten eines Kastanienbaums“ versehen, war auch so verstanden eine sehr reiz– und anspruchsvolle Aufgabe. Mit den nun vorliegenden Zuordnungen ist versucht, einerseits den Fotografien nicht durch allzugroße Nähe den Raum zu nehmen, den sie als eigenständige Bildworte beanspruchen. -
Fietsroutes in Het Paderborner Land
Fietsen in het Paderborner Land MustertextWelkom in het Paderborner Land 2 3 Breitegrund Ummeln Schillingshof AS Währentrup Boller- Nienhagen Dorla Lutter Bielefeld/Sennestadt OERLINGHAUSEN Hellwege bruch Meschesee Mosebeck Jerxen-Orbke Herberhausen Cappel FietsroutesSENNE 1 in het PaderbornerSteinbült Land Werre Windelsbleiche Im Hellenburg Meierberg Ramsbrock Welschen 270 Mossen- Wistinghausen Stapelage Hiddentrup Niederschönhagen berg Kranzmann AK Barkhauser Hakedahl Isselhorst Windflöte Bielefeld SENNESTADT Berge Pivitsheide Vahlhausen 293 Hörste Schwarzen- Hohenwart Lipper- Südstadt T brink Stapelager Hörster Bruch Egge reihe E Heiden- DETMOLD Diestelbruch Berge Brüntrup Heidegrund oldendorf U 365 Kl. Ehberg Kussel Rödling- hausen 68 Dalbke Wistinghauser T 217 Friedrichs- Senne Kahler Langer Berg dorf Ehberg Een fascinerende omgeving met O 251 Eckardtsheim Hiddesen Hülsen Nordhorn Oerlinghauser Stapelager Gr. Ehberg 224 Drostenkamp Schanze Leistruper Avenwedde Heide- Senne B 340 Spork- AS blümchen Senne Eichholz Schloß Holte/ Kröppel- interessante bezienswaardigheden: 2 Unter der feld Wald Stukenbrock Heidehaus U Grotenburg Remmig- hausen Fissenknick 33 Stukenbrock R Wellnerberg deze aantrekkelijke combinatie van Schönemark Dalkebach Sende Heiligenkirchen Hornolden- Maßbruch Senne- dorf Wehren Siewecke Schloß G Hellberg Remmighauser 1 W Berg 239 Holte ie m natuur en cultuur ontdekt u tijdens 242 Bad AUGUSTDORF 346 b Wällen H o l t e r Schling e c Meinberg E Berlebeck ke GÜTERSLOH Hahnberg onze fietsroutes! W a l d R Sundern Sürenheide Mühlgrund SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK Stemberg Fromhausen Verler Napte See HORN - BAD AS VERL Dressel- MEINBERG Gütersloh haus Vahlhausen N a t u r p a r k Stemberg Holzhausen- Moorlage Spexard W Externsteine 402 Beleef de hoogvlaktes van het Pa- ch Horn Bellenberg ba en Bornholte d Siedlung o Liemke Heimathof R Falkenberg Bärenstein Determeyer ch Elserheide ba pel A 318 derborner Land, de uitlopers van het a W h Gr. -

Quellschwemmkegel – Eine Sonderform Temporärer Karst- Quellen Auf Der Paderborner Hochfläche
Stand: 2007 Quellschwemmkegel – eine Sonderform temporärer Karst- quellen auf der Paderborner Hochfläche Die Paderborner Hochfläche ist nicht Drainage ganz oder teilweise zerstört schwemmt und von unterirdischen Gebiet und Identität nur die größte, sondern auch die wasser- worden sind. Ende der 1990er Jahre Karstwasserströmen mitgeführt. Zudem reichste Karstlandschaft Westfalens wurden auch im Altenaugebiet vier werden bei der Lösung von anstehen- (vgl. Abb. 1). An ihrem Nordrand ent- QSK aufgefunden. Der größte von dem Gestein Residualtone freigesetzt, springen entlang der Bundesstraße 1 in ihnen liegt im Mental, einem linken wodurch der Suspensionsanteil der Bad Lippspringe, Paderborn, Salzkot- Nebental der Altenau das unterhalb von Karstwässer zusätzlich erhöht wird. ten-Upsprunge und Geseke zahlreiche Henglarn mündet. Ihm widmeten FEIGE Wasserdruck und Turbulenzen verhin- Dauerquellen, von denen allein die und OTTO 1999 in „GeKo aktuell“ eine dern weitgehend eine Klärung der Trübe Paderquellen 5 m3/s im Mittel schütten. erste Veröffentlichung. In den folgenden auf dem unterirdischen Lauf, und so Im Karstgebiet selbst finden sich dage- Jahren wurden die Untersuchungen am werden die mitgeführten Schwebstoffe Naturraum gen nur in der Nähe der tief liegenden Henglarner QSK fortgesetzt und auf in den Quellen zutage gefördert. Hier Konfluenz von Alme und Altenau bei weitere, insbesondere die Tudorfer erlischt die Transportkraft, und die Trü- Borchen einige wenige perennierende Quellen ausgedehnt (FEIGE/OTTO 2005). be wird ringförmig um die Quellöffnun- Quellen. Alle übrigen versiegen in den Die Entstehung der QSK lässt sich gen im Gras der Talauen abgelagert. Die Sommermonaten zeitweilig. Sie werden wie folgt erklären: Auf den offenen frischen Ablagerungen werden von die- im Paderborner Land Quickspringe ge- Feldfluren zwischen den Tälern wird in sem durchwachsen, und die QSK wer- nannt. -

Die Altenau Soll Leben Ein Tal Bekommt Seinen Fluss Zurück
Die Altenau soll leben Ein Tal bekommt seinen Fluss zurück. MF/1 Die Altenau soll leben LEBENSADER ALTENAU IST VORBILDLICHES PROJEKT DIE ALTENAU SOLL LEBEN – NATURNÄHER GEWORDEN! MIT ENGAGIERTEN MENSCHEN SIE GEHT UNS ALLE AN Nach dem Hochwasserereignis 1965 wurden gro- Es ist außergewöhnlich, was im Altenautal im Früh- Die Altenau war schon immer ein wichtiger Be- ße Hochwasserschutzeinrichtungen im Altenautal jahr 2001 geschah. Die Menschen wollten ihren Fluss standteil unseres Tales, doch vor etwa 20 Jahren gebaut. zurück. Der Bach war ausgebaut und eing eengt, das bekam die Beziehung der Anrainer zu dem Fluss Die ökologischen Belange des Gewässers wur- wollten sie ändern. Die Altenau sollte wieder leben. schlagartig eine neue Qualität. Zu lange hatten wir den aber nicht ausreichend bedacht. Anlass für ein Auf Initiative des Attelner Heimatvereins forderten unseren Fluss genutzt, ohne Rücksicht auf Verluste. Umdenken war aber u.a. das zeitweilige Trockenfal- die Bürgerinnen und Bürger in einem Memorandum, Wir hatten die Altenau aus unserer Landschaft und len der Altenau, insbes. im Raum Atteln. Ich erinnere den Bach wieder natürlich zu gestalten. Sie warteten wohl auch aus unserem Bewusstsein weitgehend mich noch sehr genau daran, wie wir vor über 20 nicht auf den Staat und die Behörden. Sie wurden verdrängt. Die Quittung bekamen wir verblüffend Jahren fassungslos dieses Phänomen erstmals zur selbst aktiv und haben seither viel bewegt. Die Be- eindeutig präsentiert: der Fluss verschwand vor un- Kenntnis nehmen mussten. zirksregierung Detmold hat die Maßnahmen, die vor- seren Augen, er trocknete aus. Seitdem engagiert Im Jahr 2001 haben die Bürger des Altenautales bildlich vom Wasserverband Obere Lippe umgesetzt sich der Heimatverein Atteln intensiv und kontinuier- zwischen Blankenrode und Borchen unter Feder- wurden, bisher mit 1,3 Millionen Euro unterstützt. -
Fietsroutes in Het Paderborner Land
Fietsen in het Paderborner Land MustertextWelkom in het Paderborner Land 2 3 Breitegrund Ummeln Schillingshof AS Währentrup Boller- Nienhagen Dorla Lutter Bielefeld/Sennestadt OERLINGHAUSEN Hellwege bruch Meschesee Mosebeck Jerxen-Orbke Herberhausen Cappel FietsroutesSENNE 1in het PaderbornerSteinbült Land Werre Windelsbleiche Im Hellenburg Meierberg Ramsbrock Welschen 270 Mossen- Wistinghausen Stapelage Hiddentrup Niederschönhagen berg Kranzmann AK Barkhauser Hakedahl Isselhorst Windflöte Bielefeld SENNESTADT Berge Pivitsheide Vahlhausen 293 Hörste Schwarzen- Hohenwart Lipper- Südstadt T brink Stapelager Hörster Bruch Egge reihe E Heiden- DETMOLD Diestelbruch Berge Brüntrup Heidegrund oldendorf U 365 Kl. Ehberg Kussel Rödling- hausen 68 Dalbke Wistinghauser T 217 Friedrichs- Senne Kahler Langer Berg dorf Ehberg Inhoudsopgave O 251 Eckardtsheim Hiddesen Hülsen Nordhorn Oerlinghauser Stapelager Gr. Ehberg 224 Drostenkamp Schanze Leistruper Avenwedde Heide- Senne B 340 Spork- AS blümchen Senne Eichholz Schloß Holte/ Kröppel- 2 Unter der feld Wald Stukenbrock Heidehaus U Regionale fietsroutes p. 6 – p. 17 Grotenburg Remmig- hausen Fissenknick 33 R Wellnerberg Stukenbrock Schönemark Dalkebach Sende Heiligenkirchen Hornolden- Maßbruch Senne- dorf Wehren Siewecke Schloß G Hellberg Remmighauser 1 W Berg 239 Holte ie m 242 Bad AUGUSTDORF 346 b Wällen H o l t e r Schling e c Meinberg E Berlebeck ke GÜTERSLOH Hahnberg W a l d R Sundern Sürenheide Mühlgrund SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK Stemberg Fromhausen Lokale fietsroutes p. 18 –p. 41 Verler Napte See HORN - BAD AS VERL Dressel- MEINBERG Gütersloh haus Vahlhausen N a t u r p a r k Stemberg Holzhausen- Moorlage Spexard W Externsteine 402 ch Horn Bellenberg ba en Bornholte d Siedlung o Liemke R Heimathof Determeyer h Falkenberg Bärenstein ac Elserheide elb A 318 ap W h Gr. -

Broad-Scale Patterns of Invertebrate Richness and Community Composition
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Loughborough University Institutional Repository 1 Broad-scale patterns of invertebrate richness and community composition 2 in temporary rivers: effects of flow intermittence 3 T.Datry1, S.T. Larned2, K.M. Fritz3, M.T. Bogan4, P.J. Wood5, E.I. Meyer6, and A.N. Santos7 4 5 1 Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 6 l’Agriculture, Lyon, France, [email protected] 7 2 National Institute of Water and Atmospheric Research, Christchurch, New Zealand, 8 [email protected] 9 3 US-Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio, USA, [email protected] 10 4 Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA, [email protected] 11 5 Loughborough University, Leicestershire, UK, [email protected] 12 6 University of Münster, Münster, Germany, [email protected] 13 7 Texas A&M University, College Station, Texas, USA, [email protected] 14 15 Corresponding author: T. Datry, IRSTEA, UR MALY, 5 rue de la Doua, CS70077, 69926 16 Villeurbanne Cedex, France. Tel (33) 4.72.20.87.55 Fax (33) 4.78.47.78.75, 17 [email protected] 18 19 Running title: Invertebrate community patterns in temporary rivers 20 4 figures and 3 tables 21 2 Supplementary materials (S1, S2) 22 Number of references: 49 23 No. words: i. main text: 4006; ii. abstract: 251; iii. total including S1 and S2: 6943 24 25 1 26 Abstract (251 words) 27 Temporary rivers are increasingly common freshwater ecosystems, but there have been no 28 global syntheses of their community patterns. -

Der Alme-Radweg
Stand: 2013 Der Alme-Radweg Zu den Vorhaben, die auf der Grund- der betroffenen Kommunen Brilon, B64 lage des EU-Programms LEADER Büren und Bad Wünnenberg. Neben Delbrück Schloß Neuhaus im Zeitraum 2007–2013 gefördert der gezielten Vermarktung des Alme- Elsen wurden, gehören auch der Ausbau Radwegs wurden weitere Projekt- Lippe PADERBORN und die Vermarktung von Radwegen. ideen angedacht, u. a.: Damit sollen touristische Potenziale – Schaffung eines touristischen An- B64 im ländlichen Raum umfassender gebotes zur Almetalbahn, Salzkotten Borchen erschlossen und genutzt werden. – touristische Inwertsetzung der B1 Mallinck- Almequellen, Alfen rodthof – Verbesserung des ÖPNV-Angebo- Borchen Geseke Niederntudorf A33 tes, – touristische Erschließung der histo- Ahden Wewelsburg rischen Salzhandelswege, A45 – Schaffung einer Bogensportregion Brenken Dieser Gedanke wurde in allen Sauerland/Eggegebirge/Teutobur- Büren Haaren zehn LEADER-Regionen im west- ger Wald (vorhandene Anlagen Nieder- u. fälischen Raum aufgegriffen und u. a. in Brilon, Marsberg, Wille- Mittelmühle Siddinghsn. praktisch umgesetzt. Im Folgenden badessen). Alme Bad Harth Wünnenbg. soll der Alme-Radweg vorgestellt Burgruine werden. Der Alme-Radweg – Ringelstein eine Kurzbeschreibung B516 Alme- B480 Kooperationsvereinbarung Der knapp 70 km lange Radweg M Radweg öh Alme benachbarter LEADER-Regionen verbindet den nordöstlichen Teil des ne Alme- 5km Das gemeinsame Kooperationspro- Hochsauerlandes mit dem Pader- quellen B7 jekt der benachbarten LEADER-Regi- borner Land. Er beginnt -

Runder Tisch Lippe OWL (PE LIP 1800, 1900, 2000) 15.Mai 2014, Paderborn, Kreishaus
Runder Tisch Lippe OWL (PE LIP 1800, 1900, 2000) 15.Mai 2014, Paderborn, Kreishaus Inhaltsübersicht Tagesordnung Deckblatt und Tagesordnung 10:00 1. Begrüßung und Einführung (Birgit Rehsies, BezReg) Einblicke in das biologische Monitoring pro Planungseinheit (Ulrich Volkening, BezReg) Planungseinheitensteckbrief 2. Situation in den Planungseinheiten Defizitanalyse Istzustand (Andrea Püschel, BezReg) Karte: Ökologischer Zustand Vom Runden Tisch zur Umsetzung (Lutz Alsenz, Kreis Paderborn Karte: Gewässerstrukturgüte Volker Karthaus, Wasserverband Obere Lippe) Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Beratungskonzepts zur Sicherung / Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer (Landwirtschaftskammer und Bezirksstelle für Agrarstruktur) Übersicht Monitoringkomponenten 3. Handlungsbedarf (Birgit Rehsies, BezReg) 4. Diskussion 16:00 5. Abschluss (Birgit Rehsies, BezReg) einschließlich Kaffee- und Mittagspause Gewässerboden lebende wirbellose Tiere wie Schnecken, Krebse und Insektenlarven. 4.9 PE_LIP_1800: Haustenbach Die Saprobie ist im Biesterbach, im Bergwiesenbach und im Schwarzer Graben nur mäßig. In den übrigen Bächen ist sie gut, im Knochenbach und Boker Kanal sogar sehr 4.9.1 Allgemeine Informationen zur Planungseinheit gut. Gebietsbeschreibung Die Planungseinheit liegt westlich des Teutoburger Waldes und zieht sich über den südlichen Bereich von Hövelhof über Delbrück nördlich der Lippe entlang bis nach Bad Waldliesborn. Die hauptsächlichen Gewässer sind die Glenne (Haustenbach), der Bo- ker-Heide-Kanal (Menzelsfelderkanal), -
Lp-Büren-Wünnenberg-Text Stand 1-Änderung
KREIS PADERBORN LANDSCHAFTSPLAN BÜREN-WÜNNENBERG Stand 1. Änderung Textliche Darstellungen und Festsetzungen mit Erläuterungen Erarbeitet vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Westfälisches Amt für Landes- und Baupflege, Außenstelle Detmold, im Auftrage des Kreises Paderborn, überarbeitet durch: KREIS PADERBORN, Fachbereich Umwelt, Natur und Landschaftspflege Landschaftsplan Büren-Wünnenberg Seite II Inhalt Inhalt A. Vorwort B. Planbestandteile, Verfahrenshinweise C. Rechtsgrundlagen D. Räumlicher Geltungsbereich E. Planerische Vorgaben und Grundlagen des Landschaftsplanes 1. Entwicklungsziele für die Landschaft 1.1 Entwicklungsziel 1 Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft 1.2 Entwicklungsziel 2 Anreicherung einer im ganzen erhaltungswürdigen Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen 1.3 Entwicklungsziel 3 Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflächenstruktur geschädigten oder stark vernachlässigten Landschaft 1.4 Entwicklungsziel 4 Ausbau der Landschaft für die Erholung 1.5 Entwicklungsziel 5 (nicht dargestellt) 1.6 Entwicklungsziel 6 Erhaltung und Sicherung natürlicher Landschaftselemente sowie landschaftsgerechte Gestalt- tung des Ortsbildes in neu entstehenden Baugebieten durch Regelung in Bebauungsplänen 2. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft 2.1 Naturschutzgebiete 2.2 Landschaftsschutzgebiete 2.3 Naturdenkmale 2.4 Geschützte -
Wiesenbewässerung an Der Alme Von Wolfgang Feige Ein Blick in Ihre Zukunft
17. Jahrgang – 6/2004 erscheint 6x jährlich HER H C EI Heimatpflege IS M L A in Westfalen Ä T F B T U S Herausgeber: N E D Heimatpflege Westfälischer Heimatbund Kaiser-Wilhelm-Ring 3 · 48145 Münster W - - ISSN 0933-6346 M R Ü N S T E in Westfalen Sparkassen-Finanzgruppe Steuervorteile für Lebensversicherungen noch bis Ende 2004 sichern! Wiesenbewässerung an der Alme von Wolfgang Feige Ein Blick in Ihre Zukunft. Mit der Sparkassen-Altersvorsorge. Pionierarbeit für den Wiesenbau S von Heinz Wilhelm Bensberg Mit unseren Angeboten zur privaten und betrieblichen Altersversorgung können Sie sich unbeschwert auf morgen freuen. Dafür sorgt Ihr maßgeschneiderter Vorsorgeplan mit starken Renditen für die Zukunft. Bisher waren Kapitalauszahlungen aus Lebens- oder Rentenversicherungen in der Regel steuer- Mitglieder- frei. Dieser Steuervorteil fällt bei Abschlüssen nach 2004 weg. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle und unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse. versammlung in Brakel Der Inhalt auf einen Blick Termine Wolfgang Feige JUGENDARBEIT Wiesenbewässerung an der Alme und in ihren Die Jugendgruppe des Heimatvereins Rüthen . 22 18. Dezember 2004 – 02. Januar 2005 · Oelde 21. – 22. April 2005 · Tecklenburg Nebentälern . 1 „Kartoffelfeuer“ . 23 Ausstellung im Heimathaus „Schöne Kinderzeit“ mit Pup- Heimatvereine kümmern sich um Streuobstwiesen pen und Eisenbahn Naturschutzseminar des Westfälischen Heimatbundes Heinz Wilhelm Bensberg NACHRICHTEN UND NOTIZEN Heimatverein Oelde e.V. · Hans Rochol · Tel.: 02522/3488 Werner Gessner-Krone · Tel.: 0251/203810-13 Siegerländer Pionierarbeit für den Wiesenbau. 7 Das Buch zum Archäologie-Museum . 23 Herbsttagung der Heimatvereine aus dem 15. März 2005 · Münster 23. April 2005 · Münster / Havixbeck AUF SCHUSTERS RAPPEN Bereich Borken . -
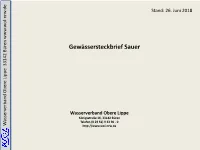
Steckbrief Sauer.Pdf
Stand: 26. Juni 2018 nrw.de - Gewässersteckbrief Sauer Wasserverband Obere Lippe Königsstraße 16, 33142 Büren Telefon (0 29 51) 9 33 90 - 0 Wasserverband Obere Lippe www.wol Obere 33142 Büren Wasserverband http://www.wol-nrw.de nrw.de - Inhaltsverzeichnis 1. Die Sauer – Steckbrief 2. Die Sauer – Kurzbeschreibung 3. Übersichtsplan 4. Historischer und heutiger Verlauf der Sauer 5. Preußische Uraufnahme 6. Naturräumliche Gliederung 7. Fließgewässertypen 7.1 Typ 7 Karstbach 7.2 Typ 11 Kleiner Talauenbach des Deckgebirges 9. Hydrologie und Klima 8. Geologie/Boden 9. Grundwasser 10. Fische 11. Vorher - Nachher Wasserverband Obere Lippe www.wol Obere 33142 Büren Wasserverband 1. Die Altenau – Steckbrief nrw.de Einzugsgebietsdaten: - Übersicht Einzugsgebietsdaten: Quelle: Lichtenau – Kleinenberg (367 mNHN) Mündung: Lichtenau – Atteln (189 mNHN) Fließlänge von der Quelle bis zur Mündung: 29,90 km Einzugsgebietsgröße Sauer: 110 km² Gewichtetes Sohlgefälle (gesamt): 5,95‰ relevante Zuflüsse im Verbandsgebiet: Bach von Kleinenberg bei GK 24+420 Odenheimer Bach bei GK 18+580 Schmittwasser bei GK 12+520 Gewässerkennzahlen: DE_NRW_278284_0 Fließgewässertyp: - von der Mündung Altenau bis zum HRB Sudheim: Karstbach (LAWA Typ 7) - vom HRB Sudheim bis zur Quelle: Kleiner Talauenbach des Deckgebirges Wasserverband Obere Lippe www.wol Obere 33142 Büren Wasserverband (LAWA Typ 11) Fischregionen: - von Mündung bis nrw.de Zufluss Odenheimer Bach: Karstbäche - - bis B 68 : oberer Forellentyp Karstbereiche - bis Quelle: oberer Forellentyp Mittelgebirge Mittlere Jahresniederschlagsmenge (Lichtenau): 901 mm Jahresdurchschnittstemperatur: 8,1 °C Abflussdaten HRB Sudheim: MNQ 0,150 m³/s MQ 0,400 m³/s HQ (1965) 56,00 m³/s Höhe der Quelle über NHN: 367 m Höhe der Mündung in die Alme über NHN: 189 m Durchschnittliche Wasserbreite (Mittellauf): - Ausbauzustand 8 – 12 m - naturnaher Zustand 6 – 8 m Durchschnittliche Wassertiefe (Mittellauf): - Ausbauzustand 1,5 – 2,5 m - naturnaher Zustand 0,5 – 1 m Wasserverband Obere Lippe www.wol Obere 33142 Büren Wasserverband 2. -

Borchen Stand März 2021
Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Borchen Stand März 2021 Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Borchen Die Karte zeigt die Risikogewässer und die Ausdehnung der Überflutung für das extreme Hochwasserereignis (HQextrem) im 2.Umsetzungszyklus 2016-2021 der HWRM-RL. Bezirksregierung Detmold Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Borchen Stand März 2021 Der Kommunensteckbrief stellt die Maßnahmenplanung zur Verminderung von Hochwasserrisiken in Ihrer Kommune dar. Die Maßnahmenplanung ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der europäischen Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) in Ihrer Region. Sie wurde auf der Grundlage der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für die Gewässer mit potenziellem signi- fikantem Hochwasserrisiko, die sogenannten Risikogewässer, erarbeitet. Mithilfe der Karten erkennen Sie, wo in Ihrer Region oder Ihrer Stadt konkret Gefahren und Risiken durch Hochwasser bestehen. Die aktuellen Gefahren- und Risikokarten und viele weitere Informationen zum Hochwasserrisikomanagement in NRW finden Sie auf der Inter- netseite flussgebiete.nrw.de oder in den Kartendiensten elwasweb.nrw.de bzw. uvo.nrw.de. Von welchen Risikogewässern ist Ihre Kommune betroffen? Teileinzugsgebiet (TEG) Lippe Flussgebiete NRW > TEG Lippe Alme Altenau Ellerbach Hinweis: Eine Hochwassergefährdung kann sich auch durch Gewässer ergeben, die hier nicht aufgeführt sind. Diese können in Ihrer Kommune liegen oder außerhalb. 2 Bezirksregierung Detmold