Kreisparteischulen Der SED 1947–1952 116
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
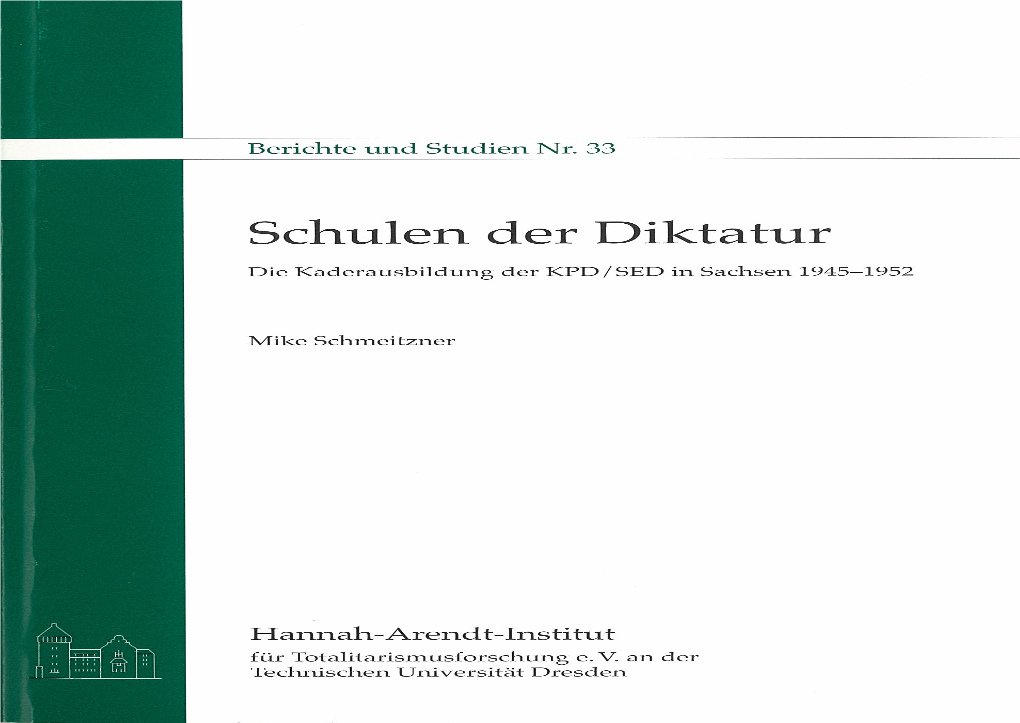
Load more
Recommended publications
-

Political and Economic News in the Age of Multinationals
Heidi J. S. Tworek Political and Economic News in the Age of Multinationals This article compares two media multinationals that supplied different genres of news, political and economic. Most media companies provided both genres, and these categories often overlapped. Still, investigating two firms founded in twenti- eth-century Germany shows how product differentiation affects the organization, geographical orientation, and business models of multinationals. While political news had the greatest impact when it was free and ubiquitous, economic news was most effective when it was expensive and exclusive. ews and information are, in many ways, the lifeblood of globaliza- Ntion. News fosters cross-border trade and can function as a com- modity itself. As a former news agency employee put it in 1910, of all types of commerce and transportation, news “acquired first and most often a global character.”1 But only very specific multinationals—news agencies—collected and disseminated global news from the mid-nine- teenth century. Apart from major publications like the London Times or Vossische Zeitung, most newspapers could not afford foreign corre- spondents or even journalists in their own capital cities. They relied instead upon news agencies for global and national news filtered through the technological conduit of cables and, later, telephones, wire- less, and ticker machines. To express the difference in commercial terms, news agencies were “news wholesalers,” distributing news to their “retail clients” (newspapers).2 Newspapers repackaged the news for their The author is grateful to Walter Friedman, Lilly Evans, Michael Tworek, and the three anonymous referees for their very helpful comments and suggestions. She also wishes to thank the members of the Business, Government, and the International Economy unit at Harvard Business School, where this research was first presented in 2014. -

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in Sachsen
Schlagwort-Nr. 6098. Online seit 31.07.2013, aktualisiert am 06.05.2019. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in Sachsen Während des Ersten Weltkriegs spalteten sich auch in Sachsen die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) in einen Unabhängigen (USPD) und einen Mehrheitsflügel (MSPD). Jedoch trat nur der Bezirk Leipzig benahe geschlossen zur USPD über, so dass die MSPD bis auf regionale Ausnahmen in den meisten Gebieten Sachsens ihre dominante Position innerhalb der Arbeiterschaft behaupten konnte. Da jedoch die nach der Novemberrevolution 1918 auch in Sachsen gebildete sozialliberale Koalition – die SPD hatte bei den Wahlen zur Volkskammer am 2. Februar 1919 41,6% der Stimmen bzw. 42 Mandate gewonnen – in Verbindung mit Reichswehr und Freikorps gegen revoltierende Arbeiter einschritt und gleichzeitig prinzipiell eine Mehrheit für eine sozialistische Einheitsregierung bestand, schwenkte die MSPD immer weiter nach links. Gleichzeitig erneuerte sich die schon vor dem Kriege bestehende Polarisierung zwischen sozialistischen und bürgerlichen Parteien, die in der Folgezeit eine Zusammenarbeit beider Lager erschwerte, oft sogar verhinderte. Nach den Landtagswahlen am 14. November 1920, bei denen die SPD nur noch auf 28,3% bzw. 27 Mandate kam, setzte sich schließlich die Richtung durch, die eine von der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) tolerierte Koalition aus MSPD und USPD einer Zusammenarbeit mit Deutscher Demokratischer Partei (DDP) und Deutscher Volkspartei (DVP) vorzog. Die linksrepublikanische Regierung betrieb energische Reformen insbesondere in den Bereichen Schul- und Kommunalpolitik, im Justiz- und Polizeiwesen sowie in der Wirtschaft. Im Herbst 1922 vereinigten sich beide Parteien relativ konfliktfrei zur Vereinigten SPD (VSPD). Die wiedervereinigte Partei kam bei den Landtagswahlen am 5. November 1922 wieder auf 41,8%. -

Plauen 1945 Bis 1949 – Vom Dritten Reich Zum Sozialismus
Plauen 1945 bis 1949 – vom Dritten Reich zum Sozialismus Entnazifizierung und personell-struktureller Umbau in kommunaler Verwaltung, Wirtschaft und Bildungswesen Promotion zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. der Philosophischen Fakultät der Technischen Universität Chemnitz eingereicht von Dipl.-Lehrer Andreas Krone geboren am 26. Februar 1957 in Plauen angefertigt an der Technischen Universität Chemnitz-Zwickau Fachbereich Regionalgeschichte Sachsen betreut von: Dr. sc. phil. Reiner Groß Professor für Regionalgeschichte Sachsen Beschluß über die Verleihung des akademischen Grades Doktor eines Wissenschaftszweiges vom 31. Januar 2001 1 Inhaltsverzeichnis Seite 0. Einleitung 4 1. Die Stadt Plauen am Ende des 2. Weltkrieges - eine Bilanz 9 2. Zwischenspiel - die Amerikaner in Plauen (April 1945 - Juni 1945) 16 2.1. Stadtverwaltung und antifaschistischer Blockausschuß 16 2.2. Besatzungspolitik in der Übergangsphase 24 2.3. Anschluß an die amerikanische Zone? 35 2.4. Resümee 36 3. Das erste Nachkriegsjahr unter sowjetischer Besatzung 38 (Juli 1945 - August 1946) 3.1. Entnazifizierung unter der Bevölkerung bis Ende 1945 38 3.2. Stadtverwaltung 53 3.2.1. Personalreform im Stadtrat 53 3.2.2. Strukturelle Veränderungen im Verwaltungsapparat 66 3.2.3. Verwaltung des Mangels 69 a) Ernährungsamt 69 b) Wohnungsamt 72 c) Wohlfahrtsamt 75 3.2.4. Eingesetzte Ausschüsse statt gewähltes Parlament 78 3.2.5. Abhängigkeit der Stadtverwaltung von der Besatzungsmacht 82 3.2.6. Exkurs: Überwachung durch „antifaschistische“ Hauswarte 90 3.3. Wirtschaft 93 3.3.1. Erste personelle Maßnahmen zur Bereinigung der Wirtschaft 93 3.3.2. Kontrolle und Reglementierung der Unternehmen 96 3.3.3. Entnazifizierung in einer neuen Dimension 98 a) Die Befehle Nr. -

Qualitative Changes in Ethno-Linguistic Status : a Case Study of the Sorbs in Germany
Qualitative Changes in Ethno-linguistic Status: A Case Study of the Sorbs in Germany by Ted Cicholi RN (Psych.), MA. Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Political Science School of Government 22 September 2004 Disclaimer Although every effort has been taken to ensure that all Hyperlinks to the Internet Web sites cited in this dissertation are correct at the time of writing, no responsibility can be taken for any changes to these URL addresses. This may change the format as being either underlined, or without underlining. Due to the fickle nature of the Internet at times, some addresses may not be found after the initial publication of an article. For instance, some confusion may arise when an article address changes from "front page", such as in newspaper sites, to an archive listing. This dissertation has employed the Australian English version of spelling but, where other works have been cited, the original spelling has been maintained. It should be borne in mind that there are a number of peculiarities found in United States English and Australian English, particular in the spelling of a number of words. Interestingly, not all errors or irregularities are corrected by software such as Word 'Spelling and Grammar Check' programme. Finally, it was not possible to insert all the accents found in other languages and some formatting irregularities were beyond the control of the author. Declaration This dissertation does not contain any material which has been accepted for the award of any other higher degree or graduate diploma in any tertiary institution. -

Download Download
83 Jonathan Zatlin links: Jonathan Zatlin rechts: Guilt by Association Guilt by Association Julius Barmat and German Democracy* Abstract Although largely forgotten today, the so-called “Barmat Affair” resulted in the longest trial in the Weimar Republic’s short history and one of its most heated scandals. The antidemocratic right seized upon the ties that Julius Barmat, a Jewish businessman of Ukrainian provenance, maintained to prominent socialists to discredit Weimar by equat- ing democracy with corruption, corruption with Jews, and Jews with socialists. The left responded to the right’s antidemocratic campaign with reasoned refutations of the idea that democracy inevitably involved graft. Few socialist or liberal politicians, however, responded to the right’s portrayal of Weimar as “Jewish.” The failure of the left to identify antisemitism as a threat to democracy undermined attempts to democratize the German judiciary and ultimately German society itself. And then it started like a guilty thing Upon a fearful summons.1 In a spectacular operation on New Year’s Eve 1924, the Berlin state prosecutor’s office sent some 100 police officers to arrest Julius Barmat and two of his four brothers. With an eye toward capturing headlines, the prosecutors treated Barmat as a dangerous criminal, sending some 20 policemen to arrest him, his wife, and his 13-year old son in his villa in Schwanenwerder, an exclusive neighbourhood on the Wannsee. The police even brought along a patrol boat to underscore their concern that Barmat might try to escape custody via the river Havel. The arrests of Barmat’s leading managers and alleged co-conspirators over the next few days were similarly sensational and faintly ridiculous. -

Die Gründung Der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands in Sachsen 1945
Die Gründung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands in Sachsen 1945 Von Ralf Baus Ende April/Anfang Mai 1945 war auch Sachsen von den Einheiten der alliierten Armeen besetzt worden. Mit rund 5,6 Millionen Einwohnern war Sachsen am Ende des Krieges nicht nur das bevölkerungsreichste, sondern auch das am dichtesten besiedelte Land der Sowjetischen Besatzungszo- ne.1 Leipzig und Dresden gehörten nach Hamburg, Köln, München und Berlin zu den größten Städten Deutschlands. Die militärische Besetzung durch die Alliierten hatte für Sachsen zu einer besonderen Situation geführt. Im Rahmen der Prager und Berliner Operation gingen am 16. April 1945 die Einheiten der 1. Ukrainischen Front über die Neiße, während die amerikanischen Truppen die westlichen Grenzen des sächsischen Territoriums überschritten. Am 19./20. April besetzten die amerikanischen Truppen Leipzig; am Tage der Kapitulation erreichte die Rote Armee Dresden.2 Im Verlauf der militärischen Operation waren etwa 80 Dörfer im westlichen Erzgebirge um Stollberg, Schwarzenberg3 und Aue unbesetzt geblieben. Bis zum Abzug der Amerikaner, Anfang Juli, bestanden somit drei verschiedene Besatzungszonen im Lande. 1 Vgl. Tab. «Ausgewählte Daten zur Sozial- und Wirtschaftsstruktur der Länder und Pro- vinzen der sowjetischen Besatzungszone (Stand 1946)«, zusammengestellt nach Volks- und Berufszählung vom 29. Oktober 1946, Berlin 1948, in: Helga A. WELSH, Revolutionärer Wandel auf Befehl? Entnazifizierungs- und Personalpolitik in Thüringen und Sachsen 1945-1948 (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Bd. 58), München 1988, S. 15. Bei unmittelbarem Kriegsende dürfte die Zahl aufgrund zahlreicher Flüchtlinge höher gewesen sein. Eine Aufstellung der Landesverwaltung Sachsen gibt für den Monat August 1945 eine Bevölkerungszahl von 5.641.451 für die 30 Land- und 23 Stadtkreise Sachsens an. -

Das Kabinett Scheidemann, Die Oberste Heeresleitung Und Der Vertrag Von Versail Les Im Juni 1919
Dokumentation HORST MÜHLEISEN ANNEHMEN ODER ABLEHNEN? Das Kabinett Scheidemann, die Oberste Heeresleitung und der Vertrag von Versail les im Juni 1919 Fünf Dokumente aus dem Nachlaß des Hauptmanns Günther von Poseck* Für Walter Heinemeyer zum 75. Geburtstag am 5. August 1987 1. Die Bedeutung der Dokumente Die Ereignisse in Weimar, nach Rückkehr der deutschen Friedensdelegation aus Versailles am 18. Juni 1919, können „immer noch nicht bis in die letzten Einzelhei ten"1 rekonstruiert werden. Eine von Wilhelm Ziegler bereits 1932 geäußerte Ansicht, ein wirklich exaktes Bild von der genauen Reihenfolge der einzelnen Aktionen sei kaum zu gewinnen2, wurde durch die Forschungen von Hagen Schulze bestätigt3. Schulze konnte eine „Aufzeichnung des Ersten Generalquartiermeisters [General leutnant Groener] über die Tage in Weimar vom 18. bis zum 20. Juni 1919" vorle gen4, die im Nachlaß Schleicher vorhanden ist5. Im Mittelpunkt dieser Niederschrift stehen die drei Sitzungen vom 19. Juni 1919 und die beiden Besprechungen Groeners am 18. Juni mit dem preußischen Kriegsmi nister, Oberst Reinhardt, bzw. am 20. Juni 1919 mit Reichswehrminister Noske. * Dem Präsidenten des Bundesarchivs Koblenz, Herrn Prof. Dr. Hans Booms, danke ich sehr für sein förderndes Interesse, mit dem er diese Dokumentation unterstützt hat. Herrn Archivdirektor Dr. Gerhard Granier, Bundesarchiv - Militärarchiv in Freiburg i.Br., bin ich für seine ergänzenden und wertvollen Mitteilungen zu Dank verpflichtet. 1 Udo Wengst, Graf Brockdorff-Rantzau und die außenpolitischen Anfänge der Weimarer Republik (Moderne Geschichte und Politik, Bd. 2), Frankfurt/M. 1973, S. 88. 2 Wilhelm Ziegler, Die deutsche Nationalversammlung 1919/20 und ihr Verfassungswerk, Berlin 1932, S. 76. 3 Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. -

Gesamtinhaltsverzeichnis Über Die Bände 64-87 (1993-2016)
Neues Archiv für sächsische Geschichte Gesamtinhaltsverzeichnis über die Bände 64-87 (1993–2016) bearbeitet von Jens Klingner, Frank Metasch, André Thieme und Lutz Vogel unter Mitarbeit von Christian Gründig, Kerstin Mühle, Pia Heine, Bettina Pahl, Robin Richter und Martin Schwarze Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. Dresden 2017 Neues Archiv für sächsische Geschichte Herausgeber Bd. 64- 69 Karlheinz Blaschke Bd. 70-72 Karlheinz Blaschke in Verbindung mit dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. Bd. 73-86 Karlheinz Blaschke; Enno Bünz; Winfried Müller; Martina Schattkowsky; Uwe Schirmer im Auftrag des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. Schriftleitung/Redaktion Bd. 64, 65 Uwe John (redaktionelle Mitarbeit) Bd. 66-69 Uwe John (Redaktion) Bd. 70-72 Uwe John (Schriftleitung) Bd. 73-80 André Thieme (Redaktion) Bd. 81 André Thieme/Frank Metasch (Redaktion) Bd. 82-86 Frank Metasch (Schriftleitung), Lutz Vogel (Rezensionen) Verlag Bd. 64-69 Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger Weimar Bd. 70-86 Verlag Ph. C. W. Schmidt Neustadt an der Aisch 2 INHALTSVERZEICHNIS A. Alphabetisches Verzeichnis der Mitarbeiter und ihrer Beiträge 4 B. Systematische Inhaltsübersicht 20 I. Quellenkunde und Forschung a. Quellen 20 b. Bibliografie 24 c. Tätigkeitsberichte 24 d. Projekte 25 II. Landesgeschichte: chronologisch a. Allgemeines 26 b. Mittelalter bis 1485 27 c. 1485 bis 1648 30 d. 1648 bis 1830 33 e. 1830 bis 1945 37 f. 1945 bis zur Gegenwart 40 III. Landesgeschichte: thematisch a. Archäologie 41 b. Siedlungsgeschichte und Landeskunde 42 c. Namenkunde 43 d. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 44 e. Kultur- und Mentalitätsgeschichte 47 f. Geschlechtergeschichte 51 g. Schul-, Universitäts- und Bildungsgeschichte 52 h. -

1923 Inhaltsverzeichnis
1923 Inhaltsverzeichnis 14.08.1923: Regierungserklärung .............................................................................. 2 22.08.1923: Rede vor dem Schutzkartell für die notleidende Kulturschicht Deutschlands ........................................................................................ 14 24.08.1923: Rede vor dem Deutschen Industrie- und Handelstag ........................... 18 02.09.1923: Rede anläßlich eines Besuchs in Stuttgart ........................................... 36 06.09.1923: Rede vor dem Verein der ausländischen Presse in Berlin .................... 45 12.09.1923: Rede beim Empfang des Reichspressechefs in Berlin ......................... 51 06.10.1923: Regierungserklärung ............................................................................ 61 08.10.1923: Reichstagsrede ..................................................................................... 97 11.10.1923: Erklärung im Reichstag ........................................................................119 24.10.1923: Rede in einer Sitzung der Ministerpräsidenten und Gesandten der Länder in der Reichkanzlei ..................................................................121 25.10.1023: a) Rede bei einer Besprechung mit den Vertretern der besetzten Gebiete im Kreishaus in Hagen ..........................................................................................147 b) Rede in Hagen .................................................................................................178 05.11.1923: Redebeitrag in der Reichstagsfraktion -
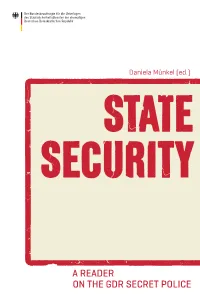
Bstu / State Security. a Reader on the GDR
Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Imprint Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German Democratic Republic Department of Education and Research 10106 Berlin [email protected] Photo editing: Heike Brusendorf, Roger Engelmann, Bernd Florath, Daniela Münkel, Christin Schwarz Layout: Pralle Sonne Originally published under title: Daniela Münkel (Hg.): Staatssicherheit. Ein Lesebuch zur DDR-Geheimpolizei. Berlin 2015 Translation: Miriamne Fields, Berlin A READER The opinions expressed in this publication reflect solely the views of the authors. Print and media use are permitted ON THE GDR SECRET POLICE only when the author and source are named and copyright law is respected. token fee: 5 euro 2nd edition, Berlin 2018 ISBN 978-3-946572-43-5 6 STATE SECURITY. A READER ON THE GDR SECRET POLICE CONTENTS 7 Contents 8 Roland Jahn 104 Arno Polzin Preface Postal Inspection, Telephone Surveillance and Signal Intelligence 10 Helge Heidemeyer The Ministry for State Security and its Relationship 113 Roger Engelmann to the SED The State Security and Criminal Justice 20 Daniela Münkel 122 Tobias Wunschik The Ministers for State Security Prisons in the GDR 29 Jens Gieseke 130 Daniela Münkel What did it Mean to be a Chekist? The State Security and the Border 40 Bernd Florath 139 Georg Herbstritt, Elke Stadelmann-Wenz The Unofficial Collaborators Work in the West 52 Christian Halbrock 152 Roger Engelmann -
Front Matter
Cambridge University Press 978-1-107-01350-6 - Niemandsland: A History of Unoccupied Germany, 1944–1945 Gareth Pritchard Frontmatter More information Niemandsland Niemandsland is the untold story of the largest and most enduring of the unoccupied enclaves that survived after Germany’s invasion and occupation by Allied forces in 1945. Sandwiched between American and Red Army lines, the 500,000 inhabitants were cut off from the outside world and left to fend for themselves in the face of crippling shortages of food, fuel and housing. Gareth Pritchard charts how groups of Communists, Socialists and antifascists came together to form ‘anti- fascist’ committees which seized power and set about restoring order, ensuring the supply of food and essential services and hunting down, disarming and arresting fugitive Nazis. This is not only a fascinating history in its own right, but it also sheds important new light on the fate of Germany after 1945. Only in Niemandsland do we see what happened when the currents of post-Nazi German politics were allowed to flow freely, unimpeded by Allied intervention. gareth pritchard is Lecturer in Modern History at the University of Adelaide. His previous publications include The Making of the GDR (2004) and, as co-editor, Power and the People: A Social History of Central European Politics, 1945–56 (2005). © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-1-107-01350-6 - Niemandsland: A History of Unoccupied Germany, 1944–1945 Gareth Pritchard Frontmatter More information -

Bulletin 10-Final Cover
COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN 10 61 “This Is Not A Politburo, But A Madhouse”1 The Post-Stalin Succession Struggle, Soviet Deutschlandpolitik and the SED: New Evidence from Russian, German, and Hungarian Archives Introduced and annotated by Christian F. Ostermann I. ince the opening of the former Communist bloc East German relations as Ulbricht seemed to have used the archives it has become evident that the crisis in East uprising to turn weakness into strength. On the height of S Germany in the spring and summer of 1953 was one the crisis in East Berlin, for reasons that are not yet of the key moments in the history of the Cold War. The entirely clear, the Soviet leadership committed itself to the East German Communist regime was much closer to the political survival of Ulbricht and his East German state. brink of collapse, the popular revolt much more wide- Unlike his fellow Stalinist leader, Hungary’s Matyas spread and prolonged, the resentment of SED leader Rakosi, who was quickly demoted when he embraced the Walter Ulbricht by the East German population much more New Course less enthusiastically than expected, Ulbricht, intense than many in the West had come to believe.2 The equally unenthusiastic and stubborn — and with one foot uprising also had profound, long-term effects on the over the brink —somehow managed to regain support in internal and international development of the GDR. By Moscow. The commitment to his survival would in due renouncing the industrial norm increase that had sparked course become costly for the Soviets who were faced with the demonstrations and riots, regime and labor had found Ulbricht’s ever increasing, ever more aggressive demands an uneasy, implicit compromise that production could rise for economic and political support.