Mitteilungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
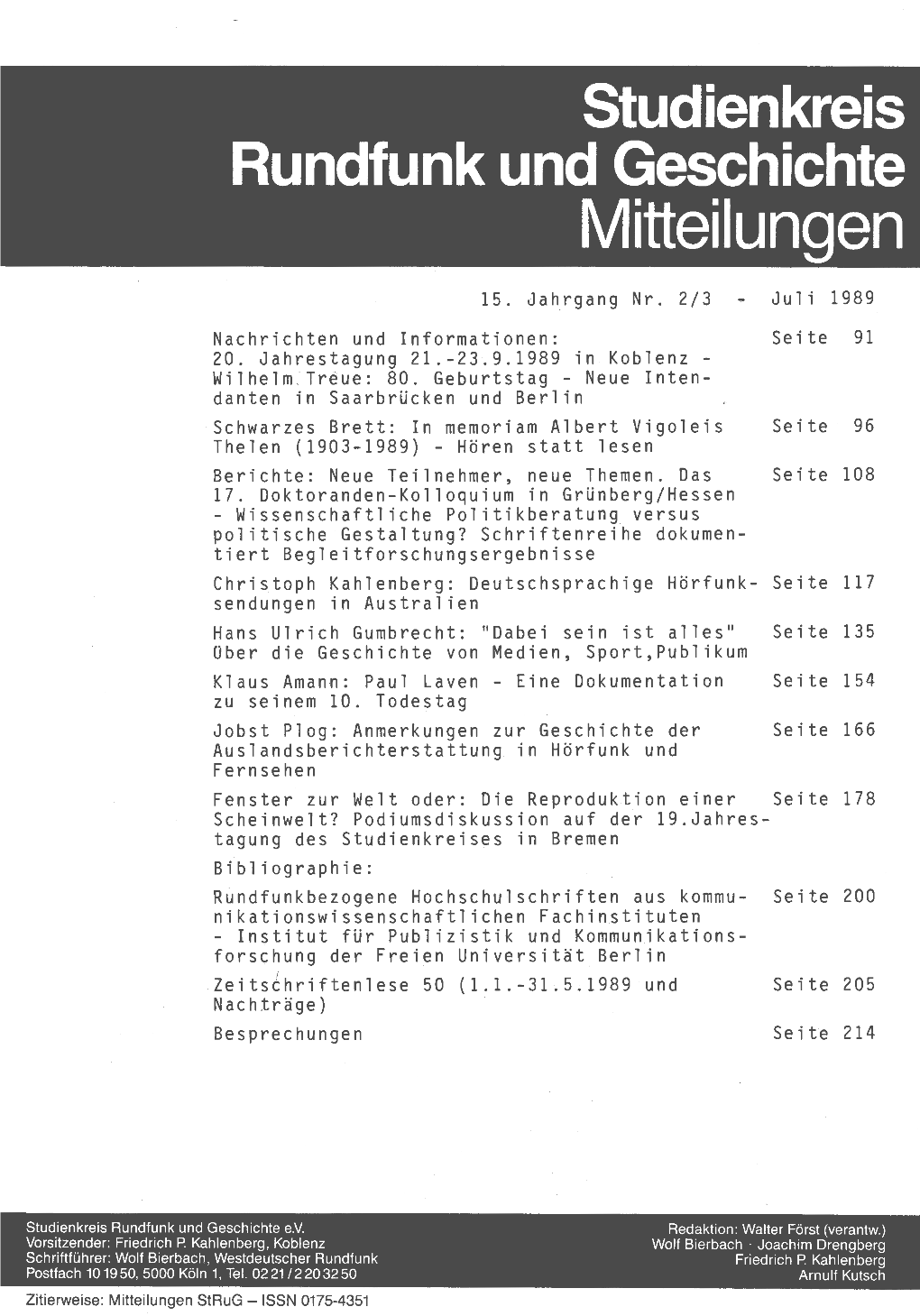
Load more
Recommended publications
-

Presseinformationen
PRESSEINFORMATIONEN Ulrich Kienzle und die Siebzehn Schwaben 320 Seiten mit 18 Farbporträts, gebunden ISBN: 978-3-9812510-4-3 E-Book ISBN: 978-3-9812510-3-6 19,90 € (D) ULRICH KIENZLE UND DIE SIEBZEHN SCHWABEN Was ist schwäbisch? Für Wolfgang Schäuble ist Peer Steinbrück »die Idealbesetzung« eines »Sauschwaben«. Möglicherweise weil er, wie übrigens auch Herta Däubler- Gmelin, davon überzeugt ist, dass bei den Schwaben »eine ganze Menge zusammengeht, was anderswo nicht geht«. Heiner Geißler sagt: »Die Österreicher sind genauso Deutsche wie die Schwaben«. Und Herbert Knaup findet, dass man »mit dem Dialekt näher an der Seele dran ist«. Vielleicht auch, weil »das Schwäbische sehr zärtlich sein kann«, wie Natalia Wörner herausgefunden hat. Vor allem die identitätsstiftende Bedeutung von Sprache zieht sich wie ein roter Faden durch dieses in hohem Maße faszinierende, ungemein informative und humorvolle Buch. Für die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff haben die Dialekte "viel mehr im Gepäck als die Hochsprache". Und wenn der "Sozi" Erhard Eppler sich ausgerechnet auf Ludendorff beruft, der Schauspieler Herbert Knaup beschreibt, wie er sich mit Hilfe der Schauspielerei aus der Sprachlosigkeit seiner Allgäuer Heimat befreiten konnte, der Automobil-Manager Ulrich Bez erzählt, wie er seinen breiten schwäbischen Dialekt seit 40 Jahren über Stationen im "Ausland" als heimatstiftenden Anker bewahrte, dann wird es fast philosophisch. ULRICH KIENZLE UND DIE SIEBZEHN SCHWABEN Ulrich Kienzle ist zurückgekehrt zu seinen Wurzeln. Er, der in seiner langen Journalistenkarriere viele legendäre Interviews geführt hat, unter anderem mit Muammar al-Gaddafi und Saddam Hussein, hat sich auf eine Reise begeben zu eigenwilligen Deutschen. Allesamt Schwaben. Es sind die grundsätzlichen Fragen dieser so grenzenlosen Welt, die auf den Tisch kommen – Orientierung, Heimat und Sprache. -

Inhaltsverzeichnis
READER – Jahreskonferenz 2010 von Netzwerk Recherche – STAND 24.06.2010 Inhaltsverzeichnis Vorwort „Fakten für Fiktionen“ – Wenn Experten die Wirklichkeit dran glauben lassen................................4 Freitag, 9. Juli 2010..........................................................................................................................................5 Ungelöste Finanzkrise – Überforderte Journalisten.............................................................................................................5 Vom Elend des Lokaljournalismus.....................................................................................................................................10 Im Berliner Treibhaus – Medienerfahrungen eines Ministers............................................................................................13 Nestbeschmutzer gesucht – Wer kontrolliert die Journalisten? .........................................................................................14 Schönschreiber in der Kritik: Biegen sich Starreporter die Wirklichkeit zurecht?............................................................15 Schüffeln, Spitzeln, Spionieren: Boulevard-Recherche ohne Grenzen..............................................................................18 Wir haben keine Chance – Nutzen wir sie. Berufseinstieg im Journalismus.....................................................................19 Reporter-Forum: Die Webreportage – Das Genre der Zukunft..........................................................................................20 -

Broschüre Eduard-Rhein-Stiftung 2021.Qxd
EDUARD RHEIN FOUNDATION 2021 EDUARD RHEIN STIFTUNG 2021 Table of Contents: The Foundation and its Committees . 4 Statutes . 6 Foundation Assets and Amount of Awards . 8 Nominations . 10 Award Winners . 11-25 The Eduard Rhein Ring of Honor . 27 The Founder . 28 Managing Chairman from 1990 until 2015. 30 . Eduard Rhein Award Winners 2021 . 32– This brochure contains a number of photographs related to Eduard Rhein’s life and to his Foundation. The history of the Foundation on the Internet: www.Eduard-Rhein-Foundation.de Inhaltsverzeichnis: Die Stiftung und ihre Gremien . 5 Satzung . 7 Stiftungsvermögen und Preishöhe. 9 Nominierungen . 10 Preisträger . 11-25 Der Eduard-Rhein-Ehrenring . 27 Der Stifter . 29 Geschäftsführender Vorstand von 1990 bis 2015 . 31 . Eduard-Rhein-Preisträger 2021 . 32– Diese Broschüre enthält einige Fotos zum Leben Eduard Rheins und zu seiner Stiftung. Die Geschichte der Stiftung im Internet: www.Eduard-Rhein-Stiftung.de 3 The Foundation and its Committees Founded in 1976 Legal Seat Free and Hanseatic City of Hamburg Foundation goals The promotion of scientific research and of learning, according to the the arts, and culture at home and abroad statutory through monetary awards revision of 1989 Management Tannenfleckstraße 30 Headquarters 82194 Groebenzell, Germany www.eduard-rhein-stiftung.de Executive Board Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Grallert (Managing Chairman) Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang M. Heckl, Deutsches Museum and Technical University of Munich Werner Reuß, ARD-alpha Educational and Learning Channel Bayerischer Rundfunk Board of Curators Prof. Dr. Elisabeth André, University of Augsburg Prof. Dr. Norbert Frühauf (Chairman), University of Stuttgart Prof. Dr. Christoph Günther, Institute for Communication and Navigation / German Aerospace Center, Oberpfaffenhofen and Technical University of Munich Prof. -

Im Seichten Kann Man Nicht Ertrinken
Im Seichten kann man nicht ertrinken... ...Medien zwischen Sinn und Sensation Medien-Disput der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 9. November 2000 in Mainz 1 Thomas Leif Macht ohne Verantwortung Der wuchernde Einfluß der Medien und das Desinteresse der Gesellschaft 4 Klaus Rüter Im Seichten kann man nicht ertrinken 12 Hans Leyendecker Die so genannte vierte Gewalt ist oft nur viertklassig 16 Gesprächsrunde – Journalismus am Scheideweg: Farbe bekennen – Service contra Aufklärung Moderation: Miriam Meckel und Uli Röhm Michael Jungblut (WISO-ZDF) diskutiert mit Uwe Jean Heuser (Die Zeit) 22 Michel Friedman (Vorsicht Friedman! – HR) diskutiert mit Ulrich Kienzle (Frontal – ZDF) 30 Uli Röhm (ZDF) diskutiert mit Thomas Kröter (Tagesspiegel) 36 Nach „Big Brother“... – Wohin treibt die Bürgergesellschaft? Kurt Beck befragt von Lucia Braun 41 Thesen zur Medienpolitik Hans Leyendecker Die moralische Macht der Medien – Was kann (investigativer) Journalismus bewirken? 58 Conny Hermann Journalismus am Scheideweg: Farbe bekennen – Service contra Aufklärung 59 Hans-Helmut Kohl Nach der Spendenaffaire – Nur Eitelkeit und Auflage oder Sieg des Journalismus? 61 2 Thomas Kröter Thesen über Medien und Politik in Berlin 63 Klaus Wirtgen MoKoKo – Das Aussitzen geht weiter 65 Walter Hömbeg Forum, Bühne, Beichtstuhl Zur Rolle der Medien in der Parteispenden-Affäre 69 Christoph O. Meyer Europäische Politik ausser Kontrolle? Die Suche nach einer Europäischen Medienöffentlichkeit in Theorie und journalistischer Praxis 74 Thomas Leif Kritischer Journalismus kann die Demokratie beatmen 92 Jochen Markett Investigativer Journalismus „Handwerk statt Zauberei!“ 108 Rundgespräch „Investigativer Journalismus in Deutschland“ 141 Zehn-Punkte-Programm des „netzwerks recherche“ 171 Start in die Informationsfreiheit nur mit angezogener Handbremse? Stellungnahme des Netzwerks Recherche zum Referentenentwurf für das Informationsfreiheitsgesetz 173 Walter Schumacher Nachschlag 177 ReferentInnen und ModeratorInnen des 5. -

Ulrich Kienzle Journalist Im Gespräch Mit Jürgen Seitz Seitz
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks Sendung vom 09.05.2006, 20.15 Uhr Ulrich Kienzle Journalist im Gespräch mit Jürgen Seitz Seitz: Eine Mann, eine Marke. Ein Journalistenleben lang bekam er die Chance, uns zu erklären, wie er die Welt sieht. Jetzt ist er bei uns im alpha-forum, 45 Minuten lang hat er sich Zeit für uns genommen: Herzlich willkommen, Ulrich Kienzle. Kienzle: Guten Tag. Seitz: Herr Kienzle, bevor wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, das Wichtigste nach vorne, wie sich das gehört: Sie sind eine Marke, eine journalistische Marke geworden. Und Sie haben auch ein Markenzeichen, nämlich Ihren Schnäuzer. Wann kommt der ab? Kienzle: Der kommt nicht ab. Den habe ich in einer verzweifelten Phase wachsen lassen, als ich lange Zeit kein Einreisevisum nach Südafrika bekam und immerzu warten musste, bis das Visum endlich kommt. Da habe ich das einfach mal probiert und dann fand ich ihn gut, fand, dass er mir wirklich steht. Und deshalb behalte ich ihn auch. Seitz: Gegen einen, der aussieht wie Sie, sagte Ihr leider verstorbener Partner Bodo Hauser, hat "Amerika mal den Golfkrieg geführt". Ich will dieses treffende Statement gleich mit einem Foto belegen. Sagen Sie uns doch, was Sie hier auf diesem Foto sehen. (Auf dem Foto sind Ulrich Kienzle und Saddam Hussein mit zwei Dolmetschern zu sehen. Ulrich Kienzle wie Saddam Hussein tragen schwarzen Anzug, weißes Hemd, Krawatte und jeder seinen gut sichtbaren schwarzen Schnauzbart, d. Red.) Kienzle: Ja, das war schon eine spannende Stunde in Bagdad kurz vor dem ersten Golfkrieg. Ich habe damals ein Interview mit Saddam gemacht, das auf eine sehr merkwürdige Art und Weise zustande gekommen ist. -

Band 2013.Pdf
DAVO-Nachrichten Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Ori- Band 35 ent für gegenwartsbezogene Forschung und Januar 2013 Dokumentation (DAVO) Sekretariat der DAVO und Die DAVO wurde 1993 als Zusammenschluss Redaktion der DAVO-Nachrichten von Personen gegründet, die sich mit der gegen- Prof. Dr. Günter Meyer wartsbezogenen Forschung und Dokumentation Zentrum für Forschung zur Arabischen Welt zum Vorderen Orient und zu dessen Beziehun- Geographisches Institut der Universität Mainz gen mit anderen Regionen befassen. Unter dem 55099 Mainz Raum Vorderer Orient werden alle Mitglieder Tel.: 06131/3922701 oder 06131/3923446 der Liga der Arabischen Staaten sowie Afghanis- Fax: 06131/3924736 tan, Iran, Pakistan, die Türkei, die islamisch ge- E-Mail: [email protected] prägten Staaten der ehemaligen UdSSR und an- Website: www.davo1.de grenzende Regionen sowie Israel verstanden. Der DAVO gehören mehr als 1500 Wissen- Die DAVO-Nachrichten werden im Auftrag der schaftler, Studierende, Vertreter der Medien, Deutschen Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient Institutionen und andere orientinteressierte Mit- für gegenwartsbezogene Forschung und Doku- glieder an, die überwiegend aus dem deutsch- mentation (DAVO) von Günter Meyer herausge- sprachigen Raum, in steigender Zahl aber auch geben. Sie erscheinen zweimal pro Jahr. Preis aus anderen europäischen Staaten sowie aus dem des Jahresabonnements: Euro 17,- (inklusive Vorderen Orient und Nordamerika stammen. Versandkosten). Preis für Mitglieder ist im Jah- resbeitrag enthalten. Vorsitzender: Prof. Dr. Günter Meyer (Zentrum für Forschung zur Bitte schicken Sie alle Mitteilungen für die DAVO- Arabischen Welt, Universität Mainz) Nachrichten möglichst per E-Mail an die o. a. Adresse Stellvertretende Vorsitzende: der Redaktion. Preisliste für Anzeigen bitte bei der Prof. Dr. Annette Jünemann (Inst. für Internat. -

Verschwiegen, Verschwunden, Verdrängt – Was (Nicht) Öffentlich Wird
VERSCHWIEGEN, VERSCHWUNDEN, VERDRÄNGT – WAS (NICHT) ÖFFENTLICH WIRD Dokumentation Top Ten der vernachlässigten Themen 2002 Die Initiative Nachrichtenaufklärung und das „netzwerk recherche“ stellen einmal im Jahr die Liste der am meisten vernachlässigten Nachrichten und Themen des vergange- Anzeige Colordruck nen Jahres vor. Im Jahr 2002 gab es eine Fülle wichtiger Themen, über die in den Medien unzureichend berichtet wurde. Die Initiative Nachrichtenaufklärung und das „netzwerk recherche“ haben am 15. Februar 2003 die Top Ten der vernachlässigten Themen 2002 vorgelegt. Die Untersuchung und Analyse der Themen wurde von Journalisten, Wissenschaftlern und Studierenden der Journalistik und der Medienwissenschaft vorgenommen. Auf Platz 1 der Liste setzte die Jury das Thema „Vergessene Kriege“. Auch über die Verabreichung von Psychopharmaka an Menschen in Altenheimen wurde nur ungenü- gend informiert. Nur sporadisch berichteten Medien über lebenslänglich Verurteilte, die hinter Gittern vergessen werden. Die weiteren Themen, die mehr Aufmerksamkeit in den Medien verdienen: 1. Vergessene Kriege 2. Altenheime: Pflegeleicht durch Psychopharmaka 3. Lebenslänglich vergessen 4. Unmenschliche Abschiebung 5. Expo-Opfer 6. Schrottplatz Irak 7. Blockade der UNO-Menschenrechts- kommission durch Mitgliedsstaaten 8. Druckmittel UN-Finanzen 9. Risiken von Kindern suchtkranker Eltern 10.Ostdeutsche Kommunen hochverschuldet Weitere Informationen: www.nachrichtenaufklaerung.de www.netzwerkrecherche.de Vorschläge sind willkommen: [email protected] Best solutions for best printing www.colordruck.com Wir arbeiten mit hochmotivierten Leuten und statten sie mit dem besten Equipment aus, wie zum Beispiel der HEIDELBERG Speedmaster, Druckfarben von BASF Drucksysteme und den besten Papieren von Schneidersöhne. Das Resultat ist Schnelligkeit, Präzision, Brillanz und Qualität - vom Druck bis hin zu den neuesten Medien. Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie uns ganz einfach an: 06224-7008-111. -

Sisyphos War Ein Glücklicher Mensch. Über:Morgen
10 Jahre Sisyphos war ein glücklicher Mensch. Über:morgen. Qualitäts-Treiber Recherche. 1./2. Juli 2011, NDR-Konferenzzentrum Hamburg Die Konferenz von Journalisten für Journalisten www.netzwerkrecherche.de Anmeldung: Bitte melden Sie sich ausschließlich via Internet zur Jahreskonferenz an. Das Anmeldeformular finden Sie unter: http://jahreskonferenz.netzwerkrecherche.de Sie erhalten anschließend eine Teilnahmebestätigung per E-Mail. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Überweisung des Teilnehmerbeitrags zeitgleich mit der Anmeldung auf folgendes Konto: netzwerk recherche e. V. , Konto-Nr. 69863, Kreissparkasse Köln, BLZ 37050299 Verwendungszweck: JAHRESKONFERENZ (bitte ausschließlich diesen Verwendungszweck angeben) Journalisten in Ausbildung, Studierende, Volontäre: EUR 30,- nr-Mitglieder: EUR 60,- Nichtmitglieder: EUR 100,- (Kosten für Verpflegung und soft drinks sind enthalten, ausgenommen: alkoholische Getränke) Ã8JSCSBVDIFO+PVSOBMJTUFO EJF)JOUFSHSOEF Wichtig: Bitte bringen Sie die Teilnahmebestätigung und den Überweisungsbeleg (bei Online-Überweisung: USBOTQBSFOUNBDIFOVOE[VHMFJDIGSKFEFO Ausdruck) zur Anmeldung vor Ort mit. WFSTUjOEMJDIGPSNVMJFSFOLzOOFO Unterkünfte in Hamburg sind eigenverantwortlich zu organisieren; Hotelsuche über die Tourist-Information: www.hamburg-tourismus.de %JF;JFMTFU[VOHEFT+PVSOBMJTUFOQSFJTFT Anreise: U2 bis Haltestelle Hagenbecks Tierpark; von dort sind es ca. 5 Gehminuten zum NDR, Hugh-Greene-Weg 1 EFOEJF*/(%J#BFJONBMJN+BISWFSHJCU FOUTQSJDIUNFJOFS7PSTUFMMVOHWPOFJOFN Vorbereitung auf die Konferenz: -

Monika Schwarz-Friesel and Jehuda Reinharz
Monika Schwarz-Friesel and Jehuda Reinharz INSIDE THE ANTISEMITIC MIND The Tauber Institute Series for the Study of European Jewry Jehuda Reinharz, General Editor | ChaeRan Y. Freeze, Associate Editor Sylvia Fuks Fried, Associate Editor | Eugene R. Sheppard, Associate Editor The Tauber Institute Series is dedicated to publishing compelling and innovative approaches to the study of modern European Jewish history, thought, culture, and society. The series features scholarly works related to the Enlightenment, modern Judaism and the struggle for emancipation, the rise of nationalism and the spread of antisemitism, the Holocaust and its aftermath, as well as the contemporary Jewish experience. The series is published under the auspices of the Tauber Institute for the Study of European Jewry—established by a gift to Brandeis University from Dr. Laszlo N. Tauber—and is supported, in part, by the Tauber Foundation and the Valya and Robert Shapiro Endowment. For the complete list of books that are available in this series, please see www.upne.com *Monika Schwarz-Friesel Federica K. Clementi and Jehuda Reinharz Holocaust Mothers and Daughters: Inside the Antisemitic Mind: Family, History, and Trauma The Language of Jew-Hatred in *Ulrich Sieg Contemporary Germany Germany’s Prophet: Paul de Lagarde Elana Shapira and the Origins of Modern Antisemitism Style and Seduction: Jewish Patrons, David G. Roskies and Naomi Diamant Architecture, and Design in Fin de Holocaust Literature: Siècle Vienna A History and Guide ChaeRan Y. Freeze, Sylvia Fuks Fried, -

ULRICH KIENZLE UND DIE FROTZLER „GOTTES SCHÖNSTE GABE“ DER SCHWABE . WIE ER WURDE, WAS ER IST Die Bühnenglosse Zur Zeitenw
ULRICH KIENZLE UND DIE FROTZLER „GOTTES SCHÖNSTE GABE“ DER SCHWABE . WIE ER WURDE, WAS ER IST Die Bühnenglosse zur Zeitenwende in Baden-Württemberg: Ulrich Kienzle begibt sich auf einen historischen Exkurs. Tief dringt er vor in die Geschichte, forscht dort nach den Wurzeln des schwäbischen Charakters – und findet erstaunliche Erklärungen, wie kommen konnte, was geschah. „Wer sind wir?“, fragt er sich. „Wo kommen wir her? Was sind die Wurzeln unserer Macken?“ Mit „wir“ meint er sich. Und seine Landsleute, also die Schwaben. Gemeinsam mit den „ Frotzlern“ präsentiert er ein intelligent-heiteres Pro- gramm, zerlegt die schwäbische Stammesseele humorvoll und unblutig. „Ein rarer Glücksfall, wie Bobbi Fischer, Veit und Gregor Hübner in Kienzles Schwabenprogramm eingebunden sind. Und sie beherrschen Schwäbisch, mit feinen Differenzierungen, nie überdreht, nicht die Spur jener Gaudianer, die meinen, sie müssten württem-bergische Folklore auch außerhalb der Landesgrenzen repräsentieren.“ (Schwäbische Zeitung) Kienzle ist geistreich, subtil giftig, und so wundervoll respektlos gegen jede politische oder klerikale Grenzziehung. Was für eine brillante Analyse des schwäbischen Pietismus! Und er trägt sie mit sardonischem Schmunzeln vor. Er beschäftigt sich mit dem Trink- und dem Sexualverhalten der Schwaben – und dann, das Gros der Kabarettisten in den Schatten stellend, zieht er politische Schlüsse. Wie er Zusammenhänge herstellt, die schwäbische Politik von Späth, über Teufel, Öttinger und Mappus bis zu Kretschmann analysiert und kommentiert und wie er, unterstützt von seinen drei virtuosen Mitstreitern, rappt und singt und Pointe an Pointe setzt, das löst Begeisterungstürme aus. Kein Auge bleibt trocken. Informativ, witzig, intelligent. Ein Abend, weit jenseits der geläufigen „Schwabenfolklore“. Weitgehend auf hochdeutsch. ULRICH KIENZLE UND DIE FROTZLER „GOTTES SCHÖNSTE GABE“ DER SCHWABE . -

Die Fernsehduelle Der Spitzenkandidaten Von SPD Und CDU/CSU Im Bundestagswahlkampf 2002
Die Fernsehduelle der Spitzenkandidaten von SPD und CDU/CSU im Bundestagswahlkampf 2002 Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vorgelegt von Thomas Breuer aus 52 146 Würselen Bonn 2006 Gedruckt mit Genehmigung der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn 1. Berichterstatter: Prof. Dr. Karlheinz Niclauß 2. Berichterstatter: Prof. Dr. Wolfgang Bergsdorf Tag der mündlichen Prüfung: 12. Januar 2006 Diese Dissertation ist auf dem Hochschulschriftenserver der ULB Bonn http://hss.ulb.uni-bonn.de/diss_online elektronisch publiziert 3 Inhaltsverzeichnis: I Einleitung S. 5 II Die These der Amerikanisierung des deutschen Wahlkampfs S. 9 III Wahlkampfführung und Massenmedien a) Medien und Demokratie S. 14 b) Die Rolle der Massenmedien im modernen Wahlkampf S. 24 c) Wahlkampftaktik und Wählerverhalten in der Mediengesellschaft S. 28 d) Die Funktion politischer Diskussionen im Fernsehen S. 40 IV Vorbilder für die TV-Duelle a) Die Presidential Debates in den USA S. 45 b) Die Elefantenrunden in der Bundesrepublik Deutschland S. 54 V Die TV-Duelle im Bundestagswahlkampf 2002 a) Die Planungen und Vorbereitungen der beiden TV-Duelle S. 63 b) Die politische Ausgangssituation vor den TV-Duellen S. 74 c) Der Verlauf des ersten TV-Duells bei RTL und SAT 1 S. 81 d) Die Diskussionen und Entwicklungen zwischen den beiden TV-Duellen S. 89 e) Der Verlauf des zweiten TV-Duells bei ARD und ZDF S. 95 VI Die Nachberichterstattung über die TV-Duelle im Fernsehen und den Printmedien a) Die Bedeutung der veröffentlichten Bewertungen und Kommentare S. 104 b) Die Berichterstattung über die TV-Duelle in den deutschen Medien S. -

Videosammlung Des Südasien-Instituts
VIDEOSAMMLUNG DES SÜDASIEN-INSTITUTS (Inventarliste: die ersten vier Ziffern sind die Signatur-Nummern, die Ziffern nach dem Komma geben die Nummer des Beitrags auf dem Band an) Hinweis: Wiederholt ausgestrahlte Sendungen können sich durch Länge und Wiedergabequalität unterscheiden. Stand: 1. November 2004 Die Sammlung geht auf eine private Initiative von Stephanie Zingel-Avé Lallemant (1946- 1998) zurück, die Sendungen auf der Grundlage der Ankündigungen in Programmzeitschriften auswählte, sie aufnahm, bibliographisch bearbeitete und ein Verzeichnis erstellte. M 1147 Naam / Directed by Mahesh Bhatt. 0.00-2.40. [Spielfilm, in Hindi] M 1151 Mandi (Market Place) / Shyam Bengal. Blaze film enterprise. 0.00-2.43 [danach Werbung für andere Filme]. [Spielfilm, in Hindi] M 1200,1 Mrinal Sen, ein indischer Filmemacher: Der lächelnde Tiger von Bengalen / Ein Filmforum von Jörn Thiel. © ZDF 1987; Sendetermin: 4.3.1987. 0.04-0.48. [Indien: Dokumentarfilm, Filmgeschichte] M 1201,1 Genesis / Mrinal Sen. © SDR. 0.00-1.40. [Spielfilm, Indien 1986; Schauplatz: Indien: pol, soz, Zeitgeschichte] M 1202,1 Träume in Kalkutta (Chaalchitra) / Mrinal Sen. ZDF. 0.00-1.21. [Spielfilm, Indien 1981] M 1203,1 Ein ganz gewöhnlicher Tag / Mrinal Sen. ZDF. 0.01-1.22. [Spielfilm, Indien 1980; soz, Zeitgeschichte] Videosammlung des SAI, Inventarliste, Stand 1.11.2004 2 M 1204,1 Die Suche nach der Hungersnot / Mrinal Sen. ZDF. 0.03-2.37. [Indien, Spielfilm 1980 : alle Fächer, Zeitgeschichte] M 1205,1 Dorf im Wandel / Lester James Peries. Spielfilm-Trilogie, Sri Lanka. 2. Weiße Blumen für die Toten (1970). ARD1+. 0.01-1.52. [Sri Lanka: his, soz, Zeitgeschichte] M 1206,1 Der Schatz (Nidhanaya) / Lester James Peries nach einem Roman von G.B.