Modellierung Des Sulfattransportes in Der Spree Mit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
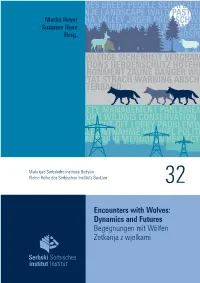
Encounters with Wolves
Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen 32 Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami 32 · 2020 Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami © 2020 Serbski institut Budyšin Sorbisches Institut Bautzen Dwórnišćowa 6 · Bahnhofstraße 6 D-02625 Budyšin · Bautzen Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž T +49 3591 4972-0 dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na F +49 3591 4972-14 zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych www.serbski-institut.de wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborska a Sakskeho krajneho sejma. [email protected] Gefördert durch die Stiftung für das sorbische Redakcija Redaktion Volk, die jährlich auf der Grundlage der von den Marlis Heyer, Susanne Hose Abgeordneten des Deutschen Bundestages, des Landtages Brandenburg und des Sächsischen Wuhotowanje Gestaltung Landtages beschlossenen Haushalte Zuwen- Ralf Reimann, Büro für Gestaltung, dungen aus Steuermitteln erhält. Bautzen Ćišć Druck Grafik S. 33 unter Verwendung eines 32 Union Druckerei Dresden GmbH Scherenschnitts von Elisabeth Müller, Collmen Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin ISBN 978-3-9816961-7-2 Grafik S. 87 nach GEO-Karte 5/2018 Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Page Content 5 Marlis Heyer and Susanne Hose Vorwort · Preface 23 Emilia -

Gate to the Nature Park Moor, Which Is Highly Endangered in Germany
tats and working together with volunteers in observing rare Ice Age species. The nature park works together with local partners to organize ecologically-sound and sustainable cultivation on The face of the landscape in the eastern Brandenburg heath- the Schlaube and the orchid meadows on the Reicherskreuzer land and lake area was formed in the Brandenburg stage of Heide, just to name one example. The very sparsely inhab- the Weichselian glaciation, which began 90,000 years ago. The ited nature park, with its agricultural history, has three large break-up of the ice created the elements which today dominate farms and several pasturing facilities that take up just under the landscape: the meltwater channel system, the Schlaube, one-fifth of the area. The former mills in the Schlaube, Oelse Ölse, and Demnitz, and the outwash plains near Reicherskreuz. Marsh Helleborine Boloria aquilonaris and Dorche valleys contribute striking testimony to the cultural The valley of the Schlaube and the Reicherskreuz heathland history of the nature park with its 21 villages and the small form the heart of the nature park. They are complemented by and the Boberschenk as well as the Planfließ further to the large piece of gold, on which one could see a crowned snake. town of Müllrose. The mills were built starting in the 15th the Dorchetal (Dorche Valley) with its transitions to the flood- north. Near-natural sessile oak and pine mixed forests grow Grass snakes still teem on the Wirchenwiesen. But the wealth century, but have now been long out of use. They are part plain landscape of the Oder and Nieße and to the south by the on some spots in the Schlaubetal, such as in the Teufelssee of the Schlaubetal is not measured in gold alone. -

Die Sensiblen Fließgewässer Des Landes Brandenburg – 5
62 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE IN BRANDENBURG 9 (2) 2000; 62 – 72 EINST DURCH EINTRÄGE DER INDUSTRIE UND INTENSIVEN LANDWIRTSCHAFT STARK GESCHÄDIGTE BIOZÖNOSEN UNSERER GROSSEN FLIESSGEWÄSSER WIE ODER UND NEISSE LASSEN ERKENNEN, DASS EINE WIEDERBESIEDLUNG DURCH ARTEN DES MAKROZOOBENTHON AUS REFUGIEN IN VOLLEM GANGE IST. ROLF SCHARF, DIETRICH BRAASCH Die sensiblen Fließgewässer des Landes Brandenburg – 5. Beitrag zu ihrer Erfassung und Bewertung – Landkreise Dahme-Spreewald und Oder-Spree, kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) Schlagwörter: Fließgewässer, Bewertungskriterien, Schutzwertstufen, Fauna, Aufwertungsmaßnahmen 1. Einleitung liegen die naturräumlichen Haupteinheiten Die Hauptgewässer nach diesem System, die Berlin-Fürstenberger Spreetalniederung, Saa- Lebensraum für die natürlichen Lebensge- In Fortsetzung vorangegangener Beiträge rower Hügel, Beeskower Platte und Fürsten- meinschaften sichern, sind Dahme, Schlaube, (SCHARF u. BRAASCH 1997, 1998) ging die berger Odertal. Zum Landkreis Oder-Spree Spree und Lausitzer Neiße. Die beiden letzt- Aufgabenstellung von einer Erfassung, Be- gehören außerdem Randgebiete der Ost- genannten Flüsse haben gleichzeitig Haupt- probung und Bewertung sensibler Fließge- brandenburgischen Platte mit Teilen der Le- und Verbindungsgewässerfunktion. wässer auf der Grundlage des Makrozoo- buser Platte im Norden und des Odertals im Als ebenfalls ökologisch wertvolles Fließge- benthon und einem 5-stufigen Bewertungs- Osten. wässer, das im Bedarfsfall auch Hauptgewäs- system (BRAASCH 1995); BRAASCH, Im Landkreis Dahme-Spreewald sind im serfunktion ausüben könnte, ist die Berste zu SCHARF; KNUTH 1993) aus. Wiederum Westen und Süden Anteile der Mittelbran- nennen. wurden zwei naturräumlich im Zusammen- denburgischen Platten und Niederungen hang stehende Kreise einschließlich der kreis- (Teltow-Platte und Baruther Urstromtal), des 3.2 Gewässergüte und freien Stadt Frankfurt (O.) bei der Darstel- Lausitzer Becken- und Heidelandes (Raum ökomorphologische Situation lung der Ergebnisse zusammengefasst. -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe
G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

Vulnerabilitätsanalyse Oberlausitz-Niederschlesien
TU Dresden, Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung: Vulnerabilitätsanalyse Region Oberlausitz-Niederschlesien Auftraggeber: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Dresden 2011 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vulnerabilitätsanalyse Oberlausitz-Niederschlesien TU Dresden, Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung Projektleitung: Prof. Dr. Catrin Schmidt Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. J. Kolodziej, Dipl.-Ing. A. Seidel Auftraggeber: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Dresden 2011 TU Dresden, Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung: Vulnerabilitätsanalyse Region Oberlausitz-Niederschlesien Auftraggeber: Regionaler Planungsverband -

University of Bath PHD Nature and Technology in GDR Literature
University of Bath PHD Nature and technology in GDR literature Tomlinson, Dennis Churchill Award date: 1993 Awarding institution: University of Bath Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 23. May. 2019 NATURE AND TECHNOLOGY IN GDR LITERATURE NATURE AND TECHNOLOGY IN GDR LITERATURE submitted by Dennis Churchill Tomlinson for the degree of PhD of the University of Bath 1993 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis rests with its author. This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with its author and that no quotation from the thesis and no information derived from it may be published without the prior written consent of the author. This thesis may be made avilable for consultation within the University Library and may be photocopied or lent to other libraries for the purposes of consultation. -

Braunkohlenplan Als Sanierungsrahmenplan Für Den Stillgelegten Tagebau Trebendorfer Felder
Braunkohlenplan als Sanierungsrahmenplan für den stillgelegten Tagebau Trebendorfer Felder Regionaler Planungsverband Oberlausitz - Niederschlesien Regionalny zwjazk planowanja Hornja Łužica - Delnja Šleska INTERNETFASSUNG Impressum: Der vorliegende Plan wurde im Auftrag des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Nie- derschlesien von der Regionalen Planungsstelle Bautzen erarbeitet. Anschrift: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Postfach 1343 02603 Bautzen www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de INTERNETFASSUNG Vorwort Der Geltungsbereich des vorliegenden Braunkohlenplanes befin- det sich im Nordosten unserer Planungsregion im Randbereich des Muskauer Faltenbogens. In diesem Gebiet begann Mitte des 19. Jahrhunderts kleinräumig der Abbau der oberflächig anstehen- den Braunkohle. Im so genannten Tagebau Trebendorfer Felder, dessen Sanierung Gegenstand dieses Planes ist, wurde im Zeit- raum zwischen 1949 und 1969 Braunkohle abgebaut. Aus den verbliebenen Restlöchern haben sich nach dem Ende der Bergbautätigkeit durch das aufgehende Grundwasser Seen ge- bildet. Der größte unter ihnen, der Halbendorfer See, und seine Umgebung haben sich bereits seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu einem beliebten Erholungsstandort und landschaftlichen Kleinod entwickelt. Allerdings mussten grö- ßere Bereiche des ehemaligen Tagebaugebietes gegen Befahren und Betreten gesperrt wer- den, nachdem Rutschungen die Instabilität vieler Uferböschungen belegt hatten. Der vorliegende Braunkohlenplan bildet nun die Grundlage für die -

Verlässlich Erfolgreich
Verlässlich erfolgreich Nutzenbilanz 2020 Sparkasse Oder-Spree 1 Herausgeber: Sparkasse Oder-Spree, Der Vorstand Franz-Mehring-Straße 22, 15230 Frankfurt (Oder) www.s-os.de Konzeption / Gestaltung: Giraffe Werbeagentur, www.giraffe.de Fotos: Tobias Tanzyna (Titelseite, Seiten 4, 6, 8 bis 10, 12 bis 27) Winfried Mausolf (Seiten 28 bis 31 unten) Andreas Peikert (Seite 31 oben) Sparkasse Oder-Spree (Seite 11) Titelfoto: Waldschule „Am Rogge-Busch“, Müllrose Roland Boljahn, Leiter Waldschule (hinten oben) Bennet Radau (l.) Tom Robert (mittig) Marie Zobel (r.) Im Rahmen eines Besuches von Schülern / -innen der Integrativen Katholischen Grundschule Neuzelle besuchten auch die drei auf dem Titelfoto abgebildeten Kinder im August 2020 die Waldschule. Sie entdeckten viel Interessantes. Gespendet von der Sparkasse erhielten sie auch je ein Exemplar der neuesten Ausgabe vom „Waldbuch Grünli“. Jedes Jahr wird die Waldschule in Müllrose von Vor- oder Schulkindern besucht. Jährlich kommen knapp 6.500 Kinder, 2020 waren es (coronabedingt) nur über 3.500 Kinder. Roland Boljahn hat viel Spaß an dieser Aufgabe, denn die Kinder lernen im Rahmen des Besuches eine Menge über die Natur und ihren Schutz. Auflage: 600 Stück März 2021 2 Nutzenbilanz 2020 Inhalt 4 Vorwort Verwaltungsrat – Sparkasse – verlässlich erfolgreich seit 198 Jahren 6 Vorwort Vorstand – verlässlich zukunftsorientiert 8 Geschäftsentwicklung – verlässliche Marktstärke und Konstanz 15 Verlässlich im Land Brandenburg 16 Verlässlich Touristen begleiten 18 Verlässlich Kultur erleben 20 Verlässlich Sport treiben 22 Verlässliche Wissenschaft 24 Verlässlich soziale Betreuung 26 Verlässlich die Natur schützen 28 Verlässlich ehrenamtlich aktiv 32 Verlässliche Geschäftsentwicklung im Überblick 34 Bilanz 2020 37 Sparkassenorgane 3 Sparkasse – verlässlich erfolgreich seit 198 Jahren Vorwort Das Geschäftsjahr 2020 war von Liebe Kundinnen und Kunden der Dass die weiterhin anhaltende Nied- „Corona“ besonders gezeichnet. -

Nachweis Der Wasserverfügbarkeit Für Die Herstellung Der Ökologischen Durchgängigkeit Im Land Brandenburg
Nachweis der Wasserverfügbarkeit für die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Land Brandenburg im Auftrag des Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg (Dezember 2013) Teil II Nachweis der Wasserverfügbarkeit für alle überregionalen und regionalen Vorranggewässer www.fotosuche.info biota biota Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH Dr. Bernd Pfützner Teilbericht II - Nachweis der Wasserverfügbarkeit für alle Vorranggewässer in Brandenburg Auftragnehmer & Bearbeitung: Auftraggeber: Dr. rer.nat. Tim G. Hoffmann Christiane Koll M.Sc. Sebastian Sedlmeir (Ansprechpartner und Koordination) biota – Institut für ökologische Forschung Landesamt für Umwelt, Gesundheit und und Planung GmbH Verbraucherschutz Brandenburg Nebelring 15 Seeburger Chaussee 2 18246 Bützow 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke Telefon: 038461/9167-34 Telefax: 038461/9167-55 Telefon: 033201/442-293 email: [email protected] Telefax: 033201/442-662 Internet: www.institut-biota.de email: Dr. Bernd Pfützner [email protected] M.Sc. Anne Schumann Internet: http://www.brandenburg.de/LUGV Büro für Angewandte Hydrologie, (BAH) Köberlesteig 6 13156 Berlin Telefon: (030) 499 137 02 e-Mail: [email protected] Internet: www.bah-berlin.de Vertragliche Grundlage: Bützow, den 01.10.2012 Dr. rer. nat. Dr. agr. Dietmar Mehl - Geschäftsführer - Institut biota & BAH – Büro für Angewandte Hydrologie 2013 2 Teilbericht II - Nachweis der Wasserverfügbarkeit für alle Vorranggewässer in Brandenburg Abkürzungsverzeichnis ....................................................................... -

Lust Auf Natour 2019
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz BRANDENBURGS GROSSSCHUTZGEBIETE ERLEBEN Lust auf NaTour 2 INHALT Inhalt Nordwest, West, Südwest Fotonachweise 4 Naturpark Nuthe-Nieplitz Wildnis vor den Toren r e k c Editorial der Metropole 96 U Brandenburg – natürlich abenteuerlich 5 Naturpark Prenzlau Naturpark Hoher Fläming z it n e Unter- p e Ucker- Brandenburgs Großschutzgebiete Land der Ritterburgen, Rummeln t ucker- S z t see i Mescherin n Lychen märkische Gartz Kostproben vom Tafelsilber 6 und Riesensteine 104 k Moorblick c ö L Naturpark- (Oder) Rambow Augustablick Besucherzentrum Pritzwalk verwaltung Ober- Wittstock/ Maronstein Fenchelberg Gartz (Oder) Burg Lenzen Moorblick Dosse Fürstenberg/ uckersee Boberow Stechlin- Seen W Naturwacht Brandenburg Naturpark Westhavelland Brackwasser Naturpark Havel el Besandten see Templin Spitzberg se Lenzen Perleberg Rheins- z Stechlin- Ausgezeichnete Arbeit Wasser, Hügel und berühmte Flieger 112 Burgwall t Rückdeichung i Menz Nabu-Informations- Beob.-Hütte l berg Densowsee Kietz Lenzen e g bei Gatow Weichholzaue n ä UNESCO - J zentrum a Ruppiner für Mensch und Natur 7 h NaturParkHaus Schwedt/ Cumlosen t UNESCO - r el a av Biosphärenreservat Blumberger Mühle Polder B K Land Stechlin H Oder UNESCO- Biosphärenreservat Sielmann- bei Schwedt/Oder Biosphärenreservat Witten- Hügel Zanderblick berge Bad Lindow Am Melln National- Nord, Ost Flusslandschaft Elbe-Brandenburg Flusslandschaft Wilsnack Mühlenberg Criewen Groß Leppin (Mark) Gransee Schorfheide- Anger- parkhaus Elbe-Brandenburg Neu- -

Naturpark Schlaubetal Vor
Eiszeit Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern bei der Beob- achtung ausgewählter Arten. Mit örtlich ansässigen Partnern Das Antlitz der im Ostbrandenburgischen Heide- und Seen gebiet arbeitet der Naturpark zusammen, um beispielsweise auf gelegenen Landschaft hat sich im Brandenburger Stadium der den Reicherskreuzer Heideflächen, den Schlaube- und Weichseleiszeit herausgebildet, die vor 90.000 Jahren begann. Orchideenwiesen eine naturgerechte und nachhaltige Bewirt- Mit dem Zerfall des Eises entstanden die heute landschafts- schaftung zu organisieren. Im landwirtschaftlich geprägten, prägenden Elemente: das Schmelzwasserrinnensystem der sehr dünn besiedelten Naturparkgebiet wird heute auf knapp Schlaube, Oelse und Demnitz und die Sanderflächen bei Rei- Echte Sumpfwurz Hochmoor-Perlmutterfalter einem Fünftel der Fläche von drei größeren Agrarbetrieben und cherskreuz. Das Tal der Schlaube und die Reicherskreuzer Hei- einigen Wiedereinrichtern Landwirtschaft betrieben. Auffälliges de bilden das Herz des Naturparks. Sie werden im Osten durch Zeugnis der Kulturgeschichte des Naturparks mit seinen 21 zu finden. An einigen Stellen im Schlaubetal, u.a. im Natur- Ringelnattern tummeln sich noch heute in den Wirchenwiesen. das Dorchetal mit seinen Übergängen zur Auenlandschaft von Dörfern und der Kleinstadt Müllrose sind die ehemaligen Müh- schutzgebiet Teufelssee bei Schernsdorf, wachsen naturnahe Doch der Reichtum des Schlaubetals wird nicht allein in Gold Oder und Neiße und nach Süden durch das Gubener Naherho- len des Schlaube-, des Oelse- und des Dorchetals. Seit dem Traubeneichen-Kiefern- Mischwälder. In diesem Bereich, in aufgewogen. Die Vielgestaltigkeit der Landschaft hat eine Fülle lungsgebiet mit seinen vielen Badeseen ergänzt. 15. Jahrhundert entstanden, findet in ihnen heute längst kein dem die Schlaube eine Kette von Seen durchfließt, sind auch unterschiedlichster Lebensräume hervorgebracht, die den An- Mühlbetrieb mehr statt. -

Ökologische Charakterisierung Der Wichtigsten Brutgebiete Für Wasservögel in Brandenburg
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg Landesumweltamt Brandenburg Referat Umweltinformation/Öffentlichkeitsarbeit Band 57 Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke Tel: (033201) 442 171 Fax: (033201) 43678 E-Mail: [email protected] www.mluv.brandenburg.de/info/lua-publikationen Studien und Tagungsberichte Studien und Studien und Tagungsberichte des Landesumweltamtes Band 57 Ökologische Charakterisierung der wichtigsten Brutgebiete für Wasservögel in Brandenburg Studien und Tagungsberichte des Landesumweltamtes Band 57 Ökologische Charakterisierung der wichtigsten Brutgebiete für Wasservögel in Brandenburg Studien und Tagungsberichte, Schriftenreihe - ISSN 0948-0838 Herausgeber: Landesumweltamt Brandenburg (LUA) Seeburger Chaussee 2 OT Groß Glienicke 14476 Potsdam Tel.: +4933201 442 171 Fax: +4933201 43678 Bestelladresse: E-Mail: [email protected] Band 57 Ökologische Charakterisierung der wichtigsten Brutgebiete für Wasservögel in Brandenburg Bearbeitung: Das Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung des LUA im Rahmen eines Werk- vertrages aus 2007 durch den Förderverein Wasservogelökologie und Feuchtgebiets- schutz e. V. (Buckower Dorfstraße 34, 14715 Nennhausen, OT Buckow) bearbeitet und mit Ergebnisbericht abgeschlossen / Dr. habil. Lothar Kalbe, Stücken, unter Mit- arbeit von Matthias Körner, Luckenwalde (Kartenmaterial) Fachlicher Ansprechpartner: LUA, Ref. Ö2 Natura2000, Arten-