32 Muskauer Heide (MHE)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
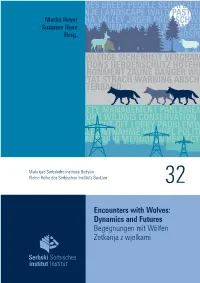
Encounters with Wolves
Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen 32 Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami 32 · 2020 Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami © 2020 Serbski institut Budyšin Sorbisches Institut Bautzen Dwórnišćowa 6 · Bahnhofstraße 6 D-02625 Budyšin · Bautzen Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž T +49 3591 4972-0 dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na F +49 3591 4972-14 zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych www.serbski-institut.de wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborska a Sakskeho krajneho sejma. [email protected] Gefördert durch die Stiftung für das sorbische Redakcija Redaktion Volk, die jährlich auf der Grundlage der von den Marlis Heyer, Susanne Hose Abgeordneten des Deutschen Bundestages, des Landtages Brandenburg und des Sächsischen Wuhotowanje Gestaltung Landtages beschlossenen Haushalte Zuwen- Ralf Reimann, Büro für Gestaltung, dungen aus Steuermitteln erhält. Bautzen Ćišć Druck Grafik S. 33 unter Verwendung eines 32 Union Druckerei Dresden GmbH Scherenschnitts von Elisabeth Müller, Collmen Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin ISBN 978-3-9816961-7-2 Grafik S. 87 nach GEO-Karte 5/2018 Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Page Content 5 Marlis Heyer and Susanne Hose Vorwort · Preface 23 Emilia -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe
G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

Vulnerabilitätsanalyse Oberlausitz-Niederschlesien
TU Dresden, Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung: Vulnerabilitätsanalyse Region Oberlausitz-Niederschlesien Auftraggeber: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Dresden 2011 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vulnerabilitätsanalyse Oberlausitz-Niederschlesien TU Dresden, Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung Projektleitung: Prof. Dr. Catrin Schmidt Projektbearbeitung: Dipl.-Ing. J. Kolodziej, Dipl.-Ing. A. Seidel Auftraggeber: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Dresden 2011 TU Dresden, Lehr- und Forschungsgebiet Landschaftsplanung: Vulnerabilitätsanalyse Region Oberlausitz-Niederschlesien Auftraggeber: Regionaler Planungsverband -

University of Bath PHD Nature and Technology in GDR Literature
University of Bath PHD Nature and technology in GDR literature Tomlinson, Dennis Churchill Award date: 1993 Awarding institution: University of Bath Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 23. May. 2019 NATURE AND TECHNOLOGY IN GDR LITERATURE NATURE AND TECHNOLOGY IN GDR LITERATURE submitted by Dennis Churchill Tomlinson for the degree of PhD of the University of Bath 1993 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis rests with its author. This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with its author and that no quotation from the thesis and no information derived from it may be published without the prior written consent of the author. This thesis may be made avilable for consultation within the University Library and may be photocopied or lent to other libraries for the purposes of consultation. -

Braunkohlenplan Als Sanierungsrahmenplan Für Den Stillgelegten Tagebau Trebendorfer Felder
Braunkohlenplan als Sanierungsrahmenplan für den stillgelegten Tagebau Trebendorfer Felder Regionaler Planungsverband Oberlausitz - Niederschlesien Regionalny zwjazk planowanja Hornja Łužica - Delnja Šleska INTERNETFASSUNG Impressum: Der vorliegende Plan wurde im Auftrag des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Nie- derschlesien von der Regionalen Planungsstelle Bautzen erarbeitet. Anschrift: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Postfach 1343 02603 Bautzen www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de INTERNETFASSUNG Vorwort Der Geltungsbereich des vorliegenden Braunkohlenplanes befin- det sich im Nordosten unserer Planungsregion im Randbereich des Muskauer Faltenbogens. In diesem Gebiet begann Mitte des 19. Jahrhunderts kleinräumig der Abbau der oberflächig anstehen- den Braunkohle. Im so genannten Tagebau Trebendorfer Felder, dessen Sanierung Gegenstand dieses Planes ist, wurde im Zeit- raum zwischen 1949 und 1969 Braunkohle abgebaut. Aus den verbliebenen Restlöchern haben sich nach dem Ende der Bergbautätigkeit durch das aufgehende Grundwasser Seen ge- bildet. Der größte unter ihnen, der Halbendorfer See, und seine Umgebung haben sich bereits seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu einem beliebten Erholungsstandort und landschaftlichen Kleinod entwickelt. Allerdings mussten grö- ßere Bereiche des ehemaligen Tagebaugebietes gegen Befahren und Betreten gesperrt wer- den, nachdem Rutschungen die Instabilität vieler Uferböschungen belegt hatten. Der vorliegende Braunkohlenplan bildet nun die Grundlage für die -

Modellierung Des Sulfattransportes in Der Spree Mit
G.E.O.S. Modellierung des Sulfattransportes Ingenieurgesellschaft mbH in der Spree 09633 Halsbrücke Gewerbepark „Schwarze Kiefern“ 09581 Freiberg, Postfach 1162 Telefon: +49(0)3731 369-0 Telefax: +49(0)3731 369-200 Berichtsversion für das E-Mail: [email protected] Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver- www.geosfreiberg.de braucherschutz Brandenburg Projekt-Nr. 301 000 51 Geschäftsführer: Jan Richter Titelfoto: Spree unterhalb Neundorfer See (Alt Schadow) Beiratsvorsitzender: Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver- Dr. Horst Richter braucherschutz Brandenburg HRB 1035 Amtsgericht Von-Schön-Str. 7 Registergericht Chemnitz 03050 Cottbus Sparkasse Mittelsachsen Konto 3115019148 BLZ 870 520 00 Deutsche Bank AG Freiberg Halsbrücke, den 30.11.2010 Konto 2201069 BLZ 870 700 00 USt.-IdNr. DE811132746 Modellierung des Sulfattransportes LUGV Brandenburg in der Spree Auftraggeber: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver- braucherschutz Brandenburg Von-Schön-Str. 7 03050 Cottbus Projekt-Nr. G.E.O.S.: 301 000 51 Bearbeitungszeitraum: 01.04.2010 bis 09.11.2010 Bearbeiter: Dr. Eberhard Janneck (Projektleiter) Dipl.-Chem. Mirko Martin, Dipl.-Geoinf. Susan Renker, Dr. Renè Kahnt Seitenanzahl Text: 74 Anzahl der Anlagen: 3 Dateiversion 2011-01-21_Bericht-BB-EV4.doc EV4.doc - BB Halsbrücke, den 30.11.2010 - 21 Bericht - 01 - 2011 \ Berlin i. A. für Jan Richter Dr. Eberhard Janneck Geschäftsführer FBL Verfahrensentwicklung/ 011 Nacharbeit Biotechnologie \ 01 Texte \ Berlin Senatsverwaltung - 30100060 \ Lw O von Projekte \ Janneck \ -

A-Bericht FGG Elbe
Zusammenfassender Bericht der Flussgebietsgemeinschaft Elbe über die Analysen nach Artikel 5 der Richtlinie 2000/60/EG (A-Bericht) Herausgeber: Flussgebietsgemeinschaft Elbe Freistaat Bayern Land Berlin Land Brandenburg Freie und Hansestadt Hamburg Land Mecklenburg-Vorpommern Land Niedersachsen Freistaat Sachsen Land Sachsen-Anhalt Land Schleswig-Holstein Freistaat Thüringen Bundesrepublik Deutschland - I - Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis IV Tabellenverzeichnis VI Abkürzungsverzeichnis VIII Verzeichnis der Tabellen im Anhang 1 X Verzeichnis der Karten im Anhang 2 XI 1 Einführung 1 1.1 Grundsätze 1 1.2 Vorgehensweise 2 1.3 Beschreibung der bisherigen nationalen und internationalen Arbeiten und Aktivitäten zum Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe 3 1.4 Berichtsaufbau 6 2 Beschreibung des deutschen Teils der Flussgebietseinheit Elbe 7 2.1 Geographischer Überblick der Flussgebietseinheit (Anh. I ii) 7 2.2 Aufteilung des deutschen Teils der FGE Elbe in Koordinierungsräume 15 3 Zuständige Behörden (Anh. I i) 16 3.1 Rechtlicher Status der zuständigen Behörden (Anh. I iii) 16 3.2 Zuständigkeiten (Anh. I iv) 18 3.3 Koordinierung mit anderen Behörden (Anh. I v) 19 4 Analyse der Merkmale der Flussgebietseinheit und Überprüfung der Umweltauswirkungen menschlicher Tätigkeiten (Art. 5 Anh. II) 20 4.1 Oberflächengewässer (Anh. II 1) 20 4.1.1 Beschreibung der Typen der Gewässer und der Ausweisung der Wasserkörper 20 4.1.1.1 Ausweisung der Wasserkörper 20 4.1.1.2 Grundlagen der Typisierung nach EG-WRRL 20 4.1.2 Typspezifische Referenzbedingungen und höchstes ökologisches Potenzial (Anh. II 1.3 i bis iii und v bis vi) 24 4.1.3 Bezugsnetz für Gewässertypen mit sehr gutem ökologischen Zustand (Anh. II 1.3 iv) 26 4.1.4 Vorläufige Ausweisung künstlicher und erheblich veränderter Wasserkörper 27 4.1.5 Belastungen der Oberflächenwasserkörper (Anh. -

The Impact of the Kohleausstieg
“The Power of Art to Break Despair”: The Impact of the Kohleausstieg on the German Imagination Anne Zong Schnitzer Submitted in Partial Fulfillment of the Prerequisite for Honors in German Studies under the advisement of Professors Anjeana Hans and Elizabeth DeSombre April 2018 © 2018 Anne Schnitzer Acknowledgements There are many people who made this project possible and to whom I am enormously grateful. First and foremost, I would like to thank my advisors, Professors Anjeana Hans and Beth DeSombre for their invaluable guidance and sage counsel. I also am extremely indebted to the other members of the German Department—Professors Thomas Nolden and Mark Römisch—whose gentle but firm insistence on a humanities-based thesis introduced me to a field outside my comfort zone that I would not otherwise have entered. I learned a great deal about my research subject and also about myself. My profound thanks to Dr. Peter Droege of the Liechtenstein Institute for Strategic Development whose willingness to take me on as an intern in Berlin in the summer of 2017 provided the basis for my thesis work. In this regard I am indebted to Professor Sherman Teichman for introducing me to Dr. Droege and for his ongoing support. I also thank my dear friend Douglass Hansen for the logistical assistance he provided during my fieldwork. I want to express my sincere thanks to the Pamela Daniels Fellowship Committee and the German Academic Exchange Service (Deutscher Akademischer Austauschdienst), which provided research grants that funded the fieldwork phase of my thesis. A special note of thanks to Pamela Daniels whose support and kindness will not be forgotten. -

Darstellung Der Bewirtschaftungsziele Für Die Vom Braunkohlenbergbau Beeinflussten Grundwasserkörper Der FGG Elbe
Die Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe Darstellung der Bewirtschaftungsziele für die vom Braunkohlenbergbau beeinflussten Grundwasserkörper der FGG Elbe Titelbilder: Oben links: Ausschnitt aus der Karte der Sulfatbelastung des Grundwasser- körpers SAL GW 059 (Weißelsterbecken mit Bergbaueinfluss) im Jahr 2017. Oben rechts: Heideteich, Foto: Hartmut Rauhut, 2014 Unten links: Ausschnitt aus der Karte des mengenmäßigen Zustandes des Grundwasserkörpers SP 3-1 (Lohsa-Nochten), Entwicklung von 2017 bis 2021 II Darstellung der Bewirtschaftungsziele für die vom Braunkohlenbergbau beeinflussten Grundwasserkörper der FGG Elbe I. Inhaltsverzeichnis I. Inhaltsverzeichnis ...................................................................................................... III II. Anlagenverzeichnis ................................................................................................... VI III. Tabellenverzeichnis ................................................................................................. VIII IV. Abbildungsverzeichnis ............................................................................................ XV V. Abkürzungsverzeichnis .........................................................................................XXIII VI. Begrifflichkeiten .................................................................................................... XXVI 1 Einführung ................................................................................................................ 30 1.1 Braunkohlenbergbau im Flussgebiet -

Walter Schmitz: Kito Lorenc – Poet of a Small People
Lětopis 66 (2019) 2, 159 –162 159 Walter Schmitz: Kito Lorenc – Poet of a Small People? Kito Lorencʼs literary work shows, in poetology and writing strategies, elementary anal- ogies to the literature of migration. The central common themes are homeland and rep- resentation, which, for the poet belonging to an autochthonous minority, however, lead to his own perspective. Encouraged by Johannes Bobrowski, Lorenc also adopts German as literary language, developing his work in a constant exchange of languages and in the reassurance of a Sorbian literary tradition. In the midst of the rapid technological progress that destroys his native landscape, his early poem “Struga” opens up the timeless beauty of Sorbian folk culture. In the radical play with language in his later oeuvre, autonomous poetry turns against the arrogance of state power before 1989 and against that of the me- dia society after 1989. Lorencʼs dramas explore the facets of poetology under the terms of German dictatorships – between assiduous adaptation and courageous obstinacy. With his ʻmigrantʼ writing, which creates a ʻbridgeʼ between the Sorbian and the German, Lorenc belongs to a border-crossing community of poets in Germany, indeed in Europe. Keywords: Kito Lorenc, literature of migration, ethnic minority, Sorbian literature, Ger- man literature, bicultural literature Christian Prunitsch: Podomk: The Poetic Household of the Late Kito Lorenc Kito Lorenc’s late poetry in „Podomk“ (2010) and „Zymny kut“ (2016) underlines lexi- cally as well as prosodically the vitality and creativity of current Sorbian poetry. Imbued with both melancholy and irony, Lorenc’s Sorbian poems in these two collections largely lack corresponding versions in German, thus demonstrating a tendency to expose the lyr- ical self and his rather metonymically coined belongings in a poetical universe as clearly defi ned as richly differentiated. -

LMBV: Lösungen Der LMBV Für Eine Saubere Spree (Spreegebiet
Lösungen der LMBV für eine saubere Spree Spreegebiet Südraum Untersuchungen und Lösungsansätze 6 Lösungen der LMBV für eine saubere Spree – Untersuchungen und Lösungsansätze im Spreegebiet Südraum Fragen und Antworten zum Vorgehen der LMBV bei den Maßnahmen zum Reduzieren der Eisenfrachten in Fließ gewässern – hier im Lausitzer Südraum der Spree an der Landesgrenze zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Brandenburg Was sind die Ursachen der besonderen Belas- Räumliche Lage des Betrachtungsraumes tung der Spree vor der Talsperre Spremberg? Eisen ist ein weit verbreitetes natürliches Element in der Erdkruste. Auch in der Lausitz gab es früher große Eisen erzvorkommen, die als Raseneisenerz oberflächennah abge baut wurden. Die im Boden der Lausitz natürlich vorhande nen Minerale (vorrangig Pyrite; untergeordnet Markasite) – im Volksmund als Katzengold bezeichnet – sind chemi sche Verbindungen von Eisen mit Schwefel (Eisensulfid). Bereits mit der Trockenlegung von Torfen, dem Ab bau von Raseneisenerzen und durch die landwirt schaftliche Melioration haben die Menschen in das ursprüngliche geochemische Gleichgewicht eingegriffen. Später wurde das Grundwasser durch den Braunkohlenbergbau weiträumig und in Teufen von bis zu 80 m abgesenkt. Dadurch entstand ein Grundwasserdefizit von etwa 7 Mrd. m³ auf einer Fläche von ca. 2.000 km² in der Lausitz. Durch den Kontakt mit Luftsauer stoff infolge der Grundwasserabsenkung verwittern die Eisensulfide und es entstehen wasserlösliches Eisen und Sulfat. Nach der Betriebseinstellung der Braunkohleförde rung ehemaliger Tagebaue (z. B. Spreetal, Burghammer, Lohsa und Scheibe) im Verantwortungsbereich der LMBV im süd lichen Einzugsgebiet der Spree werden die Eisen und Schwefelverbindungen durch den nachbergbaulichen Grundwasserwie deranstieg mobilisiert und nach dem Wie deranschluss der Grundwasser leiter an die Oberflächengewässer in die Bergbaufolge seen und Flüsse eingetragen. -

Bebauungsplan „Ansiedlungsstandort Mühlrose“
Gemeinde Schleife (Slepo) Landkreis Görlitz BEBAUUNGSPLAN „ANSIEDLUNGSSTANDORT MÜHLROSE“ Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Schleife Friedensstraße 83 02959 Schleife Begründung zur Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Bürger nach § 3 Abs. 2 BauGB durch: RICHTER + KAUP Ingenieure I Planer Berliner Straße 21 02826 Görlitz Stand: 08.01.2019 Unterlagen: Planzeichnung Teil A und textliche Festsetzungen Teil B (Maßstab 1:1.500) städtebaulicher Entwurf (Maßstab 1:2.000) Umweltbericht mit Anlagen 1-5 RICHTER + KAUP Ingenieure I Planer BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN „ANSIEDLUNGSSTANDORT MÜHLROSE“ IN SCHLEIFE zur Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Bürger nach § 3 Abs. 2 BauGB INHALTSVERZEICHNIS 1. PLANUNGSGRUNDLAGEN ........................................................................................................................... 4 1.1 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG .......................................................................................................... 4 1.2 STANDORT UND BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES ............................................................................................ 5 1.3 HISTORIE UND HINTERGRUNDINFORMATION...................................................................................................... 6 1.4 BESONDERHEITEN BERGBAUBEDINGTER UMSIEDLUNGEN...................................................................................... 6 1.5 GESTALTUNG DES UMSIEDLUNGSPROZESSES