Vulnerabilitätsanalyse Oberlausitz-Niederschlesien
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pre-Event Water Contributions and Streamwater Residence Times in Different Land Use Settings of the Transboundary Mesoscale Lužická Nisa Catchment
J. Hydrol. Hydromech., 65, 2017, 2, 154–164 DOI: 10.1515/johh-2017-0003 Pre-event water contributions and streamwater residence times in different land use settings of the transboundary mesoscale Lužická Nisa catchment Martin Šanda1*, Pavlína Sedlmaierová1, Tomáš Vitvar1, Christina Seidler2, Matthias Kändler2, Jakub Jankovec1, Alena Kulasová3, František Paška4 1 Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Thákurova 7, 166 29 Prague 6, Czech Republic. 2 Technische Universität Dresden, International Institute Zittau, Markt 23, 02763 Zittau, Germany. 3 T. G. Masaryk Water Research Institute, Podbabská 30, Prague 6, Czech Republic. 4 Crop Research Institute, Drnovská 507, Prague 6, Czech Republic. * Corresponding author. Tel.: +420 22435 3739. Fax: +420 233324861. E-mail: [email protected] Abstract: The objective of the study was to evaluate the spatial distribution of peakflow pre-event water contributions and streamwater residence times with emphasis on land use patterns in 38 subcatchments within the 687 km2 large mesoscale transboundary catchment Lužická Nisa. Mean residence times between 8 and 27 months and portions of pre- event water between 10 and 97% on a storm event peakflow were determined, using 18O data in precipitation and streamwater from a weekly monitoring of nearly two years. Only a small tracer variation buffering effect of the lowland tributaries on the main stem was observed, indicating the dominant impact on the mountainous headwaters on the runoff generation. Longest mean streamwater residence times of 27 months were identified in the nearly natural headwaters of the Jizera Mountains, revealing no ambiguous correlation between the catchment area and altitude and the mean resi- dence time of streamwater. -

Offizielles Mitteilungsblatt
Offizielles Mitteilungsblatt Fußballverband Oberlausitz - Ausgabe August 2020 - Pokalsieger im Corona-Spieljahr Der VfB Zittau bejubelt den Pokalsieg gegen den SV Aufbau Kodersdorf, der zweite Erfolg im Spieljahr 2019/20 nach dem Aufstieg in die Landesklasse. www.fussballverband -oberlausitz.de OM 8/20 | 31. August 2020 Inhalt, Impressum Seite 2 INHALT Seite Vorstand 3 Geschäftsstelle 3 Spielausschuss 5 Breitenfußball 5 Kreisbildungsbeauftragter 5 Sportgerichtsurteil 6 Kreisehrenamtsbeauftragter 6 Geburtstage im September 6 Termine im September 7 IMPRESSUM Herausgeber Fußballverband Oberlausitz Verantwortlich für den Inhalt Jürgen Heinrich (FVO -Präsident), Uwe Ulmer ( FVO -Geschäftsführer ) Gestaltung Uwe Ulmer Foto s Bernhard Donke, SFV Erscheinungsdatum Letzte Woche des Monats Redaktionsschluss 24 . des jeweiligen Monats Veröffentlichung - Homepage des FVO unter www.fussballverband -oberlausitz.de - einmalige E-Mail an alle Vereine des FVO - postalische Zusendung auf Wunsch der Vereine Anzeigen Auf Anfrage in der Geschäftsstelle Der Herausgeber behält sich die redaktionelle Bearbeitung von zu veröffentlichen Beiträgen vor. Fußballverband Oberlausitz Friesenstraße 35 02827 Görlitz Telefon: 03581 704635 Vorstand, Geschäftsstelle Seite 3 Vorstand Start in das neue Spieljahr steht bevor Am Wochenende 4. bis 6. September soll es losgehen, das Spieljahr 2020/21. Die ersten Pflichtspiele werden da zwar bereits ausgetragen sein: Zwei Pokalrunden der Herren sowie der erste Spieltag der Senioren der Kreisligastaffel Mitte. Am Freitag, den 4. September erfolgt auf dem Sportplatz Görlitz-Biesnitz jedoch der offizielle Startschuss mit der Eröffnungspartie unserer höchsten Spielklasse, der Landskron-Oberlausitzliga, dem Spiel GFC Rauschwalde – SV Aufbau Kodersdorf. Hoffen wir auf ein Spieljahr, welches in allen Altersklassen, in allen Regionen unseres Verbandsgebietes störungsfrei durchgespielt werden kann. Die vielen Freundschaftsspiele der vergangenen Wochen, auch die ausgetragenen Pokalspiele zeigen, dass Fußball gespielt werden kann. -
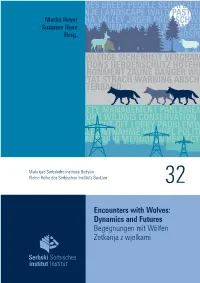
Encounters with Wolves
Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen 32 Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami 32 · 2020 Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Marlis Heyer Susanne Hose Hrsg. Encounters with Wolves: Dynamics and Futures Begegnungen mit Wölfen Zetkanja z wjelkami © 2020 Serbski institut Budyšin Sorbisches Institut Bautzen Dwórnišćowa 6 · Bahnhofstraße 6 D-02625 Budyšin · Bautzen Spěchowane wot Załožby za serbski lud, kotraž T +49 3591 4972-0 dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na F +49 3591 4972-14 zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych www.serbski-institut.de wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborska a Sakskeho krajneho sejma. [email protected] Gefördert durch die Stiftung für das sorbische Redakcija Redaktion Volk, die jährlich auf der Grundlage der von den Marlis Heyer, Susanne Hose Abgeordneten des Deutschen Bundestages, des Landtages Brandenburg und des Sächsischen Wuhotowanje Gestaltung Landtages beschlossenen Haushalte Zuwen- Ralf Reimann, Büro für Gestaltung, dungen aus Steuermitteln erhält. Bautzen Ćišć Druck Grafik S. 33 unter Verwendung eines 32 Union Druckerei Dresden GmbH Scherenschnitts von Elisabeth Müller, Collmen Mały rjad Serbskeho instituta Budyšin ISBN 978-3-9816961-7-2 Grafik S. 87 nach GEO-Karte 5/2018 Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen Page Content 5 Marlis Heyer and Susanne Hose Vorwort · Preface 23 Emilia -

Flora Der Oberlausitz" Nach Einem Zeitra Um Von 57 Jah Ren Zu Ihrem Abschluß
Vorwort des Herausgebers: Mit der vorli egenden 9. Fortsetzung kommt die "Flora der Oberlausitz" nach einem Zeitra um von 57 Jah ren zu ihrem Abschluß. Als der verdienstvolle heimische Florist Emil Barbe r 1898 den ersten Teil in den "Abhan dlungen" veröffentlichte, konnte er nicht vo raussehen, daß die Vollendung der Arbeit durch wi drige Um stä nd e ei ne so lange Zeit in Anspruch nehmen würde. Und doch müssen wi r uns glücklich schä tzen, daß sein Lebenswerk nicht ein Torso geblieben ist, als ihn 1917 nach Fertigstellung der 3, Fortsetzu ng ein früher Tod dahinraffte, Zu einem großen Teil durch Barber noch pe rsö nli ch angeregt fanden sich in allen Teilen der Oberl ausitz Bota ni ker, die sich der Erfo rschu ng der hei mi schen Flora widme ten. So konnte Alfred Hartmann, gestü tzt auf di e Auf zeichnungen Barbers 1927 eine Fortsetzung der Flora erscheinen lasse n. Danach führte Max Militzer, der derzeitig beste Kenner der heim ische n Flora, die Arbeit fort. Durch die vo n ihm betonte pfl anzengeog raphische Fo rsch un gsrichtung be kamen die weiteren Fortse tzung en ei n neues Gesicht, und die Gesamtarbeit wurde in ei nen gröBeren Zusammenhang ges tellt. D er letzte Krieg und sei ne Auswi rkung en verzögerten abe rm als di e Fortführung, bis sich di e Möglichkeit bot, im Vorjahre die "Abhandlun gen" im neuen Gewande hera uszubri ngen. Jetzt erschein en von Max Militzer als letzte Familie im System die Compos iten, von denen die Hieracien durch Eritz Glotz, unserem langjährigen Spezia li ste n, be arbeitet wurden. -

Anschriftenverzeichnis Stand: 17.08.2015
Anschriftenverzeichnis Stand: 17.08.2015 63002015 - EFV Bernstadt/Dittersbach - Kreis Oberlausitz Abteilungsleiter Fußball Holger Fiebig, Teichweg 7, 02747 Herrnhut Telefon privat: 03587342572 E-Mail: [email protected] Leiter Jugendfußball Christian Volke, Am Flutgraben 7, 02748 Bernstadt Telefon privat: 035823/ 77752, Mobil: 0152 52795619 Schiedsrichterobmann Peter Selle, Herrnhuter Str. 29 C, 02748 Bernstadt a. d. Eigen Telefon privat: 035874 229766, Telefon geschäftl.: 035874 20081, Mobil: 01733569512 E-Mail: [email protected] SP Neißestadion Ostritz, Klosterstr. 39, 02899 Ostritz SP Sportplatz Bernstadt, Schulstr., 02748 Bernstadt a. d. Eigen SP Sportplatz Dittersbach OL, Dorfstraße 53, 02748 Bernstadt a. d. Eigen SP Stadion der Jugend Löbau, Stadionweg 5 A, 02708 Löbau 63002024 - Bertsdorfer SV - Kreis Oberlausitz Abteilungsleiter Fußball Thomas Worm, Hauptstr. 34, 02763 Bertsdorf- Hörnitz Telefon privat: 03583 692735, Mobil: 015207183087 E-Mail: [email protected] Leiter Jugendfußball Gerd Kunath, Hauptstr. 134, 02763 Bertsdorf-Hörnitz Telefon privat: 03583 692811 E-Mail: [email protected] Schiedsrichterobmann Detlev Heidenreich, Hauptstr. 69, 02763 Bertsdorf-Hörnitz Telefon privat: 03583 / 692766 E-Mail: [email protected] SP Sportpl. a d Kirche Bertsdorf, Am Sportplatz 1, 02763 Bertsdorf SP Sportplatz Hörnitz, Heinestr., 02763 Bertsdorf-Hörnitz 63002042 - SV Blau-Weiß/Empor Deutsch-Ossig - Kreis Oberlausitz Abteilungsleiter Fußball Heiko Müller, Lilienweg 24, 02827 Görlitz Telefon privat: 03581-731883, Telefon geschäftl.: -

05.01.2016 Name Vorname Straße/Nr. PLZ Ort Telefon 1 Tel
Erstellt am: 05.01.2016 Name Vorname Straße/Nr. PLZ Ort Telefon 1 Tel. Mobil Abt David An der Landeskrone 28 02826 Görlitz 03581 411140 Adam Frank Bürgerweg 29 02739 Eibau 01749609557 Arlt Philipp Hilbersdorf 143 02894 Vierkirchen 03582770847 01736741607 Badermann Roy Gottesackerallee 7 02906 Niesky 0152 59480369 Baresch Johannes Bachgasse 7 02708 Löbau 03585832561 01629001545 Bayha Ralf Am Walde 200 02906 Mücka 035893 6667 Benad-Hambach Sandro Untere Paulsdorfer Str. 11 02708 Löbau 03585/415600 0151/15138266 Berger Frank Löbauer Str. 19 02827 Görlitz 035818768794 0174 5730804 Bittner Arnold Gabelsbergerstr. 9 02763 Zittau 035835073399 01728106550 Bittner Wolfgang Nieskyer Str. 9 02906 Waldhufen - Jänkendorf 03588/206965 Bittrich Heinz Am Schöps 139 02829 Markersdorf 035829/61013 01704302290 Blasche Christian Am Bahnhof 58 b 02923 Kodersdorf 035825 614778 Blasche Matthias Schusterbergstrasse 9 02923 Kodersdorf OT Särichen 0176 2093 1685 Block Marcel Noeser Str. 93 02929 Rothenburg/O.L. 0152 01741716 Böhm Rainer Oberlausitzer Weg 3 02894 Reichenbach/O.L. 035828/70130 Böhm Ralph Oberlausitzer Weg 2 02894 Reichenbach/O.L. 0174 3288660 Born Justin Alwin-Liebe-Str. 13 02708 Löbau 03585860849 015223096652 Bräuer Lutz Am Hutberg 7 02899 Schönau-Berzdorf 015783564989 01578/3564989 Braun Martin Südoststr. 63 a 02827 Görlitz 03581/845745 015233814765 Bresan Jakob Am Windmühlenberg 19 02828 Görlitz 035820 60763 01629856582 Bronder Torsten Johannes-R.-Becher Str. 15 02827 Görlitz 01704712278 Brösel Lucas Oberdorfweg 7 02708 Schönbach 035872 39727 0152 26815119 Buder Robert Bahnhofstr. 1 02763 Zittau 035836994457 0173 1809882 Buhse Laurenz Kunnerwitzer Str. 22 02826 Görlitz 03581 400587 0176 54449007 Deckert Maik Martin-Kloß-Str. 4 02727 Ebersbach-Neugersdorf 03586/369152 01629396127 Dilmaghani Amir Paul-Neck-Str. -

HWSK-Nr. 39, Gefahrenkarte Ortslage Mittelherwigsdorf
Landestalsperrenverwaltung des Staatliches Umweltfachamt Freistaates Sachsen Bautzen Talsperrenmeisterei Spree Käthe-Kollwitz-Str. 17, Haus 3 Am Staudamm 3 02625 Bautzen 02694 Malschwitz, OT Niedergurig Hochwasserschutzkonzeption Mandau Anlage 13.2 Gefahrenkarte für die Gemeinde Mittelherwigsdorf Dezember 2004 Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH, Dr.-Ing. H. Sieker Bearbeiter: Dipl. Ing. D. Wilcke Dipl.-Ing. A. Deckert Hochwasserschutzkonzeption Mandau - Gefahrenkarten Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines......................................................................................................... 3 1.1 Zielstellung ........................................................................................................ 3 1.2 Grundlagen ....................................................................................................... 3 1.3 Vorgehensweise................................................................................................ 3 2. Prozessanalyse ................................................................................................... 4 2.1 Hydrologie ......................................................................................................... 4 2.2 Geschiebe......................................................................................................... 6 2.3 Gefahrenprozesse............................................................................................. 6 3. Gefahrenkarten...................................................................................................10 -

Amtsblatt Der Gemeinde Mittelherwigsdorf Nr
GEMEINDE MITTELHERWIGSDORF Landkreis Görlitz M F I T R T O E L D H S ER R E W F I I G E S S D R O E R B F O E C F K R A O Amtsbla RT ND SB GE ERG RAD DER GEMEIndE MITTELHERWIGSDORF mit den Ortsteilen Eckartsberg, Mittelherwigsdorf, Oberseifersdorf, Radgendorf GEMEINDEVerWALTUNG MITTELHerWIGSDorF • Am Gemeindeamt 7 • 02763 Mittelherwigsdorf Tel.: 0 35 83 / 5 01 30 • Fax: 0 35 83 / 50 13 19 • E-Mail: [email protected] • www.mittelherwigsdorf.de Nr. 5 12. Mai 2021 29. Jahrgang Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, Auch nach über einem Jahr kommt man nicht an dem einen Thema vorbei, das uns nach wie vor alle fest im Griff hat und das unseren Alltag vielfach auf schmerzliche Art und Weise dominiert. Besonders unsere Kinder und Jugendlichen wur- den nun durch die „Bundesnotbremse“ (sicher das kommen- de „Unwort des Jahres“) erneut zurückgeworfen. Notbetreu- ung ist an der Tagesordnung. Bestenfalls. Ich möchte nicht verhehlen, dass wir bis zuletzt gehofft hatten, wenigstens die Schauen Sie Kinder – verantwortungsvoll mit regelmäßiger Testung und regelmäßig unter Einhaltung aller „erlernter“ Hygienemaßnahmen – in mal hin was ihrem Alltag und gewohnten Umfeld belassen zu können. Die da wächst. Hoffnung hat sich leider zerschlagen. Auch für viele Eltern Ich freu mich haben damit erneut harte Wochen begonnen. Das macht drauf. traurig, wütend, vor allem aber müde. Auch uns in Grund- Freuen kann man sich auch über die Baufortschritte am schule, Kindertagesstätten und Verwaltung. Und es wird zur „Container“, dem Domizil des Jugend- & Kulturvereins in echten Herausforderung, wenn es dann zusätzlich noch zu Oberseifersdorf. -
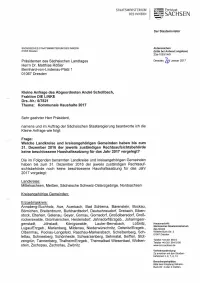
T'31 SACHSEN C C23
STAATSMINISTERIUM -;-= Freistaat DES INNERN t'31 SACHSEN c c23, Der Staatsminister SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN Aktenzeichen 01095 Dresden (bitte bei Antwort angeben) 23a-1053/14/9 Präsidenten des Sächsischen Landtages Dresden, 7 0 Januar 2017 Herrn Dr. Matthias Rößler Bernhard -von -Lindenau -Platz 1 01067 Dresden Kleine Anfrage des Abgeordneten Andre Schollbach, Fraktion DIE LINKE Drs.-Nr.: 6/7821 Thema: Kommunale Haushalte 2017 Sehr geehrter Herr Präsident, namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: Frage: Welche Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden haben bis zum 31. Dezember 2016 der jeweils zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde keine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2017 vorgelegt? Die im Folgenden benannten Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden haben bis zum 31. Dezember 2016 der jeweils zuständigen Rechtsauf- sichtsbehörde noch keine beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2017 vorgelegt: Landkreise: Mittelsachsen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Nordsachsen Kreisangehörige Gemeinden: Erzgebirgskreis: Annaberg-Buchholz, Aue, Auerbach, Bad Schlema, Bärenstein, Bockau, Börnichen, Breitenbrunn, Burkhardtsdorf, Deutschneudorf, Drebach, Eiben- stock, Elterlein, Gelenau, Geyer, Gornau, Gornsdorf, Großolbersdorf, Groß- rückerswalde, Grünhainichen, Heidersdorf, Jahnsdorf/Erzgeb., Johanngeor- genstadt, Jöhstadt, Königswalde, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Hausanschrift: Sächsisches Staatsministerium Lugau/Erzgeb., Marienberg, Mildenau, Niederwürschnitz, -

Originally Published As
Originally published as: Grünthal, G. (2014): Induced seismicity related to geothermal projects versus natural tectonic earthquakes and other types of induced seismic events in Central Europe. - Geothermics, 52, p. 22-35 DOI: http://doi.org/10.1016/j.geothermics.2013.09.009 Geothermics 52 (2014) 22‐35 http://dx.doi.org/10.1016/j.geothermics.2013.09.009 Induced seismicity related to geothermal projects versus natural tectonic earthquakes and other types of induced seismic events in Central Europe Gottfried Grünthal Helmholtz Centre Potsdam, GFZ German Research Centre for Geosciences, Section “Seismic Hazard and Stress Field”, Telegrafenberg, D‐14473 Potsdam ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Induced seismicity related to fluid injection in geothermal systems has gained an increased Received 27 September 2012 public awareness particularly in Central Europe. The paper discusses occurrence of induced Received in revised form 6 September 2013 seismic events at sites of geothermal projects in comparison to natural tectonic earthquakes Accepted 18 September 2013 and other types of induced or triggered seismicity in Central Europe (i.e. in Germany and Available online 7 November 2013 adjacent areas). Other types of induced events are those in areas of mining or exploitation of coal, salt and potash, hydrocarbon and ores. Furthermore, induced seismicity in connection with water reservoirs and intense precipitation in areas of karst geology is also discussed. Keywords: The subject of this study is the induced seismicity of a data set of moment magnitudes Induced seismicity at geothermal sites 2.0, while the distinct larger natural seismicity is displayed for 2.5. Parameters Natural tectonic seismicity of the strongest seismic events of all studied sources of seismicity are listed, presented in Mining‐induced seismicity epicentre maps, and discussed with respect to their maximum observed magnitudes and Frequency‐magnitude relations their frequency‐magnitude distributions. -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe
G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

University of Bath PHD Nature and Technology in GDR Literature
University of Bath PHD Nature and technology in GDR literature Tomlinson, Dennis Churchill Award date: 1993 Awarding institution: University of Bath Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 23. May. 2019 NATURE AND TECHNOLOGY IN GDR LITERATURE NATURE AND TECHNOLOGY IN GDR LITERATURE submitted by Dennis Churchill Tomlinson for the degree of PhD of the University of Bath 1993 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis rests with its author. This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with its author and that no quotation from the thesis and no information derived from it may be published without the prior written consent of the author. This thesis may be made avilable for consultation within the University Library and may be photocopied or lent to other libraries for the purposes of consultation.