Aus Politik & Kultur Nr. 15 (Auszug)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lorbeer Und Sterne
Thema: Strittige Arzneimittelstudien AMERIKA HAT GEWÄHLT EUROPA IM DILEMMA Überraschungssieger Trump schockt Der EU-Handelsvertrag Ceta und die Bundestag beschließt Gesetz SEITE 1-3 die Eliten weltweit SEITE 4,5 Tücken der Mitwirkung SEITE 9 Berlin, Montag 14. November 2016 www.das-parlament.de 66. Jahrgang | Nr. 46-47 | Preis 1 € | A 5544 KOPF DER WOCHE Überraschend Wahlsieger Vorrang für die Forschung Donald Trump Er ist einer der spektakulärsten Wahlsieger der US-Geschichte: Der Immobilien- milliardär und Republikaner Donald Trump siegte GESUNDHEIT Bundestag erweitert Möglichkeiten für klinische Arzneimittelstudien an Demenzkranken bei der Präsidenten- wahl gegen die aller- meisten Vorhersagen eichskanzler Otto von Bis- über die favorisierte marck (1815-1898) soll demokratische Geg- mal gesagt haben, je weni- nerin Hillary Clinton. ger die Leute davon wüss- Der oft polternde ten, wie Würste und Geset- Trump hatte sich im ze gemacht werden, desto Wahlkampf als An- besserR könnten sie schlafen. Das Bonmot walt der von der Glo- stammt allerdings aus einer Zeit, als die balisierung bedrohten parlamentarischen und demokratischen © picture-alliance/dpa und „vergessenen“ Gepflogenheiten in Deutschland noch un- Amerikaner profiliert und dabei auch illegale Im- terentwickelt waren. Heute wird bei der migranten und Muslime mit scharfen Worten ins Gesetzgebung meist auf eine breite Beteili- Visier genommen. Wofür er letztlich innen- und gung und Transparenz geachtet, allerdings außenpolitisch steht, blieb unklar. In jedem Fall kommt es vor, dass -
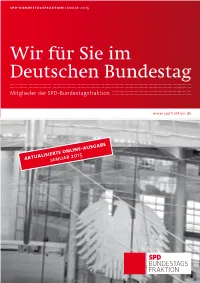
Wir Für Sie Im Deutschen Bundestag
spd-bundestagsfraktion januar 2015 Wir für Sie im Deutschen Bundestag Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion www.spdfraktion.de aktualisiertejanuar online-ausgabe 2015 fotos: spdfraktion.de (susie knoll/florian jänicke), gabriel (s. 17 foto: dominik butzmann), hagedorn (s. 19 foto: studio kohlmeier), henn (s. 22 foto: hardy wack/studios and more), högl (s. 23 foto: detlef eden), ilgen (s. 23 foto: a. birresborn), kampmann (s. 25 foto: veit mette), lischka (s. 30 foto: daniela laske), lotze (s. 30 foto: dbt/renate blanke), mindrup (s. 32 foto: thomas imo), oppermann (s. 34 foto: gerrit sievert), scheer (s. 42 foto: joachim e. roettgers), steinmeier (s. 48 foto: thomas köhler/photothek.net) inhaltsverzeichnis ................................................................................................... 05 Mitglieder nach Alphabet 54 Mitglieder nach Bundesländern 60 Vorstand 61 Arbeitsgruppensprecher/innen 62 Vorsitzende/Stellvertretende Ausschussvorsitzende wir für sie im deutschen bundestag Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion ......................................................................................................................................................................... .......................................... Niels Annen Geboren am 06.04.1973 Beruf: Historiker Direktmandat des Wahlkreises Hamburg-Eimsbüttel [20] (Hamburg) Sprecher Arbeitsgruppe Außenpolitik Ingrid Arndt-Brauer Geboren am 20.03.1961 Beruf: Dipl.-Kauffrau, Dipl.-Soziologin Landesliste Nordrhein-Westfalen zuständig für den Wahlkreis Steinfurt -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 44. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Juni 2014 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 4 Entschließungsantrag der Abgeordneten Caren Lay, Eva Bulling-Schröter, Dr. Dietmar Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts - Drucksachen 18/1304, 18/1573, 18/1891 und 18/1901 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 575 Nicht abgegebene Stimmen: 56 Ja-Stimmen: 109 Nein-Stimmen: 465 Enthaltungen: 1 Ungültige: 0 Berlin, den 27.06.2014 Beginn: 10:58 Ende: 11:01 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Julia Bartz X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -

Plenarprotokoll 18/66
Inhaltsverzeichnis Plenarprotokoll 18/66 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 66. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 13. November 2014 Inhalt: Begrüßung des neuen Abgeordneten Norbert Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) . 6133 B Müller (Potsdam) . 6115 A Kerstin Griese (SPD) . 6134 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Lisa Paus (BÜNDNIS 90/ nung . 6115 B DIE GRÜNEN) . 6135 D Absetzung des Tagesordnungspunktes 12 . 6115 D Dr. Claudia Lücking-Michel (CDU/CSU) . 6136 C Bärbel Bas (SPD) . 6137 C Tagesordnungspunkt 3: Emmi Zeulner (CDU/CSU) . 6138 B Vereinbarte Debatte: Sterbebegleitung . 6116 A Volker Kauder (CDU/CSU) . 6139 B Michael Brand (CDU/CSU) . 6116 C Thomas Rachel (CDU/CSU) . 6140 B Kathrin Vogler (DIE LINKE) . 6117 D Pia Zimmermann (DIE LINKE) . 6141 B Dr. Carola Reimann (SPD) . 6118 D Burkhard Lischka (SPD) . 6142 B Renate Künast (BÜNDNIS 90/ Kai Gehring (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 6119 D DIE GRÜNEN) . 6143 B Peter Hintze (CDU/CSU) . 6121 A Michael Frieser (CDU/CSU) . 6144 B Dr. Petra Sitte (DIE LINKE) . 6121 D Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE) . 6145 A Dr. Karl Lauterbach (SPD) . 6122 D René Röspel (SPD) . 6146 A Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/ Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 6123 D DIE GRÜNEN) . 6147 A Johannes Singhammer (CDU/CSU) . 6124 D Annette Widmann-Mauz (CDU/CSU) . 6148 A Thomas Oppermann (SPD) . 6125 C Dr. Johannes Fechner (SPD) . 6149 C Dr. Franz Josef Jung (CDU/CSU) . 6126 D Rudolf Henke (CDU/CSU) . 6150 C Hermann Gröhe (CDU/CSU) . 6127 C Patrick Schnieder (CDU/CSU) . 6151 B Katherina Reiche (Potsdam) (CDU/CSU) . 6128 C Dr. Peter Tauber (CDU/CSU) . 6152 C Harald Weinberg (DIE LINKE) . -
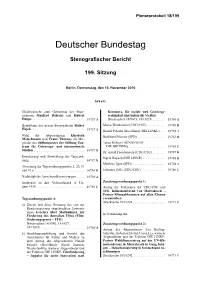
Plenarprotokoll 18/199
Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Deutscher Bundestag Antrag
Deutscher Bundestag Drucksache 18/483 18. Wahlperiode 12.02.2014 Antrag der Abgeordneten Stephan Albani, Katrin Albsteiger, Niels Annen, Ingrid Arndt-Brauer, Rainer Arnold, Artur Auernhammer, Heike Baehrens, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ulrike Bahr, Heinz-Joachim Barchmann, Dr. Katarina Barley, Dr. Hans-Peter Bartels, Klaus Barthel, Norbert Barthle, Dr. Matthias Bartke, Sören Bartol, Julia Bartz, Bärbel Bas, Dirk Becker, Uwe Beckmeyer, Maik Beermann, Manfred Behrens (Börde), Veronika Bellmann, Dr. André Berghegger, Dr. Christoph Bergner, Ute Bertram, Peter Beyer, Steffen Bilger, Lothar Binding (Heidelberg), Clemens Binninger, Burkhard Blienert, Dr. Maria Böhmer, Norbert Brackmann, Klaus Brähmig, Michael Brand, Helmut Brandt, Willi Brase, Dr. Helge Braun, Ralph Brinkhaus, Dr. Karl-Heinz Brunner, Marco Bülow, Edelgard Bulmahn, Cajus Caesar, Dr. Lars Castellucci, Gitta Connemann, Petra Crone, Bernhard Daldrup, Dr. Daniela De Ridder, Dr. Karamba Diaby, Alexandra Dinges-Dierig, Sabine Dittmar, Thomas Dörflinger, Martin Dörmann, Michael Donth, Elvira Drobinski-Weiß, Siegmund Ehrmann, Michaela Engelmeier-Heite, Dr. h. c. Gernot Erler, Petra Ernstberger, Saskia Esken, Karin Evers-Meyer, Dr. Bernd Fabritius, Dr. Johannes Fechner, Uwe Feiler, Dr. Thomas Feist, Dr. Fritz Felgentreu, Elke Ferner, Dr. Maria Flachsbarth, Christian Flisek, Klaus-Peter Flosbach, Gabriele Fograscher, Dr. Edgar Franke, Ulrich Freese, Thorsten Frei, Dagmar Freitag, Dr. Astrid Freudenstein, Michael Frieser, Dr. Michael Fuchs, Alexander Funk, Dr. Thomas Gebhart, Michael Gerdes, Alois Gerig, Martin Gerster, Eberhard Gienger, Ulrike Gottschalck, Kerstin Griese, Reinhard Grindel, Ursula Groden-Kranich, Klaus-Dieter Gröhler, Uli Grötsch, Gabriele Groneberg, Michael Groß, Michael Grosse-Brömer, Astrid Grotelüschen, Manfred Grund, Oliver Grundmann, Fritz Güntzler, Dr. Herlind Gundelach, Olav Gutting, Christian Haase, Bettina Hagedorn, Rita Hagl-Kehl, Metin Hakverdi, Ulrich Hampel, Dr. -

Drogen- Und Suchtbericht Juli 2014 Und Suchtbericht Juli Drogen
Drogen- und Suchtbericht Juli 2014 und Suchtbericht Juli Drogen- Drogen-Drogen- und Suchtberichtund Suchtbericht Mai 2015 Juli 2014 www.drogenbeauftragte.de Drogen- und Suchtbericht Mai 2015 www.drogenbeauftragte.de Arbeit stehen. Das beginnt bereits mit dem noch ungebo- besorgniserregend. Die Auswirkungen, die nicht nur den diesen neuen Formen von Suchtmitteln besser entgegen renen Leben. Noch immer kommen in Deutschland viel Abhängigen selbst sondern sein gesamtes Umfeld treffen, wirken können. Das ist mir wichtig, denn ich habe immer zu viele Kinder mit dem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) sind oft dramatisch. Schnell wird aus dem Spiel eine die Gesundheit der Menschen und insbesondere der zur Welt. Oft bleiben lebenslange Behinderungen zurück. ernsthafte Suchterkrankung. Hier gilt: Wir müssen über Kinder und Jugendlichen im Blick. Gerade auch das FAS ist zu 100 Prozent vermeidbar, durch konsequenten diese Suchtform reden, aufklären und den Betroffenen die Thema „Computerspiel- und Internetabhängigkeit“ rückt Alkoholverzicht werdender Mütter während der Schwan- richtige Hilfe anbieten. Auch Filme können hier einen zunehmend ins Blickfeld. Neue Zahlen und Erhebungen gerschaft. Doch noch immer weiß nicht einmal jeder Beitrag zur Aufklärung leisten – so etwa ein jüngst in aus der wissenschaftlichen Praxis belegen einen Anstieg Zweite in Deutschland, dass Alkoholkonsum in der Berlin gedrehter, international besetzter deutscher verhaltensbezogener Störungen. Auch hier sind besonders Schwangerschaft zu bleibenden Schäden beim Kind Spielfilm, der das Thema Glücksspielsucht betrachtet. junge Menschen betroffen. Daher bedarf es guter Angebote führen kann. Aufklärung ist daher zentral. Sie stand auch Einer der Protagonisten, der Schauspieler Christian Wolff, der Beratung und Behandlung. im Zentrum meiner 1. Jahrestagung zum Thema. wird in der Rubrik „Vorgestellt“ porträtiert. -

Und Suchtbericht Juli 2014 Und Suchtbericht Juli Drogen
Drogen- und Suchtbericht Juli 2014 und Suchtbericht Juli Drogen- Drogen-Drogen- und Suchtberichtund Suchtbericht Mai 2015 Juli 2014 www.drogenbeauftragte.de Arbeit stehen. Das beginnt bereits mit dem noch ungebo- besorgniserregend. Die Auswirkungen, die nicht nur den wir auch diesen neuen Formen von Suchtmitteln besser renen Leben. Noch immer kommen in Deutschland viel Abhängigen selbst sondern sein gesamtes Umfeld treffen, entgegen wirken können. Das ist mir wichtig, denn ich zu viele Kinder mit dem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) sind oft dramatisch. Schnell wird aus dem Spiel eine habe immer die Gesundheit der Menschen und insbeson- zur Welt. Oft bleiben lebenslange Behinderungen zurück. ernsthafte Suchterkrankung. Hier gilt: Wir müssen über dere der Kinder und Jugendlichen im Blick. Gerade auch FAS ist zu 100 Prozent vermeidbar, durch konsequenten diese Suchtform reden, aufklären und den Betroffenen die das Thema „Computerspiel- und Internetabhängigkeit“ Alkoholverzicht werdender Mütter während der Schwan- richtige Hilfe anbieten. Auch Filme können hier einen rückt zunehmend ins Blickfeld. Neue Zahlen und gerschaft. Doch noch immer weiß nicht einmal jeder Beitrag zur Aufklärung leisten – so etwa ein jüngst in Erhebungen aus der wissenschaftlichen Praxis belegen Zweite in Deutschland, dass Alkoholkonsum in der Berlin gedrehter, international besetzter deutscher einen Anstieg verhaltensbezogener Störungen. Auch hier Schwangerschaft zu bleibenden Schäden beim Kind Spielfilm, der das Thema Glücksspielsucht betrachtet. sind besonders junge Menschen betroffen. Daher bedarf es führen kann. Aufklärung ist daher zentral. Sie stand auch Einer der Protagonisten, der Schauspieler Christian Wolff, guter Angebote der Beratung und Behandlung. im Zentrum meiner 1. Jahrestagung zum Thema. wird in der Rubrik „Vorgestellt“ porträtiert. Deutschlands Suchtberatungs- und Drogenhilfesystem Prävention wie diese spielt eine wesentliche Rolle in der Die „Vorgestellt“-Rubrik und die neuen Fokuskästen zu zielt darauf, von Suchterkrankungen Betroffenen Drogen- und Suchtpolitik. -

Drogen- Und Suchtbericht Juli 2014 Und Suchtbericht Juli Drogen
Drogen- und Suchtbericht Juli 2014 und Suchtbericht Juli Drogen- Drogen-Drogen- und Suchtberichtund Suchtbericht Mai 2015 Juli 2014 www.drogenbeauftragte.de Arbeit stehen. Das beginnt bereits mit dem noch ungebo- besorgniserregend. Die Auswirkungen, die nicht nur den diesen neuen Formen von Suchtmitteln besser entgegen renen Leben. Noch immer kommen in Deutschland viel Abhängigen selbst sondern sein gesamtes Umfeld treffen, wirken können. Das ist mir wichtig, denn ich habe immer zu viele Kinder mit dem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) sind oft dramatisch. Schnell wird aus dem Spiel eine die Gesundheit der Menschen und insbesondere der zur Welt. Oft bleiben lebenslange Behinderungen zurück. ernsthafte Suchterkrankung. Hier gilt: Wir müssen über Kinder und Jugendlichen im Blick. Gerade auch das FAS ist zu 100 Prozent vermeidbar, durch konsequenten diese Suchtform reden, aufklären und den Betroffenen die Thema „Computerspiel- und Internetabhängigkeit“ rückt Alkoholverzicht werdender Mütter während der Schwan- richtige Hilfe anbieten. Auch Filme können hier einen zunehmend ins Blickfeld. Neue Zahlen und Erhebungen gerschaft. Doch noch immer weiß nicht einmal jeder Beitrag zur Aufklärung leisten – so etwa ein jüngst in aus der wissenschaftlichen Praxis belegen einen Anstieg Zweite in Deutschland, dass Alkoholkonsum in der Berlin gedrehter, international besetzter deutscher verhaltensbezogener Störungen. Auch hier sind besonders Schwangerschaft zu bleibenden Schäden beim Kind Spielfilm, der das Thema Glücksspielsucht betrachtet. junge Menschen betroffen. Daher bedarf es guter Angebote führen kann. Aufklärung ist daher zentral. Sie stand auch Einer der Protagonisten, der Schauspieler Christian Wolff, der Beratung und Behandlung. im Zentrum meiner 1. Jahrestagung zum Thema. wird in der Rubrik „Vorgestellt“ porträtiert. Deutschlands Suchtberatungs- und Drogenhilfesystem Prävention wie diese spielt eine wesentliche Rolle in der Die „Vorgestellt“-Rubrik und die neuen Fokuskästen zu zielt darauf, von Suchterkrankungen Betroffenen Drogen- und Suchtpolitik. -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 18/130 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 130. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 15. Oktober 2015 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Tagesordnungspunkt 5: nung. 12553 A a) – Zweite und dritte Beratung des von den Absetzung der Tagesordnungspunkte 5 f und Fraktionen der CDU/CSU und SPD 15. 12554 A eingebrachten Entwurfs eines Asylver- fahrensbeschleunigungsgesetzes Nachträgliche Ausschussüberweisungen .... 12554 A Drucksachen 18/6185, 18/6386 ...... 12576 D Begrüßung der Präsidentin des Seimas der – Bericht des Haushaltsausschusses ge- Republik Litauen, Frau Loreta Graužinienė . 12570 A mäß § 96 der Geschäftsordnung Drucksache 18/6387 .............. 12576 D Tagesordnungspunkt 4: b) Beschlussempfehlung und Bericht des In- Abgabe einer Regierungserklärung durch die nenausschusses Bundeskanzlerin: zum Europäischen Rat am – zu dem Antrag der Abgeordneten Ulla 15./16. Oktober 2015 in Brüssel Jelpke, Jan Korte, Sigrid Hupach, wei- terer Abgeordneter und der Fraktion Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin ....... 12554 D DIE LINKE: Flüchtlinge willkommen Dr. Sahra Wagenknecht (DIE LINKE) . 12559 A heißen – Für einen grundlegenden Wandel in der Asylpolitik Thomas Oppermann (SPD) .............. 12561 C – zu dem Antrag der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Sabine Zimmermann Katrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/ (Zwickau), weiterer Abgeordneter und DIE GRÜNEN) ..................... 12564 B der Fraktion DIE LINKE: Alle Flücht- Volker Kauder (CDU/CSU) .............. 12566 A linge willkommen heißen – Gegen eine Politik -

Deutscher Bundestag
Deutscher Bundestag 152. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, 28.Januar 2016 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 2 Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte - Drucksachen 18/7207 und 18/7367 - Abgegebene Stimmen insgesamt: 572 Nicht abgegebene Stimmen: 58 Ja-Stimmen: 442 Nein-Stimmen: 82 Enthaltungen: 48 Ungültige: 0 Berlin, den 28.01.2016 Beginn: 14:01 Ende: 14:05 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Iris Eberl X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) X Dr. -

Plenarprotokoll 18/39
Inhaltsverzeichnis Plenarprotokoll 18/39 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 39. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 5. Juni 2014 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- Daniela Kolbe (SPD) . 3332 B neten Rudolf Henke, Robert Hochbaum und Herbert Behrens . 3315 A Albert Stegemann (CDU/CSU) . 3333 B Absetzung der Tagesordnungspunkte 11 und 12 3315 B Antje Lezius (CDU/CSU) . 3334 D Erweiterung der Tagesordnung . 3315 B Tagesordnungspunkt 5: Tagesordnungspunkt 4: a) Erste Beratung des von der Bundesregie- rung eingebrachten Entwurfs eines Zwei- Erste Beratung des von der Bundesregierung ten Gesetzes zur Änderung des Staats- eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur angehörigkeitsgesetzes Stärkung der Tarifautonomie (Tarifauto- Drucksache 18/1312 . 3336 A nomiestärkungsgesetz) Drucksache 18/1558 . 3315 B b) Erste Beratung des von den Abgeordneten Andrea Nahles, Bundesministerin Jan Korte, Sevim Dağdelen, Dr. André BMAS . 3315 D Hahn, weiteren Abgeordneten und der Klaus Ernst (DIE LINKE) . 3317 B Fraktion DIE LINKE eingebrachten Ent- wurfs eines Gesetzes über die Aufhe- Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/ bung der Optionsregelung im Staatsan- DIE GRÜNEN) . 3318 C gehörigkeitsrecht Karl Schiewerling (CDU/CSU) . 3320 A Drucksache 18/1092 . 3336 A Michael Schlecht (DIE LINKE) . 3321 B Dr. Günter Krings, Parl. Staatssekretär BMI . 3336 B Karl Schiewerling (CDU/CSU) . 3321 D Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/ Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 3337 D DIE GRÜNEN) . 3322 A Sevim Dağdelen (DIE LINKE) . 3338 D Dr. Carola Reimann (SPD) . 3323 B Aydan Özoguz, Staatsministerin Jutta Krellmann (DIE LINKE) . 3324 B BK . 3340 B Dr. Matthias Zimmer (CDU/CSU) . 3325 B Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/ Brigitte Pothmer (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) . 3342 C DIE GRÜNEN) .