Parapotamische Nutzungssysteme Wiesenwässerung Am Fuß Des Kaiserstuhls
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
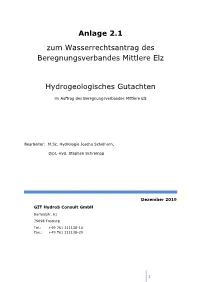
Documentation Standard of Bore Data for Water Corporation
Anlage 2.1 zum Wasserrechtsantrag des Beregnungsverbandes Mittlere Elz Hydrogeologisches Gutachten im Auftrag des Beregnungsverbandes Mittlere Elz Bearbeiter: M.Sc. Hydrologie Joscha Schelhorn, Dipl.-Hyd. Stephen Schrempp Dezember 2019 GIT HydroS Consult GmbH Bertoldstr. 61 79098 Freiburg Tel.: +49 761 211138-10 Fax.: +49 761 211138-29 1 Inhaltsverzeichnis 1 VERANLASSUNG UND ZIELSETZUNG ................................................................. 8 2 EINLEITUNG ....................................................................................................................... 10 2.1 Geologie ............................................................................................................................................ 10 2.2 Porengrundwasserleiter .................................................................................................................... 12 2.3 Kluftgrundwasserleiter ...................................................................................................................... 13 2.4 Trennschicht ...................................................................................................................................... 15 3 BEWERTUNG DER AKTUELLEN DATENGRUNDLAGE IM ELZ-GLOTTER- SCHWEMMFÄCHER ........................................................................................................................ 16 3.1 Böden im Elz-Glotter-Schwemmfächer .............................................................................................. 16 3.2 Grundwasserneubildung -

EG-Wasserrahmenrichtlinie Bericht Zur Bestandsaufnahme
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE Umsetzung der WRRL im Bearbeitungsgebiet Oberrhein EG-Wasserrahmenrichtlinie Bericht zur Bestandsaufnahme Teilbearbeitungsgebiet 31 Elz-Dreisam Textband Bearbeitungsstand: 20. Juni 2005 Regierungspräsidium Karlsruhe - Flussgebietsbehörde - Impressum: Koordination: Regierungspräsidium Karlsruhe, Flussgebietsbehörde Abteilung Umweltschutz und Wasserwirtschaft, Karlsruhe Bearbeitung und Gewässerdirektion Südlicher Oberrhein Gestaltung: Bereich Offenburg ab 1.1.2005 Regierungspräsidium Freiburg Fachliche Beteiligung: Regierungspräsidien Freiburg und Karlsruhe Landkreise: Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Ortenau Stadtkreis: Freiburg Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Freiburg Gewässerdirektion Südlicher Oberrhein/Hochrhein Bereich Waldshut Landesanstalt für Umweltschutz, Projektgruppe Wasserrahmenrichtlinie, Karlsruhe Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Freiburg Freiburg, April 2005 Textband: WRRL-Bestandsaufnahme Teilbearbeitungsgebiet Elz-Dreisam Seite II Bearbeitungsstand 20.06.2005 INHALTSÜBERSICHT VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN V 0 EINFÜHRUNG 7 1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES TEILBEARBEITUNGSGEBIETES ELZ-DREISAM 10 1.1 Übersicht und Basisinformationen 10 1.2 Lage und Grenzen 11 1.3 Raumplanung und Landnutzung 11 1.4 Naturräume 12 1.5 Gewässer 12 1.5.1 Oberflächengewässer 12 1.5.2 Grundwasser 15 2 WASSERKÖRPER 16 2.1 Oberflächengewässer 16 2.1.1 Abgrenzung, Beschreibung und Typologie 16 2.1.2 Referenzmessstellen 20 2.1.3 Diagnose des Ist-Zustandes der Gewässer 20 2.2 Grundwasserkörper 23 2.2.1 Abgrenzung -

Fauna Und Flora Europaweit Schützen „Heim-Spiel“ Auftakt Zum Managementplan Des FFH-Gebietes Kandelwald, Roßkopf Und Zartener Becken Am 19
Dreisam Stromer Unser Bürgerbus fürs Dreisamtal. neuer, attraktiver Fahrplan mit Buchenbach Für anspruchsvolle vier Linien mit täglich Immobilien gleichen Zeiten Telefon 0761 211679-0 kostenlose Mitfahrt stauss-immobilien.de Infos und Fahrplan unter www.dreisam-stromer.de Initiiert und unterstützt von Anzeigen/Redaktion: Tel. 0 76 61 / 35 53 • Fax 35 32 • eMail: [email protected] 33. Jahrgang • Nr. 29 • Mittwoch, 17. Oktober 2018 rz SI-14-0203 AZ Markgräfler Bürgerblatt 45x6327.06.17 4c.indd 10:27 1 Fauna und Flora europaweit schützen „Heim-Spiel“ Auftakt zum Managementplan des FFH-Gebietes Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken am 19. Oktober. Vorverkauf ab Freitag Oberried (hs.) Nach den gro- KÜRBIS ßen Erfolgen in den Vorjahren WOCHEN findet auch 2018 wieder ein 1. – 31. OKTOBER „Heim-Spiel“ statt, ein unter- haltsamer Abend mit Oberrie- delikat-raffinierter der Künstlern. Am Freitag, dem herbstgenuss 19. Oktober ab 20 Uhr in der Klosteerschiire. Ein knappes Dutzend heimischer Talente aus Musik, Kabarett und Theater unterhält das Publikum mit 79104 FREIBURG · KARTÄUSERSTR. 99 T: 07 61.3 34 02 · WWW.ZUM-STAHL.DE einem kurzweiligen Programm. Alle Künstler treten ohne Gage auf, der Erlös aus den Ein- Heute! trittsgeldern kommt in voller Höhe sozialen Einrichtungen in Kirchzartens Betreuungs- der Gemeinde zugute. Eintritt einrichtungen stellen EUR 12,-, Karten im Vorver- sich vor kauf bei der Tourist-Info und Informationsabend im Kurhaus dem Dreisamtäler-Büro in Kirch- mit vielen Möglichkeiten für zarten sowie bei den Oberrieder persönliche Fragen Bäckereien Ruf und Steimle. Und Kirchzarten (glü). Am Mittwoch, an der Abendkasse. dem 17. Oktober 2018 fi ndet ab 19 Die Künstler freuen sich über Uhr im Großen Saal des Kurhauses ein möglichst volles Haus in der wieder ein Infoabend aller Betreu- wunderschönen Klosterschiire. -

Gewässerentwicklung an Der Dreisam
Regierungspräsidium Freiburg, DS Bad Säckingen, Landesbetrieb Gewässer Gewässerentwicklung Dreisam, Freiburg-Kartauswiese Dezember 2012 Gewässerentwicklung an der Dreisam auf der Gemarkung Stadt Freiburg, Bereich Kartauswiese Fluss-km 23+040 bis 24+000 Ausgleich- und Ersatzmaßnahme E 1.4, Ausbau-/Neubaustrecke Karlsruhe-Basel PfA 8.2, Freiburg-Schallstadt und PfA 8.3, Bad Krozingen-Heitersheim Auftraggeber Bauherr DB ProjektBau Gmbh DB Netz AG Regionalbereich Südwest Großprojekt Karlsruhe-Basel Schwarzwaldstraße 82 76137 Karlsruhe Antragsteller Planungs- und Baumanagement Land Baden-Württemberg, vertreten durch: Regierungspräsidium Freiburg Regierungspräsidium Freiburg Dienstsitz Bad Säckingen Abteilung Umwelt Abteilung Umwelt, Referat 53.1 Referat 53.1, Landesbetrieb Gewässer Rathausplatz 5 Bissierstr. 7 79713 Bad Säckingen 79114 Freiburg Landschaftsplanung kamm + pohla dip l. ing . freie landschaftsarch itekt inne n schwarzwaldstr. 3 79539 lörrach tel. 07621 / 86200 fax 07621 / 8629 9 mail: [email protected] Seite 1 von 11 Regierungspräsidium Freiburg, DS Bad Säckingen, Landesbetrieb Gewässer Gewässerentwicklung Dreisam, Freiburg-Kartauswiese Inhalt Lageplan, großräumig 3 Lageplan 4 Aufgabenstellung 5 Begründung 5 EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Zustandsbeschreibung 6 Allgemeines Naturräumliche Gliederung / Geologie Gewässertyp / Gewässersystem / Gewässer- Strukturgüte Maßnahmebeschreibung 8 Hydrologische Daten 9 Fischfauna Naherholung Naturschutzfachliche Belange 10 Bepflanzung /Landschaftspflegerischer Begleitplan Kampfmitteluntersuchung -

Heritage Interpretation Als Element Eines Nachhaltigen Tourismus Im Pilotprojekt Interpretationsraum Kandel, Südschwarzwald ‐ Eine Evaluation Mittels GPS‐Tracking
Heritage Interpretation als Element eines nachhaltigen Tourismus im Pilotprojekt Interpretationsraum Kandel, Südschwarzwald ‐ eine Evaluation mittels GPS‐Tracking Inaugural‐Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg i. Brsg. vorgelegt von Anna Chatel‐Messer Freiburg im Breisgau 2013 Dekan: Frau Prof. Dr. Barbara Koch Referent: Herr Prof. Dr. Rainer Glawion Korreferent: Herr Prof. Dr. Tim Freytag Gutachter: Herr Prof. Dr. Axel Drescher Disputationsdatum: 14. November 2013 II Für meinen Vater Rudolf III IV Danksagungen Mein herzlicher Dank gilt Herrn Prof. Dr. Rainer Glawion und Herrn Prof. Dr. Tim Freytag, die meine Arbeit betreuten und mich beide sehr in meinem Vorhaben unterstützten. Weiterhin danke ich Herrn Prof. Dr. Axel Drescher, der die Zweitbegutachtung der Arbeit übernommen hat, sowie Frau Prof. Dr. Heidi Megerle, die wertvolle Erfahrungen und Anmerkungen bei‐ steuerte. Monika Nethe hat einen großen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet, da sie tagtäglich meine Ansprechpartnerin für Fragen war und mit mir engagiert über die Inhalte diskutierte. Patrick Lehnes machte mich als Erster mit dem Ansatz Heritage Interpretation vertraut und gab mir sehr hilfreiche Gedanken und Erfahrungen weiter. Dr. Thomas Uhlendahl und Dr. Hans‐Jörg Weber danke ich für die Hilfe beim Erstellen des Fragebogens und vielen weiteren wertvollen, fachlichen Tipps. Angelika Schuler danke ich für die Unterstützung bei bürokratischen Hürden und ihre warm‐ herzige Art. Vielen Dank -

Nachruf Schnitts Kommt Es Auf Der Föhrentalstraße Ab
49. JahrgangtWoche 18 Donnerstag, den 02. Mai 2019 Hochgenuss im Südschwarzwald Herausgeber: Gemeindeverwaltung Glottertal. Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Herbstritt o. V. i. A. Vorankündigung Panoramafreibad Glottertal Das Panoramafreibad önet am Samstag, den 11. Mai 2019 (Bei schlechtem Wetter eine Woche später, am 18. Mai 2019) Nähere Informationen im kommenden Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Gemeinde Glottertal. Kartenvorverkauf startet früher Ab kommendem Dienstag, 07. Mai bis einschließlich Freitag, 10. Mai startet der Kartenvorverkauf direkt an der Kasse im Freibad Glottertal, täglich, in der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr Vollsperrung Föhrentalstraße II. Bauabschnitt Zu einer weiteren Vollsperrung, im Rahmen des II. Bauab- Nachruf schnitts kommt es auf der Föhrentalstraße ab Die Gemeinde und die Freiwillige Feuerwehr Glottertal trau- Montag, dem 06. Mai - voraussichtlich für 14 Tage - ert um ihren Mitbürger und Kameraden bis einschließlich zum 17.05.2019 Georg Eble Die Vollsperrung erfolgt in Höhe des Schäehofes, talauf- wärts, täglich zwischen 7.30 und 17.00 Uhr. der vergangene Woche im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Es ist in dem genannten Zeitraum keine Durchfahrt und keine Im Jahre 1946 trat er in die Wehr ein und war seither ununter- Umfahrung der Baustelle möglich. brochen Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Glottertal. Er war ein langjähriger und geschätzter Kamerad. Wir bitten die Anlieger um Verständnis und Beachtung. Sein vorbildliches und kameradschaftliches Verhalten wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben. Gemeinde Glottertal Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. Glottertal, im April 2019 Gemeinde Glottertal Freiwillige Feuerwehr Glottertal Karl Josef Herbstritt Daniel Reichenbach Bürgermeister Kommandant Seite 2 Donnerstag, den 02. Mai 2019 Geschwindigkeitsmessungen Datum: 09.04.2018 folgende Geschwindigkeitsmessung wurde vom Landkreis Zul. -

Unser Beraterteam Ist Für Sie
Hauszeitung der GEPflegt Kirchlichen Sozialstation Elz/Glotter e.V. Ausgabe 28 • 2016 Themen dieser Ausgabe Seiten 2 + 3 Schlaf gut! Mit Schlafhilfen aus der Natur Seite 4 Liebe Leserin, lieber Leser, Neue Ausbildung: Von der Krankenschwester dass unsere Tagespflege das ge zur Pflegefachfrau worden ist, was sie ist, verdanken wir vor allem Jutta Wahl. Sie hat Unsere Beratung ist teilweise die „Glockenblume“ zu einem kostenfrei und wird unter über aus erfolgreichen, beliebten bestimmten Voraussetzungen von Betreuungsangebot gemacht, das den Kostenträgern übernommen. Fotos: Robert Kneschke, fotolia.com Robert Kneschke, Fotos: in Denzlingen heute nicht mehr Umfassend und individuell wegzudenken ist. Mit ihrem Kön nen und ihrem Gestaltungs willen, ihren Ideen und ihrer Weitsich t Unser Beraterteam ist für Sie da! ging Jutta Wahl von Anfang an Pflegesituationen treten häufig Beraterteam der Kirchlichen Sozial daran, das neue Projekt umzuset s tation ElzGlotter e.V., bestehend unverhofft ein. Im hohen Alter, zen. Es gelang ihr, dafür ein starkes aus vier Beraterinnen und Beratern, Team zu begeistern: Pflegefach nach einer Krankheit oder einem bietet den Rat und Hilfesuchenden kräfte, bürgerschaftlich Engagierte Krankenhausaufenthalt. Unterstützung und Klärung rund in Betreuung und Fahr dienst sowie um die gesetzlichen Leistungen und Angehörige und Betroffene sehen junge Menschen im freiwilligen Möglichkeiten, gibt Auskunft über Dienst. Die Tagespflege „Zur ungewohnte Aufgaben auf sich Hilfsangebote in unseren Gemein den Denzlingen, -

„Echt Kirchzarten“ Mit Achttägigem „Einklang“
Anrufen - Abholen oder Liefern WIR HABEN GEÖFFNET! Tel. 0761 69 69 666 Holzmanufaktur Lorenz GmbH Tel. 0 76 61 - 9 89 39 - 0 holzmanufaktur-lorenz.de Anzeigen / Redaktion: Tel. 0 76 61 / 35 53 • Fax 35 32 • eMail: [email protected] 35. Jahrgang • Nr. 36 • Mittwoch, 9. Dezember 2020 Gasthaus „Echt Kirchzarten“ mit achttägigem „EinKlang“ die Art z u Geniessen Der Gewerbeverein schenkte den Kirchzartenern trotz Corona ein „Weihnachtserlebnis“ gänsebraten to go & mehr jeden tag bis weihnachten täglich 11.30 – 14.30 + 17.30 – 20.30 uhr telefonisch ordern und abholen to go-karte: www.zum-stahl.de Geschenkgutscheine 79104 freiburg ∙ kartäuserstr. 99 t: 0761.33402 ∙ www.zum-stahl.de A-E Sport-BHs von A-H von Sport-BHs Die Passage Freiburger Str. 6 • Kirchzarten Oberkirchs Telefon 07661 / 6 24 48 ToGo-Service www.modestudio-dessous.de für jeden Tag mit wechselnden Tagesgerichten und für ganz besondere Stunden Musik zur jetzt unser Weihnachts- und Silvestermenü bestellen! Marktzeit www.hotel-oberkirch.de Wieder liegt Musik in der Luft... Münsterplatz 22 • 79098 Freiburg Stegen (dt.) Im Sommer hat es gro- Tel: 07 61 - 2 02 68 68 ßen Anklang gefunden in Stegen: www.hotel-oberkirch.de Zur Marktzeit hat der 25-jährige Pianist Aaron Löchle ein gemisch- tes Programm aus klassischer Weihnachtsferien Klaviermusik von Beethoven, Schubert, Rachmaninov u.a. zum der Mediathek Besten gegeben. Kirchzarten (dt.) Die Mediathek Wegen des Schutzes vor Corona- in der Talvogtei ist vom 24. De- Infektionen sind im Augenblick zember 2020 bis einschließlich 6. Veranstaltungen mit Nähe zuein- Januar 2021 geschlossen. Die On- ander nicht möglich. -

Gänse- Schmaus
Für anspruchsvolle Immobilien Telefon 0761 211679-0 stauss-immobilien.de Anzeigen/Redaktion: Tel. 0 76 61 / 35 53 • Fax 35 32 • eMail: [email protected] 34. Jahrgang • Nr. 32 • Mittwoch, 13. November 2019 rz SI-14-0203 AZ Markgräfler Bürgerblatt 45x6327.06.17 4c.indd 10:27 1 Gasthaus Wieder ein Jahr Pause beim ULTRA Bike die Art z u Geniessen Behörden geben keine Genehmigung für den Black Forest ULTRA Bike Marathon in 2020 feine gansgerichte von st. martin, mo.11.11.19 jeden tag bis weihnachten Gänse- wildwochen schmaus FR. 8. NOV. – SO. 24. NOV. wild aus heimischer Gänsemenü jagd nach original in 4 Gängen + Sorbet 59,– badischen wildrezepten 22.11. bis 79104 freiburg ∙ kartäuserstr. 99 23.12.2019 t: 0761.33402 ∙ www.zum-stahl.de Auf das tolle Startspektakel in Kirchzartens Fußgängerzone müssen die Mountainbike-Freaks im nächsten Jahr verzichten. Foto: Gerhard Lück Kirchzarten (glü.) Im kommen- zuständigen Behörden nicht mehr Daher werden wir die geänderten menden Jahr ist dies zeitlich nicht Infotermine den Jahr wird es keinen Black genehmigt werden kann“, erklärt Rahmenbedingungen annehmen umsetzbar. Für ein stark verein- Forest ULTRA Bike Marathon ULTRA Bike OK-Chef Benjamin und unsere Gespräche mit den fachtes Veranstaltungsprogramm geben. Die Verschärfung der um- Rudiger. Dass es künftig eine Behörden in den kommenden haben wir schon ein paar Ideen, Tag der offenen Tür Fr, 22.11.2019, 14-17 Uhr welt- und naturschutzrechtlichen Herausforderung würde, eine Ge- Monaten fortführen, um zusammen an denen wir in den nächsten Wo- Aufl agen verhindert die weitere nehmigung für die Veranstaltung ein Konzept zu erstellen, das eine chen weiterarbeiten. -
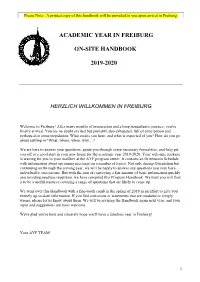
AYF On-Site Handbook 2019-20
Please Note: A printed copy of this handbook will be provided to you upon arrival in Freiburg. ACADEMIC YEAR IN FREIBURG ON-SITE HANDBOOK 2019-2020 HERZLICH WILLKOMMEN IN FREIBURG Welcome to Freiburg! After many months of preparation and a long transatlantic journey, you've finally arrived. You are no doubt excited but probably also exhausted, full of anticipation and perhaps also some trepidation. What awaits you here, and what is expected of you? How do you go about settling in? What, where, when, why…? We are here to answer your questions, guide you through some necessary formalities, and help get you off to a good start in your new home for the academic year 2019-2020. Your welcome package is waiting for you in your mailbox at the AYF program center. It contains an Orientation Schedule with information about upcoming meetings on a number of topics. Not only during Orientation but continuing on through the coming year, we will be happy to answer any questions you may have individually, one-on-one. But with the aim of conveying a fair amount of basic information quickly and avoiding needless repetition, we have compiled this Program Handbook. We trust you will find it to be a useful resource covering a range of questions that are likely to come up. We went over this Handbook with a fine-tooth comb in the spring of 2019 in an effort to give you entirely up-to-date information. If you find omissions or statements that are outdated or simply wrong, please let us know about them. -

TBG 31 Anhang Tabellen 09
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE Umsetzung der WRRL im Bearbeitungsgebiet Oberrhein EG-Wasserrahmenrichtlinie Bericht zur Bestandsaufnahme Teilbearbeitungsgebiet 31 Elz-Dreisam Anhangsband: Karten und Tabellen Bearbeitungsstand: Mai 2005 Regierungspräsidium Karlsruhe - Flussgebietsbehörde - Inhaltsverzeichnis Anhangsband Karten K 1.1 Übersichtskarte TBG Elz/Dreisam K 2.1 Biologische Gewässergüte nach LAWA K 2.2 Gewässerstruktur nach LAWA K 3.1 Flusswasserkörper und Seewasserkörper K 4.1 Biozönotisch bedeutsame Gewässertypen K 5.1 Abgrenzung der Grundwasserkörper K 6.1 Vorauswahl - Künstliche und erheblich veränderte Gewässerabschnitte und Seen K 6.2 Signifikante morphologische Veränderungen K 6.3 / Teil 1 Signifikante Abflussregulierung K 6.3 / Teil 2 Signifikante Wasserentnahme K 6.4 Hydraulische Belastung durch Siedlungsentwässerung K 7.1 Signifikante Punktquellen K 7.2 Bestehende Messstellen OG K 7.3 Stickstoffeinträge in Oberflächengewässer K 7.4 Phosphoreinträge in Oberflächengewässer K 7.5 Immissionssituation der Fließgewässer - Ökologische Zustandskomponenten, Teil 1 K 7.6 Immissionssituation der Fließgewässer - Ökologische Zustandskomponenten, Teil 2 K 7.7 Immissionssituation der Fließgewässer - Chemische Zustandskomponenten K 7.8 Gefährdungsabschätzung der Flüsse und Seen K 9.1.1 Hydrogeologische Teilräume und tiefe Grundwasservorkommen K 9.1.2 Hydrogeologische Einheiten K 9.2 Schutzpotenzial K 9.3 Erstmalige Beschreibung GW, Belastung Punktquellen, TBG Elz/Dreisam K 9.4.1 Erstmalige Beschreibung GW: Diffuse Belastungen GW - Nitrat -

Key Actors in Emerging Regional Transitions to Renewable Energy
Working Paper 08 - 2015 Key Actors in Emerging Regional Transitions to Renewable Energy Self-Sufficiency A Qualitative Analysis of the District Breisgau- Hochschwarzwald in Germany Lena Lungstrass Published by: Centre for Renewable Energy Zentrum für Erneuerbare Energien University of Freiburg Tennenbacher Str. 4 79106 Freiburg Germany Tel.: +49 (0) 761-203-3689 Fax: +49 (0) 761-203-3690 E-Mail: [email protected] Web: www.zee-uni-freiburg.de ISSN online: 2191-0685 ISSN print: 2191-0677 In 2010, the Centre for Renewable Energy initiated its work on a series of working papers. The primary objective of these papers is to stimulate discussion in the field of sustainable energy in Europe as well as on a global scale. An accurate citation of the findings, interpretations and opinions included in these papers must be ensured. They reflect the work of their authors and do not reflect the opinions of the Centre for Renewable Energy or the University of Freiburg. We welcome feedback from readers and request that they convey their comments and criticisms directly to the authors. Author: Lena Lungstrass Centre for Renewable Energies Tennenbacherstr. 4 79104 Freiburg [email protected] Lena Lungstrass completed her Bachelor’s degree in “Sustainable Environmental Management” at the University of Edinburgh. Since 2013 she worked at Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems. She studied “M.Sc. Renewable Energy Management” at the University of Freiburg from which she graduated in 2015. For her master thesis, which serves as base for this working paper, she analyzed the role of key actors in emerging renewable energy transitions.