„In Der Frischen Tradition Des Herbstes 1989"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Saurer Apfel
Deutschland Länder. Parteichef Oskar La- fontaine habe „ganz deutli- che Worte gesprochen“, rühmt Ringstorff, „wir ent- scheiden hier, wie die Re- gierung gebildet wird“. Was für die Mecklenburg- Vorpommerschen Sozialde- mokraten das Beste ist, da sind sich Spitzengenossen vor Ort einig – ein echtes Bündnis mit der PDS. Nur so seien die Postkommuni- sten zu disziplinieren. Das Wahlergebnis zwinge die SPD, sagt der Noch-Bundes- tagsabgeordnete Tilo Brau- ne aus Greifswald, „in den K. B. KARWASZ sauren Apfel der rot-roten Sozialdemokrat Ringstorff (r.), PDS-Landeschef Holter (hinten M.)*: „Größere Nähe“ Koalition zu beißen“. Und selbst Justizminister Rolf Eg- die sich erst einmal in der Opposition re- gert, Intimfeind der PDS, hat eingelenkt. MECKLENBURG-VORPOMMERN generiert. Eggert schwächte seine Drohung ab, er ste- Daß Ringstorff die Union überhaupt he für ein SPD-PDS-Kabinett nicht zur Ver- Saurer Apfel zum – unverbindlichen – Plausch lud, und fügung: „Das müßte ich mir überlegen.“ zwar noch vor der PDS, war ein geschick- Eine wichtige Rolle dürfte bei den Ver- Die SPD in Schwerin ter Zug: So erhöht er den Druck auf die handlungen der beiden Wahlsieger spie- Postkommunisten, die unbedingt mit an len, wen die PDS als ministrabel präsen- ist offiziell nach allen Seiten die Macht wollen, ihre Forderungen im tiert. Ihren Chef Holter, 45, etwa hält verhandlungsbereit. Doch vornhinein zu mäßigen. Dieselbe Strate- Ringstorff für einen „lupenreinen Sozial- die Signale stehen auf Rot-Rot. gie hat der clevere SPD-Mann schon vor demokraten“. Der frühere FDJler Andreas vier Jahren mit umgekehrten Vorzeichen Bluhm, 38, für das Amt des Kultusmini- as eierst du so rum“, raunzte der erfolgreich angewandt, um den Preis für sters im Gespräch, tritt heute so jovial auf Vorsitzende der Gewerkschaft eine Große Koalition hochzutreiben. -

Aufs Arbeitsamt“
DEUTSCHLAND A. MELDE / CONTRAST PRESS MELDE PRESS Ostdeutscher Minister Ortleb (Januar 1994), ostdeutsche Ministerin Merkel: „Wir können viele Dinge allein“ Die Bürgerrechtler Angelika Barbe Abgeordnete (SPD), Stephan Hilsberg (SPD) oder Wolfgang Ullmann (Bündnis 90) fielen in Bundestagsdebatten und -gremien durchaus auf, blieben aber Solisten. Aufs Uwe Lühr, der 1990 als einziger Li- beraler ein Direktmandat in Halle ge- wonnen hatte, mußte als FDP-Gene- Arbeitsamt ralsekretär abdanken, weil Klaus Kin- kel Parteichef wurde: „Der Kinkel Der Frust ist groß, doch die mei- brauchte keinen mehr, der sich um die sten ostdeutschen Parlamentarier Ost-West-Integration kümmert.“ Daß sie Ostdeutsche seien, mit anderen Er- wollen wieder in den Bundestag. fahrungen und Biographien, meint Rolf Schwanitz (SPD), „hielten wir für ie Debatte über seinen Kanzler- die Geschäftsgrundlage“. Zu spät sei Etat Anfang September war in ihnen klargeworden, übt Uwe Küster Dvollem Gang, als Helmut Kohl (SPD) Selbstkritik, „daß es nicht nur einfiel, daß sich jetzt eine Ostdeutsche reicht, fleißig am Schreibtisch zu sit- am Rednerpult des Bundestages gut zen“. machen würde. Wo denn die Angela DARCHINGER Anfangs fanden die Ostdeutschen in Merkel sei, herrschte er seinen Staats- Ostabgeordnete Enkelmann ihren Parteien sogar Gehör. Die SPD minister Anton Pfeifer an. Kleiner Triumph legte fest, daß in jede Arbeitsgruppe Die einzige ostdeutsche Frau in der Fraktion einer der 35 Ostgenossen Kohls Kabinett war in ihrem Dienstwa- Udo Haschke, riß es von den Sitzen delegiert werden sollte. Schwanitz saß gen auf dem Weg zu einem Interview hoch: „Genau, genau“, rief der anson- nicht nur der Fraktionsgruppe „Deut- beim Norddeutschen Rundfunk. Über sten stille Mann, der für den nächsten sche Einheit“ vor, er mußte in zehn Autotelefon erreichte Pfeifer die plötz- Bundestag nicht mehr kandidiert, anderen Kommissionen, Ausschüssen lich Begehrte. -

Rede Von Willy Brandt Vor Dem Bundestag (Berlin, 20
Rede von Willy Brandt vor dem Bundestag (Berlin, 20. Dezember 1990) Legende: Am 20. Dezember 1990 hält Willy Brandt im Reichstagsgebäude in Berlin die Eröffnungsrede der ersten Sitzungsperiode des gesamtdeutschen Bundestages. Quelle: Verhandlungen des deutschen Bundestages. 12. Wahlperiode. 1. Sitzung vom 20. Dezember 1990. Stenographische Berichte. Hrsg. Deutscher Bundestag und Bundesrat. 1990. [s.l.]. p. 1-5. Urheberrecht: Alle Rechte bezüglich des Vervielfältigens, Veröffentlichens, Weiterverarbeitens, Verteilens oder Versendens an Dritte über Internet, ein internes Netzwerk oder auf anderem Wege sind urheberrechtlich geschützt und gelten weltweit. Alle Rechte der im Internet verbreiteten Dokumente liegen bei den jeweiligen Autoren oder Anspruchsberechtigten. Die Anträge auf Genehmigung sind an die Autoren oder betreffenden Anspruchsberechtigten zu richten. Wir weisen Sie diesbezüglich ebenfalls auf die juristische Ankündigung und die Benutzungsbedingungen auf der Website hin. URL: http://www.cvce.eu/obj/rede_von_willy_brandt_vor_dem_bundestag_berlin_20_dezember_1990-de-669808da- 6123-40e4-ae08-c548f204118e.html Publication date: 03/07/2013 1 / 9 03/07/2013 Rede von Willy Brandt vor dem Bundestag (Berlin, 20. Dezember 1990) Alterspräsident Brandt: Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der guten Ordnung halber darf ich fragen: Ist jemand im Saal, der vor dem 18. Dezember 1913 geboren wurde? — Das scheint keiner zugeben zu wollen oder zu können. (Heiterkeit und Beifall) Dann darf ich Sie, meine werten Kolleginnen und Kollegen, Mitglieder des am 2. Dezember gewählten 12. Deutschen Bundestages, hier im Reichstagsgebäude in der Hauptstadt Berlin willkommen heißen und die 1. Sitzung der 12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages eröffnen. Erstmals nach vielen Jahrzehnten versammeln sich die in gesamtdeutschen freien Wahlen bestimmten Abgeordneten, fürwahr ein Ereignis, das historisch genannt werden wird. -

Agenda 2010“ in Der SPD: Ein Beispiel Mangelnder Innerparteilicher Demokratie?
Bamberger Beiträge zur Vergleichenden Politikwissenschaft Heft 2 Simon Preuß Der Willensbildungsprozess zur „Agenda 2010“ in der SPD: Ein Beispiel mangelnder innerparteilicher Demokratie? Überarbeitete und gekürzte Version der Diplomarbeit zum selben Thema Inhaltsverzeichnis I Einleitung .................................................................................................................................................- 1 - II Innerparteiliche Demokratie in der theoretischen Diskussion ............................................................- 9 - 1. Verschiedene Modelle innerparteilicher Demokratie.........................................................................- 10 - 2. Das Grundgesetz und das Parteiengesetz von 1967 ...........................................................................- 11 - 3. Michels „ehernes Gesetz der Oligarchie“..........................................................................................- 13 - 3.1. Ursachen der Oligarchisierung..................................................................................................- 13 - 3.2. Machtressourcen der Parteiführung...........................................................................................- 14 - 4. Neuere Arbeiten zur innerparteilichen Demokratie............................................................................- 15 - 5. Parteien als „lose verkoppelte Anarchien“?......................................................................................- 17 - 6. Neuere empirische Untersuchungen zu Machtressourcen -

DER SPIEGEL Jahrgang 1994 Heft 45
Werbeseite Werbeseite MNO DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung Betr.: SPIEGEL-Gespräch, Jugend a Das große Ereignis ist fünf Jahre her, das Thema aber hochaktuell: Damals, am 4. November 1989, hatten eine Million Menschen auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz gegen das Honecker-Regime prote- stiert; letzte Woche lud der SPIEGEL fünf der Red- ner jenes Tages und die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley, die sich seinerzeit verweigert hatte, zum Gespräch ins Audimax der Humboldt-Universität ein. “Was aus den Träumen wurde“ hieß das Motto, und gespannt auf die Antworten waren gut 2000 Besucher – weit mehr, als in den Saal paßten. Außer der Reihe war alles an diesem Abend. Es war das erste öffentliche SPIEGEL-Gespräch, und die Öf- fentlichkeit machte sich bemerkbar. Mit Beifall, mit Pfiffen, und mancher Zwischenrufer “verwechsel- te“, wie die Berliner Zeitung notierte, den Wort- streit “mit einem Tribunal“. Einvernehmen gab es, wie zu erwarten, auch auf dem Podium nicht. Immer- hin saßen da nun Leute beisammen, die sich vorher nicht mal ein Kopfnicken gegönnt hatten. Markus Wolf, der einstige Stasi-General, bot Bärbel Bohley eine Entschuldigung an. Bohley, etwas gereizt: “Ich habe Ihnen heute doch íGuten Tag’ gesagt.“ Zwei- einhalb Stunden lang dauerte der Dialog über die deutschen Wege und Irrwege. Für dieses Heft wurde er auf den Kern gebracht (Seite 40). a Rudolf Scharping ist ein schneller Leser. Kaum war das neue SPIEGEL special (“Die Eigensinnigen“) aus- geliefert, ließ er bei der 24jährigen Ost-Berline- rin Maria Voigt, einer der Autorinnen dieses Hefts, anfragen: ob sie am Mittwoch dieser Woche im Reichstag über den Mauerfall und ihr Deutsch- landbild sprechen wolle. -

Association of Accredited Lobbyists to the European Parliament
ASSOCIATION OF ACCREDITED LOBBYISTS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT OVERVIEW OF EUROPEAN PARLIAMENT FORUMS AALEP Secretariat Date: October 2007 Avenue Milcamps 19 B-1030 Brussels Tel: 32 2 735 93 39 E-mail: [email protected] Website: www.lobby-network.eu TABLE OF CONTENTS Introduction………………………………………………………………..3 Executive Summary……………………………………………………….4-7 1. European Energy Forum (EEF)………………………………………..8-16 2. European Internet Forum (EIF)………………………………………..17-27 3. European Parliament Ceramics Forum (EPCF………………………...28-29 4. European Parliamentary Financial Services Forum (EPFSF)…………30-36 5. European Parliament Life Sciences Circle (ELSC)……………………37 6. Forum for Automobile and Society (FAS)…………………………….38-43 7. Forum for the Future of Nuclear Energy (FFNE)……………………..44 8. Forum in the European Parliament for Construction (FOCOPE)……..45-46 9. Pharmaceutical Forum…………………………………………………48-60 10.The Kangaroo Group…………………………………………………..61-70 11.Transatlantic Policy Network (TPN)…………………………………..71-79 Conclusions………………………………………………………………..80 Index of Listed Companies………………………………………………..81-90 Index of Listed MEPs……………………………………………………..91-96 Most Active MEPs participating in Business Forums…………………….97 2 INTRODUCTION Businessmen long for certainty. They long to know what the decision-makers are thinking, so they can plan ahead. They yearn to be in the loop, to have the drop on things. It is the genius of the lobbyists and the consultants to understand this need, and to satisfy it in the most imaginative way. Business forums are vehicles for forging links and maintain a dialogue with business, industrial and trade organisations. They allow the discussions of general and pre-legislative issues in a different context from lobbying contacts about specific matters. They provide an opportunity to get Members of the European Parliament and other decision-makers from the European institutions together with various business sectors. -

BUNDESRAT Stenografischer Bericht 818
Plenarprotokoll 818 BUNDESRAT Stenografischer Bericht 818. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 21. Dezember 2005 Inhalt: Gedenkansprache des Präsidenten zum 6. Gesetz zur Abschaffung der Eigenheim- Völkermord an Sinti und Roma im National- zulage (Drucksache 857/05) ...... 404 B sozialismus .............. 395 A Walter Hirche (Niedersachsen) ... 404 B Amtliche Mitteilungen ......... 397 A Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Nord- rhein-Westfalen) ....... 405 B Zur Tagesordnung ........... 397 C Peer Steinbrück, Bundesminister der Finanzen .......... 405 D 1. Erklärung der Bundeskanzlerin .... 397 C Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin 397 D Beschluss zu 4 bis 6: Zustimmung gemäß Art. 105 Abs. 3 GG. ........ 408 D Präsident Peter Harry Carstensen . 401 B 2. Wahl des Vorsitzenden des Wirtschafts- 7. Erstes Gesetz zur Änderung des Zoll- ausschusses – gemäß § 12 Abs. 3 GO BR – fahndungsdienstgesetzes (Drucksache (Drucksache 843/05) ........ 401 D 858/05 [neu]) ............ 408 D Beschluss: Staatsminister Erwin Huber Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 84 (Bayern) wird gewählt ....... 401 D Abs. 1 GG ............ 409 A 3. Fünftes Gesetz zur Änderung des Dritten 8. Gesetz über den Ausgleich von Arbeit- Buches Sozialgesetzbuch und anderer geberaufwendungen und zur Änderung Gesetze (Drucksache 854/05) ..... 401 D weiterer Gesetze (Drucksache 859/05) . 409 A Prof. Dr. Wolfgang Reinhart (Baden- Württemberg) ........ 402 A Gerry Kley (Sachsen-Anhalt) ... 409 A Karl-Josef Laumann (Nordrhein- Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 84 Westfalen) .......... 403 B Abs. 1 GG ............ 410 A Beschluss: Kein Antrag gemäß Art. 77 Abs. 2 GG . ........... 404 B 9. Fünftes Gesetz zur Änderung der Bun- desnotarordnung (Drucksache 860/05) . 411 C 4. Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm (Drucksache 855/05) Beschluss: Zustimmung gemäß Art. 84 Abs. 1 GG ............427*B in Verbindung mit 10. -

Änderungsantrag Der Abgeordneten Dr
Deutscher Bundestag Drucksache 12/8171 12. Wahlperiode 29. 06. 94 Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Konrad Elmer, Susanne Rahardt-Vahldieck, Dr. Christoph Schnittler, Horst Eylmann, Dr. Michaela Blunk (Lübeck), Dr. Eberhard Brecht, Günther Bredehorn, Ursula Burchardt, Eike Ebert, Dr. Horst Ehmke, Helmut Esters, Evelin Fischer (Gräfenhainichen), Paul K. Friedhoff, Jörg W. Ganschow, Konrad Gilges, Dr. Peter Glotz, Achim Großmann, Dr. Karlheinz Guttmacher, Hans-Joachim Hacker, Manfred Hampel, Dr. Sigrid Hoth, Jürgen Koppelin, Eva-Maria Kors, Arnulf Kriedner, Reiner Krziskewitz, Brigitte Lange, Karl-Josef Laumann, Uwe Lühr, Theo Magin, Dorle Marx, Rudolf Meinl, Maria Michalk, Engelbert Nelle, Horst Niggemeier, Günther Friedrich Nolting, Günter Oesinghaus, Dr. Rainer Ortleb, Detlef Parr, Horst Peter (Kassel), Lisa Peters, Erika Reinhardt, Margot von Renesse, Otto Reschke, Günter Rixe, Dr. Christa Schmidt, Dr. Jürgen Schmude, Brigitte Schulte (Hameln), Dr. R. Werner Schuster, Hans Schuster, Wieland Sorge, Dorothea Szwed, Margitta Terborg, Reinhard Weis (Stendal), Dr. Christoph Zöpel, Burkhard Zurheide zur zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Abgeordneten Dr. Konrad Elmer, Susanne Rahhardt-Vahldieck, Dr. Christoph Schnittler und weiterer Abgeordneter — Drucksache 12/6708 — Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 2 a) Der Bundestag wolle beschließen: 1. Der Titel wird wie folgt gefaßt: „Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Präambel des Grundgesetzes". 2. Artikel 1 wird wie folgt gefaßt: ,Artikel 1 Änderung des Grundgesetzes Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. III, Gliederungsnummer 100-1, zuletzt geändert durch ...), wird wie folgt geändert: Drucksache 12/8171 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode In der Präambel wird nach dem Wort „Menschen" folgender neuer Nebensatz eingefügt: „ ,auf Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn aller vertrauend,".' Bonn, den 29. -

MEDIZIN UND IDEOLOGIE Informationsblatt Der Europäischen Ärzteaktion
12. Jahrgang Auflage 7 000 Stück November 1990 MEDIZIN UND IDEOLOGIE Informationsblatt der Europäischen Ärzteaktion Dresden - 20. bis 23.9.1990 Inhaltsverzeichnis Vorträge vom Kongreß in Dresden 2 Empfängnisregelung in christlicher Verantwortung Dr. Werner Neuer 20 Editorial Dr. Alfred Häußler 3 Bundesverfassungsgericht Kongreß-Bericht Dr. Alfred Häußler 6 in der Verantwortung Alexander Papsthart 22 Dokumentation Predigt zum Kongreß Bischof Dr. Reinelt 12 Urteil - Bayerisches Oberstes Landesgericht 23 Kongreß-Resolution 13 Aufklärung Eine Mädchenklasse 32 Predigt aus Münster Pfr. Karl Schlosser 15 Kommentare 35 Zum Geburtstag von Professor Rötzer Dr. Alfred Häußler 18 Medien 54 MEDIZIN & IDEOLOGIE NOVEMBER 90 Editorial Die Reevangelisierung und Rechristianisierung Deutschlands und Europas als Erbe, Auftrag und Aufgabe In meinem alten und traditionsreichen humanistischen Wende, was hat zu diesem historisch mit nichts Ver- Gymnasium war es eine weit zurückreichende Über- gangenem zu vergleichenden Prozeß der Perestrojka, lieferung, daß die Abiturientenklassen ihren Jahres- der Umgestaltung geführt? Erinnern wir uns daran: ausflug nach Thüringen machten. Nicht weil Thürin- Vor 150 Jahren gab Wilhelm Liebknecht, der Vater von gen als das „Grüne Herz Deutschlands" galt, sondern Karl Liebknecht, ein enger Vertrauter von Karl Marx, weil man es als den geistig-kulturellen Mittelpunkt mit dem er jahrelang in London zusammenlebte, die Deutschlands betrachtete. Man besuchte Weimar, die Parole aus: „Das Christentum ist das Gespenst der Wartburg, Jena und Gotha und, wenn die finanziellen Vergangenheit, der Sozialismus die Forderung der Mittel in der damals geldknappen und viel ärmeren Gegenwart" (1). Es ist noch nicht lange her, da war auf Zeit ausreichten, auch Leipzig und Dresden. Keine an- dem Höhepunkt der Studentenrevolten an den euro- dere Region in Deutschland besaß diese geschichtli- päischen Universitäten, vornehmlich von der Masse che und kulturelle Ausstrahlung wie eben der thürin- der Soziologiestudenten, ähnliches zu hören. -

Vernichten Oder Offenlegen? Zur Entstehung Des Stasi-Unterlagen-Gesetzes
Silke Schumann Vernichten oder Offenlegen? Zur Entstehung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes Eine Dokumentation der öffentlichen Debatte 1990/1991 Reihe A: Dokumente Nr. 1/1995 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik Abteilung Bildung und Forschung 10106 Berlin E-Mail: [email protected] Die Meinungen, die in dieser Schriftenreihe geäußert werden, geben ausschließlich die Auffassungen der Autoren wieder. Abdruck und publizistische Nutzung sind nur mit Angabe des Verfassers und der Quelle sowie unter Beachtung des Urheberrechtsgesetzes gestattet. Schutzgebühr: 5,00 € Nachdruck der um ein Vorwort erweiterten 2. Auflage von 1997 Berlin 2020 ISBN 978-3-942130-39-4 Eine PDF-Version dieser Publikation ist unter der folgenden URN kostenlos abrufbar: urn:nbn:de:0292-97839421303940 Vorwort zur Neuauflage Im Vergleich mit den politischen Umbrüchen in den anderen postkommunistischen Ländern war die Friedliche Revolution 1989/90 in der DDR außerordentlich stark von der Auflösung der Stasi und der Auseinandersetzung um die Vernichtung ihrer Akten geprägt. Die Besetzung der regionalen Dienststellen im Dezember 1989 und der Zentrale des MfS (Ministerium für Staats- sicherheit) am 15. Januar 1990 bildeten Höhepunkte des revolutionären Geschehens. Die Fokus- sierung der Bürgerbewegung auf die Entmachtung des geheimpolizeilichen Apparats und die Sicherung seiner Hinterlassenschaft ist unübersehbar. Diese Fokussierung findet gleichsam ihre Fortsetzung in der Aufarbeitung der diktatorischen Vergangenheit der DDR in den darauffol- genden Jahren, in denen wiederum das Stasi-Thema und die Nutzung der MfS-Unterlagen im Vordergrund standen. Das könnte im Rückblick als zwangsläufige Entwicklung erscheinen, doch bei näherer Betrach- tung wird deutlich, dass das nicht der Fall war. Die Diskussionen des Jahres 1990 zeigen, dass die Nutzung von Stasi-Unterlagen für die Aufarbeitung der Vergangenheit selbst in Kreisen der Bürgerbewegung keineswegs unumstritten war. -
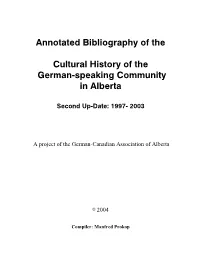
Annotated Bibliography of The
Annotated Bibliography of the Cultural History of the German-speaking Community in Alberta Second Up-Date: 1997- 2003 A project of the German-Canadian Association of Alberta 8 2004 Compiler: Manfred Prokop Annotated Bibliography of the Cultural History of the German-speaking Community in Alberta: 1882-2000. Second Up-Date: 1997-2003 In collaboration with the German-Canadian Association of Alberta #203, 8708-48 Avenue, Edmonton, AB, Canada T6E 5L1 Compiler: Manfred Prokop Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2E6 Phone/Fax: (780) 467-6273. E-Mail: [email protected] ISBN 0-9687876-0-6 8 Manfred Prokop 2004 TABLE OF CONTENTS Overview ............................................................................................................................................................................................... 1 Quickstart ............................................................................................................................................................................... 1 Description of the Database ................................................................................................................................................................. 2 Brief history of the project ................................................................................................................................................... 2 Materials ............................................................................................................................................................................... -

Neujahrsgruß 1
Neujahrsgruß 1 Martin Rötz Dr. Ulrich Seidel Präsident des Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Unternehmerverbandes Rostock und Umgebung e.V. Rostock und Umgebung e.V. Liebe Leser, DIE THEMEN mit Tempo verändern sich auch in unserem Land Wissenschaft, Technik, Wirt- schaft und Wertvorstellungen. Unser Land hat alle Voraussetzungen, mehr Vertrauen in sich selbst zu finden. Die Menschen müssen fest auf Verlässlich- keit bauen können. Netzwerk der guten Taten Das bedeutet zugleich, dass sich ein jeder selbst zum Handeln für die Zukunft Steuerrad e.V. setzt auf Zukunft entscheidet. Es geht darum, tragfähige Lösungen für die Probleme unserer Seite 3 Zeit beizutragen. Unser Verband hat sich dafür im zurückliegenden Jahr stark eingebracht. Dafür danken wir im Namen unseres Vorstandes allen, auf die wir uns in den vergangenen Monaten stützen konnten. Die Beratungs- Rechenschaft und weiterer Kurs angebote, so im Rechtsbereich, bei Finanzierungen und betriebswirtschaft- Fazit der offenen und ordentlichen lichen Fragen einschließlich Sanierungsmanagement wurden nicht nur von Mitgliederversammlung Verbandsmitgliedern stark in Anspruch genommen. Im Fokus standen unter Seite 8 anderem der Ausbau der Kooperationsbeziehungen, Projektarbeiten, die Entwicklung tragfähiger Netzwerke und die Hilfe bei überregionalen Wirt- schaftsaktivitäten. Erfolgsstory in Rostock Im engen Dialog mit der Politik werden wir 2007 weiterhin einen wichtigen Betonteilewerk Rostock GmbH auf dem Beitrag für eine mittelstandfreundliche Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik skandinvischen Markt leisten. Hierfür haben wir unsere klare Positionierung an Bundesminister Seite 12 Wolfgang Tiefensee übergeben. Forschung, Bildung und Innovationen sind unsere besten Trümpfe im inter- nationalen Wettbewerb und darum mit die wichtigsten Aufgaben der näch- Eurawasser investiert in den sten Jahre. Unser Bildungssystem muss besser werden - daran führt kein Weg Umweltschutz vorbei.