Mittelalter I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Orlando Furioso Narrado En Prosa Del Poema De Ludovico Ariosto
Orlando furioso narrado en prosa del poema de Ludovico Ariosto Italo Calvino Traducción del italiano de Aurora Bernárdez y Mario Muchnik Versos de Ariosto traducidos por el capitán general don Juan de la Pezuela, conde de Cheste, de la Real Academia Española Biblioteca Calvino Los versos de Ariosto citados en esta edición castellana provienen de la traducción, publicada en 1883, de Juan de la Pezuela, una elec- ción aprobada por Italo Calvino. En cuanto a esta edición en sí, se trata de la única versión calificada por el autor como «perfecta», por contener capítulos ausentes de la primera edición italiana de Einaudi, por citar exactamente los versos de Ariosto seleccionados por Calvino y por ser, siempre según el parecer del autor, traducción fiel, supervi- sada paso a paso por él mismo, del texto original. (N. del E.) Presentación 1. Rotholandus, Roland, Orlando En todo atlas histórico de la Edad Media hay un pequeño mapa en el que, generalmente coloreadas de violeta, se indi- can las conquistas de Carlomagno, rey de los francos y luego emperador. Una gran nube violeta se extiende sobre Europa, se expande más allá del Elba y el Danubio, pero se detiene a occidente en el confín de una España todavía sarracena. Solo el borde inferior de la nube salva los Pirineos y llega a cubrir Cataluña; es la Marca Hispánica, todo lo que Carlomagno logró arrancar, en los últimos años de su vida, al Emir de Córdoba. Entre las tantas guerras que Carlomagno libró y ganó contra bávaros, frisones, eslavos, ávaros, bretones, longobardos, las que libró contra los árabes, en la historia del emperador de los francos, ocupan relativamente poco lugar; en la literatura, en cambio, se agigantaron hasta alcanzar todo el orbe terráqueo, y llenaron las páginas de bibliotecas enteras. -

Tradition Et Renouvellement Dans La Chanson De Geste Tardive: Doon De Mayence Et Gaufrey
Tradition et renouvellement dans la chanson de geste tardive: Doon de Mayence et Gaufrey by MARINA LUSHCHENKO B.A., Simon Fraser University, 2004 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (French) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA April 2006 © Marina Lushchenko, 2006 11 ABSTRACT Written towards the close of the Middle Ages (late 13th - early 14th centuries) and rather neglected until now, the epic songs of Doon de Mayence and Gaufrey deserve nonetheless a study, because, in addition to their considerable literary value, they make it possible for us to understand the evolution of French medieval epic poetry. The object of the research is to evaluate the importance of tradition in these comparatively late works and, at the same time, to examine the innovations, laying particular emphasis on the authors' originality. To study intertextual references to other epic songs and Arthurian romances, to analyze versification and composition of the given songs, to take a look at epic rhetoric and the system of characters, - such are the stages of the present study. First conclusion : Doon de Mayence and Gaufrey are both at the junction of epic and romance traditions. Second conclusion : the epic songs in question borrow differently from these two genres. Third conclusion : realistic features add to the narration, making it, consequently, less archaistic. iii TABLE DES MATIERES Abstract • ii Table des matieres iii Remerciements -v CHAPITRE I Introduction ..: 1 CHAPITREII Genese de Doon de Mayence et de Gaufrey 5 2.1 Chansons de geste: formation de cycles 5 2.2 Emprunt d'episodes aux chansons de geste 14 2.3 Sources arthuriennes .". -
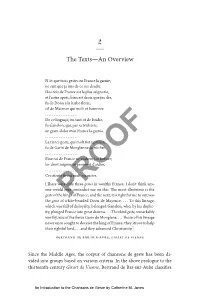
Jonesexcerpt.Pdf
2 The Texts—An Overview N’ot que trois gestes en France la garnie; ne cuit que ja nus de ce me desdie. Des rois de France est la plus seignorie, et l’autre aprés, bien est droiz que jeu die, fu de Doon a la barbe florie, cil de Maience qui molt ot baronnie. De ce lingnaje, ou tant ot de boidie, fu Ganelon, qui, par sa tricherie, en grant dolor mist France la garnie. La tierce geste, qui molt fist a prisier, fu de Garin de Monglenne au vis fier. Einz roi de France ne vodrent jor boisier; lor droit seignor se penerent d’aidier, . Crestïenté firent molt essaucier. [There were only threegestes in wealthy France; I don’t think any- one would ever contradict me on this. The most illustrious is the geste of the kings of France; and the next, it is right for me to say, was the geste of white-beardedPROOF Doon de Mayence. To this lineage, which was full of disloyalty, belonged Ganelon, who, by his duplic- ity, plunged France into great distress. The thirdgeste , remarkably worthy, was of the fierce Garin de Monglane. Those of his lineage never once sought to deceive the king of France; they strove to help their rightful lord, . and they advanced Christianity.] Bertrand de Bar-sur-Aube, Girart de Vienne Since the Middle Ages, the corpus of chansons de geste has been di- vided into groups based on various criteria. In the above prologue to the thirteenth-century Girart de Vienne, Bertrand de Bar-sur-Aube classifies An Introduction to the Chansons de Geste by Catherine M. -

DE HITON DE BORDEAUX a Thesis Presented to the French
ANALYSE ET ETUDE LITTERAIRES DE HITON DE BORDEAUX A Thesis Presented to the French Department of Mc Gill U:hive:rsi ty In Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of H.a.ster of Arts by J ean-M8.rcel Paquette August 1964 lNTRODUCTIOff •••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••~~ P~ 1 PREMIERE PARTIE: MATIERE CHAPITRE PREMIER: De l'histoire A la légende •••••••••••••••••• CF..APITRE DEUXIEMEt Autour de Charlemagne ...... ~~~ .......... ~~. p~ tb DEUXIEME PART!Et CON JOINTURE CHAPITRE TROISIENE: Les éléments romanesques ••••••••••••• ••... P• a.~ CHAPITRE QUATR~Œ: Les éléments féeriques ••••••••••••••••••~• p~~ TROISmŒ PARTIE: SENEFIANCE" CHAPITRE Cn:IQ~Œ: L'aventure et ses symlx>les •••••••••••• ••.. P• 5 s- CHAPITRE SIXIEME: Colœlusion: La conta:mihation des genres • • • • • p~ ~ 1- NOTES" ••••••••••••••••••••••••• ·-· •••••••••••••••• ·-······........ p. q 1- BIBLIOGRAPHIE •·• •. • • .... •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •. •. • •. •. • • • •• • • • • P•' \ 0 ' INTRODUCTION n semblera- d 1abord paradoxal que les trois mots de MATIERE, de CONJOTh"TURE et de SIDTEFIANCE, appartenant au vocabulaire du roman cour tois, servent, chacun, de titre aux trois parties de cette étude eon sacrée à une chanson de geste du cycle carolingien~ Cela est d'O., en partie, A ce que, Huon de Bordeaux constituant une oeuvre complexe, l'objet de la présente th~se sera d'établir jus- qu•·~. quel point l'oeuvre, d'apparence épique, a subi la contaminatfon du genre romanesque. Les médiévistes désignent par le mot de MATIERE, 11 ensemble des sources, historiques ou littéraires, dont ont pu s'inspirer les po~tes et les romanciers du Moyen Age. Ainsi parle-t-on de "mati~re bretonne" pour les romans arthuriens, et de "mati~re antiquen pour les romans, tel que le Roman d'Alexandre, inspirés des oeuvres et des th~es de r•·antiqufté. -

Cahiers De Recherches Médiévales Et Humanistes, 12 | 2005 the Epic Tradition of Charlemagne in Italy 2
Cahiers de recherches médiévales et humanistes Journal of medieval and humanistic studies 12 | 2005 La tradition épique, du Moyen Âge au XIXe siècle The epic tradition of Charlemagne in Italy Jane E. Everson Electronic version URL: http://journals.openedition.org/crm/2192 DOI: 10.4000/crm.2192 ISSN: 2273-0893 Publisher Classiques Garnier Printed version Date of publication: 30 December 2005 Number of pages: 45-81 ISSN: 2115-6360 Electronic reference Jane E. Everson, « The epic tradition of Charlemagne in Italy », Cahiers de recherches médiévales [Online], 12 | 2005, Online since 30 December 2008, connection on 13 October 2020. URL : http:// journals.openedition.org/crm/2192 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crm.2192 This text was automatically generated on 13 October 2020. © Cahiers de recherches médiévales et humanistes The epic tradition of Charlemagne in Italy 1 The epic tradition of Charlemagne in Italy Jane E. Everson Introduction 1 From the late thirteenth century to the end of the Renaissance, Carolingian narratives centred on the deeds of Charlemagne, Roland and the peers of France enjoyed immense popularity in Italy at all levels of society. Some of the greatest writers of this period were attracted to the genre and produced in it their masterpieces. And if, for the early period, the most important compositions are often anonymous, for the fifteenth and sixteenth centuries the names of Andrea da Barberino, Pulci, Boiardo, Ariosto and Tasso, to name only the best known and most influential, serve to underline the status of Carolingian narrative literature as the pre-eminent literary genre in the vernacular. As I have pointed out elsewhere, the sheer length of time during which the Carolingian narrative tradition flourished in Italy, the large number of writers involved with the genre, the wealth of material both in content and style, the range of developments and modifications, all pose major problems for the scholar aiming to produce a comprehensive historical and thematic survey of the genre.1 2 The magnitude of the task had already taxed E. -

Saracen Alterity and Cultural Hybridity in Middle English Romance
UNIVERSITY OF CALGARY Troubled Identities: Saracen Alterity and Cultural Hybridity in Middle English Romance By Jenna Louise Stook A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF ENGLISH CALGARY, ALBERTA OCTOBER, 2010 © Jenna Louise Stook 2010 Library and Archives Bibliotheque et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-69465-7 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-69465-7 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

1. El Estudio De Las Palabras De Origen Oriental, Sus Variantes Y La Distribución De Sus Formas Es Una Parte, Pequeña Si Se Qu
NOTAS DE HISTORIA LEXICA PARA LAS LITERATURAS ROMANICAS MEDIEVALES FRANCISCO MARCOS MARIN* 1. El estudio de las palabras de origen oriental, sus variantes y la distribución de sus formas es una parte, pequeña si se quiere, del es tudio de los contactos entre diversas comunidades humanas, entre dis tintas civilizaciones. Cada palabra tiene sus propios problemas: simpli cidad formal, complejidad semántica, o viceversa; contenido cultural más o menos interesante; variedad rica, en suma, que siempre agrada al investigador y puede atraer al lector curioso; pero, además, hay palabras que han formado familias complejísimas y que han servido para el trans porte de motivos a múltiples literaturas. En este último caso el panora ma se amplía de tal modo que el estudio lexicográfico, por complejo que sea, no es más que la puerta que da acceso a las investigaciones poste riores. En este estudio nos ocuparemos de una palabra de origen sánscri to, que designa a los miembros de la primera de las cuatro castas superio res hindúes: los sacerdotes o brahmanes. Este grupo social, conocido en Occidente desde tiempos muy remotos, se designa con formas lingüís• ticas diversas, pero que, por lo general, conservan íntegro, o muy poco evolucionado, el consonantismo de origen, BRHMN. En cuanto al voca lismo -en particular la vocal que, en la mayoría de los casos, es la ~segunda, tónica, como en el castellano brahmán, o átona, como en el inglés brahmín- se da una alternancia entre la -a- y la -i- que queda re flejada en los dos ejemplos inmediatamente precedentes. 2.1. En general, podemos decir que se conservan siempre las con sonantes BRM, y que, de las vocales, hay una a antes de la M, a que es frecuentemente átona; pero no necesariamente. -

L'héroisme Chevaleresque Dans Le "Roland Amoureux" De
L'héroïsme chevaleresque dans le Roland Amoureux de Boiardo Couverture : Illustration extraite de la Nouvelle traduction de Roland l'Amou- reux par LESAGE, Paris, 1717 (cliché Bibliothèque Municipale de Lyon) INSTITUT D'ÉTUDES DE LA RENAISSANCE ET DE L'AGE CLASSIQUE Denise ALEXANDRE-GRAS L'héroïsme chevaleresque dans le - Roland Amoureux de Boiardo Publications de l'Université de Saint-Etienne 0 Institut d'études de la Renaissance et de l'Age Classique, 1988 34, rue Francis-Baulier — 42100 Saint-Etienne ISBN 2-86724-032-8 INTRODUCTION Matteo Maria Boiardo est un écrivain dont l'œuvre et la personnalité, complexes et contradictoires, demeurent parmi les plus déroutantes qui soient. Il n'est en effet pas possible de réduire toute son activité à la seule composition du «poème» 1, d'ignorer notamment ses œuvres latines et d'imaginer qu'il ait oublié sa culture humaniste durant les quinze dernières années de sa vie. Or, le contraste est évident entre ses œuvres mineures de goût humaniste (les œuvres latines, les Eglogues en italien , le Timon inspiré de Lucien) et son poème cheva- leresque modelé sur des œuvres populaires que les humanistes méprisaient volontiers. Son Canzoniere, dont le titre classicisant, Amorum libri, est signifi- catif, combine certes diverses sources, mais il apparaît précisément comme une tentative de synthèse raffinée dans laquelle la poésie latine et les thèmes néo- platoniciens viennent enrichir le legs de la poésie lyrique médiévale et du pé- trarquisme, ce qui semble fort éloigné de l'esprit général du poème, si éloigné même que Pier Vincenzo Mengaldo a pu parler d'un tel hiatus entre les deux œuvres, qu'on n'en saurait trouver d'équivalent dans l'histoire italienne toute entière 2. -

De La Chanson De Geste Au Roman Chevaleresque. Trois Mises En Prose Du Xve Siècle (Roman De Guillaume D'orange, Huon De
Dorota PUDO DE LA CHANSON DE GESTE AU ROMAN CHEVALERESQUE Trois mises en prose du XVe siècle (Roman de Guillaume d'Orange, Huon de Bordeaux et Histoire de la Reine Berthe et du Roy Pepin) [OD EPOSU DO POWIEŚCI RYCERSKIEJ. Trzy XV-wieczne adaptacje prozą starofrancuskich pieśni o czynach (Powieść o Wilhelmie z Orange, Huon z Bordeaux i Historia Królowej Berty i Króla Pepina)] Thèse de doctorat sous la direction de Mme le Professeur Anna DRZEWICKA Kraków 2010 1 mojemu Mężowi 2 TABLE DES MATIERES Avant-propos...........................................................................................................................5 1. Introduction.........................................................................................................................6 1.1. Objectifs et méthodes du travail.....................................................................................6 1.1.1. Sujet de la présente étude...............................................................................................6 1.1.2. Corpus de textes..............................................................................................................7 1.1.3. Objectifs, méthodes et plan du travail..........................................................................10 1.2. Les mises en prose et leurs sources ….........................................................................13 1.2.1. Définition et description du phénomène.......................................................................13 1.2.2. Etat de la question.........................................................................................................17 -

Violence and Christian Piety in the Romances of the London Thornton Manuscript
HOLY BLOODSHED: VIOLENCE AND CHRISTIAN PIETY IN THE ROMANCES OF THE LONDON THORNTON MANUSCRIPT DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in Medieval English Literature in the Graduate School of the Ohio State University By Emily Lavin Leverett, M.A. ***** The Ohio State University 2006 Dissertation Committee: Approved by Professor Ethan Knapp, Adviser Professor Richard Firth Green __________________________ Adviser Professor Lisa Kiser English Graduate Program Copyright by Emily Lavin Leverett 2006 ABSTRACT Graphic violence dominates the three romances in the opening section of the London Thornton Manuscript: The Siege of Jerusalem, The Siege of Milan and Duke Roland and Sir Otuel of Spain. In this dissertation I argue that these romances individually use graphic violence as a means of coping with late medieval English anxieties about Christian failures abroad and rising English heresy at home; together, along with the devotional texts surrounding them, they become examples of violent devotional expression. Whether studied alone or as a group, in these romances violence in the name of Christian devotion is imagined as both necessary and praiseworthy. Each romance fundamentally employs violence to reveal Christian and, at times, specifically English Christian dominance over a threatening group or ideology. At the same time, by repeatedly using violence as a marker of devotion, but portraying it as at the service of Church orthodoxy, these romances create boundaries, containing and directing the violence towards real political and ideological goals: the perpetuation of the orthodox Church in England. Finally, I argue that the graphic violence that so marks the three romances found in the opening section of the London Thornton manuscript is normalized and contained by the orthodox religious boundaries provided by the ii devotional texts surrounding them. -

Copeland2016.Pdf (1.069Mb)
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Declaration: This is to certify that that the work contained within has been composed by me and is entirely my own work. No part of this thesis has been submitted for any other degree or professional qualification. Date: 19/05/2016 Signature: ______________________________ From Fierabras to Stair Fortibrais: A Comparative Analysis of the Chanson de Geste and its Adaptations in Ireland E. Copeland Doctorate of Philosophy The University of Edinburgh 2016 Abstract Despite its apparent popularity in fifteenth-century Ireland—as attested by its presence in eight manuscripts—Stair Fortibrais, the Irish adaptation of the twelfth-century chanson de geste Fierabras has received very little scholarly attention. This fact proves especially unfortunate since the text possesses particular relevance for two important trends in recent scholarship, one concerning Celtic Studies and the other more broadly Continental in scope. -

L'unité Contestée De La Chanson Des Saisnes
L’unité contestée de la Chanson des Saisnes Povl Skårup Århus Universitet Dans son Etude linguistique et littéraire de la Chanson des Saisnes de Jehan Bodel,1 Annette Brasseur a le mérite d’avoir montré que la fin des mss. LT, à partir de l’endroit où leur texte se sépare de celui du ms. A, n’a pas été composée par le même auteur que le ms. A. Ce résultat n’est plus en question. Il a d’ailleurs été renforcé par l’étude de Mme. Thiry-Stassin, citée ci-dessous. Dans son ouvrage, Mme. Brasseur a également soutenu une hypothèse sur le texte du seul ms. A. Cette hypothèse consiste en trois éléments: 1. Telle qu’elle se trouve dans le ms. A, la chanson se divise en deux parties. 2. Les deux parties ont deux auteurs différents. 3. La coupure se place à la fin du vers 3307 (le texte entier comprend 4337 vers). Cette hypothèse est basée sur (a) une comparaison du ms. A avec les mss LT, (b) des différences linguistiques entre les deux parties, et (c) des différences littéraires entre les deux parties. Dans un article, “Jehan Bodel et les autres auteurs de la Chanson des Saisnes,”2 j’ai montré que le troisième élément de cette hypothèse est mal fondé. Il n’a aucune base dans le ms. A. Il est basé sur un fait et une hypothèse destinée à expliquer ce fait. Le fait est que les mss LT ont le même texte que le ms. A jusqu’au vers 3307 de celui-ci, mais un texte différent à partir de cet endroit.