Bundesrepublik Deutschland MICHAEL GARTHE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
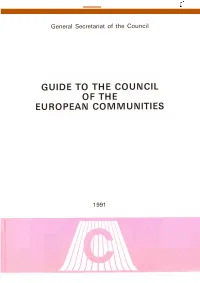
Guide to the Council of the European Communities
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you byCORE provided by Archive of European Integration General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 1991 W/lliMW ι \ \\\ General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 1991 Cataloguing data can be found at the end of this publication Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1991 ISBN 92-824-0796-9 Catalogue number: BX-60-90-022-EN-C © ECSC-EEC-EAEC, Brussels · Luxembourg, 1991 Printed in Belgium CONTENTS Page Council of the European Communities 5 Presidency of the Council 7 Conference of the Representatives of the Governments of the Member States 8 List of Representatives of the Governments of the Member States who regularly take part in Council meetings 9 Belgium 10 Denmark 11 Federal Republic of Germany 12 Greece 15 Spain 17 France 19 Ireland 21 Italy 23 Luxembourg 29 Netherlands 30 Portugal 32 United Kingdom 35 Permanent Representatives Committee 39 Coreper II 40 Coreper I 42 Article 113 Committee 44 Special Committee on Agriculture 44 Standing Committee on Employment 44 Budget Committee 44 Scientific and Technical Research Committee (Crest) 45 Education Committee 45 Committee on Cultural Affairs 46 Select Committee on Cooperation Agreements between the Member States and third countries 46 Energy Committee 46 Standing Committee on Uranium Enrichment (Copenur) 47 Working parties 47 Permanent Representations 49 Belgium 50 Denmark 54 Federal Republic of -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 15/34 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 34. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. März 2003 Inhalt: Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 2701 A Dr. Angela Merkel CDU/CSU . 2740 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen . 2701 D Gerhard Rübenkönig SPD . 2741 B Steffen Kampeter CDU/CSU . 2743 D Tagesordnungspunkt I: Petra Pau fraktionslos . 2746 D Zweite Beratung des von der Bundesregie- Dr. Christina Weiss, Staatsministerin BK . 2748 A rung eingebrachten Entwurfs eines Geset- Dr. Norbert Lammert CDU/CSU . 2749 C zes über die Feststellung des Bundeshaus- haltsplans für das Haushaltsjahr 2003 Günter Nooke CDU/CSU . 2750 A (Haushaltsgesetz 2003) Petra-Evelyne Merkel SPD . 2751 D (Drucksachen 15/150, 15/402) . 2702 B Jens Spahn CDU/CSU . 2753 D 13. Einzelplan 04 Namentliche Abstimmung . 2756 A Bundeskanzler und Bundeskanzleramt Ergebnis . 2756 A (Drucksachen 15/554, 15/572) . 2702 B Michael Glos CDU/CSU . 2702 C 19. a) Einzelplan 15 Franz Müntefering SPD . 2708 A Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung Wolfgang Bosbach CDU/CSU . 2713 A (Drucksachen 15/563, 15/572) . 2758 B Franz Müntefering SPD . 2713 D Dr. Guido Westerwelle FDP . 2714 C b) Erste Beratung des von den Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/ Otto Schily SPD . 2718 B DIE GRÜNEN eingebrachten Ent- Hans-Christian Ströbele BÜNDNIS 90/ wurfs eines Gesetzes zur Änderung der DIE GRÜNEN . 2719 A Vorschriften zum diagnoseorientierten Fallpauschalensystem für Kranken- Dr. Guido Westerwelle FDP . 2719 C häuser – Fallpauschalenänderungs- Krista Sager BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2720 C gesetz (FPÄndG) (Drucksache 15/614) . 2758 B Dr. Wolfgang Schäuble CDU/CSU . 2724 D Dr. Michael Luther CDU/CSU . 2758 D Gerhard Schröder, Bundeskanzler . -

Gesetzentwurf Der Abgeordneten Dr
Deutscher Bundestag Drucksache 12/2112 12. Wahlperiode 18. 02. 92 Sachgebiet 100 Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Wolfgang Schäuble, Dr. Wolfgang Bötsch, Johannes Gerster (Mainz), O tto Hauser (Esslingen), Dr. Rolf Olderog, Wilhelm Rawe, Dr. Else Ackermann, Ulrich Adam, Dr. Walter Franz Altherr, Anneliese Augustin, Jürgen Augustinowitz, Dietrich Austermann, Heinz-Günter Bargfrede, Dr. Wolf Bauer, Brigi tte Baumeister, Richard Bayha, Meinrad Belle, Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Hans-Dirk Bierling, Dr. Joseph-Theodor Blank, Renate Blank, Dr. Heribert Blens, Peter Bleser, Dr. Norbert Blüm, Wilfried Böhm (Melsungen), Dr. Maria Böhmer, Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Friedrich Bohl, Wilfried Bohlsen, Jochen Borchert, Klaus Brähmig, Paul Breuer, Monika Brudlewsky, Georg Brunnhuber, Klaus Bühler (Bruchsal), Ha rtmut Büttner (Schönebeck), Dankward Buwitt, Manfred Cartens (Emstek), Peter Harry Carstensen (Nordstrand), Joachim Clemens, Wolfgang Dehnel, Gertrud Dempwolf, Karl Deres, Albe rt Deß, Renate Diemers, Werner Dörflinger, Hubert Doppmeier, Hansjürgen Doss, Dr. Alfred Dregger, Jürgen Echternach, Wolfgang Ehlers, Udo Ehrbar, Maria Eichhorn, Wolfgang Engelmann, Rainer Eppelmann, Horst Eylmann, Anke Eymer, Ilse Falk, Dr. Ku rt Faltlhauser, Jochen Feilcke, Dr. Karl H. Fell, Dirk Fischer (Hamburg), Leni Fischer (Unna), Winfried Fockenberg, Klaus Francke (Hamburg), Herbert Frankenhauser, Dr. Gerhard Friedrich, Erich G. Fritz, Hans-Joachim Fuchtel, Johannes Ganz (St. Wendel), Michaela Geiger, Norbert Geis, Dr. Heiner Geißler, Dr. Wolfgang von Geldern, Horst Gibtner, Michael Glos, Dr. Reinhard Göhner, Ma rtin Göttsching, Peter Götz, Dr. Wolfgang Götzer, Joachim Gres, Elisabeth Grochtmann, Wolfgang Gröbl, Claus-Peter Grotz, Dr. Joachim Grünewald, Horst Günther (Duisburg), Carl-Detlev Freiherr von Hammerstein, Klaus Harries, Gottfried Haschke (Großhennersdorf), Udo Haschke (Jena), Gerda Hasselfeldt, Rainer Haungs, Hansgeorg Hauser (Rednitzhembach), Klaus-Jürgen Hedrich, Manfred Heise, Dr. -

Guide to the Council of the European Communities : December 1989
General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES December 1989 General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, December 1989 This publication is also available in the following languages: ES ISBN 92-824-0702-0 DA ISBN 92-824-0703-9 DE ISBN 92-824-0704-7 GR ISBN 92-824-0705-5 FR ISBN 92-824-0707-1 IT ISBN 92-824-0708-X NL ISBN 92-824-0709-8 PT ISBN 92-824-0710-1 Cataloguing data can be found at the end of this publication Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1990 ISBN 92-824-0706-3 Catalogue number: BX-57-89-176-EN-C © ECSC-EEC-EAEC, Brussels · Luxembourg, 1990 Printed in Belgium CONTENTS Page Council of the European Communities 5 Presidency of the Council 7 Conference of the Representatives of the Governments of the Member States 8 List of representatives of the governments of the Member States who regularly take part in Council meetings 9 Belgium 10 Denmark 11 Federal Republic of Germany 12 Greece 15 Spain 17 France 19 Ireland 21 Italy 23 Luxembourg 29 Netherlands 30 Portugal 32 United Kingdom 35 Permanent Representatives Committee 39 Coreper II 40 Coreper I 42 Article 113 Committee 44 Special Committee on Agriculture 44 Standing Committee on Employment 44 Budget Committee 44 Scientific and Technical Research Committee (Crest) 45 Education Committee 45 Committee on Cultural Affairs 46 Select Committee on Cooperation Agreements between the Member States and third countries 46 Energy Committee 46 Standing Committee on Uranium -

The Making of the European Community's Wheat Policy 1973- 8 8 : an International Political Economy Analysis
THE MAKING OF THE EUROPEAN COMMUNITY'S WHEAT POLICY 1973- 8 8 : AN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY ANALYSIS Peter Whitman Bell Phillips A Thesis Submitted to the University of London, London School of Economics and Political Science, in Fulfillment of Requirements for a Ph.D. in International Relations October 1989 1 UMI Number: U041243 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U041243 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 THESES, F , OF V ^ POLITICAL * O ANO Mi yc5 \ | o Z THE MAKING OF THE EUROPEAN COMMUNITY*S WHEAT POLICY 1973-88: AN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY ANALYSIS Abstract This thesis examines the political and economic changes in the domestic and international organization and operation of the European Community Common Agricul tural Policy for wheat during 1973-88. Its purpose is to demonstrate the opportunities and constraints in the agricultural talks in the Uruguay Round of the GATT begun in 1986. An international political economy approach is adop ted to bring into prominence the key security, produc tion, finance, and technology power structures and to demonstrate how these transformed the interlocking and overlapping set of bargains that determined policy. -

Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 3. Sitzung
Plenarprotokoll 10/3 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 3. Sitzung Bonn, Mittwoch, den 30. März 1983 Inhalt: Erweiterung der Tagesordnung 29A Beschlußfassung über das Verfahren für die Berechnung der Stellenanteile der Fraktionen 31 C Abweichung von den Richtlinien für die Fragestunde 51 A Beschlußfassung über die Einsetzung von Ausschüssen Bekanntgabe der Bildung der Bundesre- gierung Jahn (Marburg) SPD 32 B Fischer (Frankfurt) GRÜNE 33A Dr. Schäuble CDU/CSU 33 D in Verbindung mit Frau Potthast GRÜNE 35 A Eidesleistung der Bundesminister Präsident Dr. Barzel 29 A Zur Geschäftsordnung Genscher, Bundesminister AA 30 A Porzner SPD 36 A Dr. Zimmermann, Bundesminister BMI 30 B Fischer (Frankfurt) GRÜNE 36 D Engelhard, Bundesminister BMJ . 30 B Wolfgramm (Göttingen) FDP 37 A Dr. Stoltenberg, Bundesminister BMF . 30 B Seiters CDU/CSU 37 B Dr. Graf Lambsdorff, Bundesminister BMWi 30 B Kiechle, Bundesminister BML 30 C Aktuelle Stunde betr. „Volkszählung" Windelen, Bundesminister BMB . 30 C Hecker GRÜNE 37 D Dr. Blüm, Bundesminister BMA . 30 C Broll CDU/CSU 38 C Dr. Wörner, Bundesminister BMVg . 30 D Schäfer (Offenburg) SPD 39 D Dr. Geißler, Bundesminister BMJFG . 30 D Dr. Hirsch FDP 40 C Dr. Dollinger, Bundesminister BMV . 31 A Dr. Zimmermann, Bundesminister BMI 41C Dr. Schwarz-Schilling, Bundesminister Dr. Wernitz SPD 42 C BMP 31 A Dr. Laufs CDU/CSU 43 C Dr. Schneider, Bundesminister BMBau 31 A Dr. Graf Lambsdorff, Bundesminister Dr. Riesenhuber, Bundesminister BMFT 31 B BMWi 44 C Frau Dr. Wilms, Bundesminister BMBW . 31 B Schneider (Berlin) GRÜNE 45 B Dr. Warnke, Bundesminister BMZ . 31 B Niegel CDU/CSU 46 B II Deutscher Bundestag — 10. -

006 Ring Christlich-Demokratischer Studenten (Rcds)
ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 04 – 006 RING CHRISTLICH-DEMOKRATISCHER STUDENTEN (RCDS) SANKT AUGUSTIN 2016 I Inhaltsverzeichnis 1 Zur Geschichte und zum Programm des RCDS 1 1.1 Zum Selbstverständnis des RCDS 1 1.2 Jubiläumsveranstaltungen 1 2 Organe 2 2.1 Bundesdelegiertenversammlungen 2 2.2 Bundesvorstand 14 2.2.1 Bundesvorstandssitzungen 14 2.2.2 Korrespondenz 15 2.3 Bundesausschuss 17 2.4 Politischer Beirat 23 2.4.1 Beiratssitzungen 23 2.4.2 Korrespondenz 24 2.5 Bundesvorsitzende 24 2.6 Stellvertretende Bundesvorsitzende 42 3 Statuten 52 4 Bundesgeschäftsstelle 53 4.1 Geschäftsführung 53 4.2 Korrespondenz 63 4.2.1 Allgemeine Korrespondenz 63 4.2.2 Korrespondenz mit Bundes- und Landesministerien 66 4.2.3 Korrespondenz mit Verbänden, Institutionen und Parteien 66 4.2.4 Tageskopien 68 4.3 Rundschreiben 69 4.4 Gespräche 77 5 Programme 78 6 Arbeitskreise, Bundesfachtagungen, Kommissionen, Referate 79 6.1 Arbeitskreise 79 6.2 Bundesfachtagungen 81 6.3 Kommissionen 86 6.4 Referate des Bundesvorstandes 87 7 Landesverbände 94 7.1 Landesverbände allgemein 94 7.2 Einzelne Landesverbände 97 8 Hochschulgruppen 122 8.1 Hochschulgruppen allgemein 122 8.2 Einzelne Hochschulgruppen 129 9 Öffentlichkeitsarbeit 144 9.1 Presse 144 9.1.1 Pressemitteilungen 144 9.1.2 Pressespiegel 144 9.2 Publikationen und Dokumentationen 145 9.3 Zeitschriften und Informationsdienste 145 10 Veranstaltungen 151 10.1 Aktionen 151 II Inhaltsverzeichnis 10.2 Gruppenvorsitzendenkonferenzen, Fachtagungen und Kongresse 156 10.2.1 -

Show Publication Content!
Kalendarium KRONIKA STOSUNKÓW REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC Z EUROPEJSKIMI KRAJAMI SOCJALISTYCZNYMI maj-lipiec 1988 dzić RFN w niewielką ilość potrzeb nych pieniędzy. m aj 4 V — W Bonn doszło do wymiany not między RFN a ZSRR. Minister Hans- I V — Sekretarz generalny Związku -Dietrich Genscher przekaeał ambasado Wypędzonych Hartmut Koschyk zaape rowi Jurijowi Kwicińskiemu notę, w lował do rządu federalnego, by tylko której rząd radziecki został oficjalnie wtedy przyznać Polsce kredyty, gdy „po poinformowany o nowych zachodnionie nad milion Niemców żyjących na obsza mieckich ustaleniach prawnych umożli rze polskiego panowania otrzyma pra wiających radzieckim inspektorom nad wa mniejszości. (...) Można będzie mó zorowanie likwidacji amerykańskich ra wić o dobrych stosunkach z Warszawą kiet na terytorium RFN, z wykorzysta dopiero wówczas, gdy przestanie się niem immunitetu dyplomatycznego. Obie przerzucać odpowiedzialność za kryzys strony podkreśliły przy okazji swą wolę zadłużeniowy, jaki zaistniał w Polsce, „dobrej i pogłębionej współpracy”. na Republikę Federalną. W tym wzglę 4 V — Minister gospodarki Martin Ban- dzie sama Warszawa musi przyznać się gemann (FDP) oznajmił, iż dla RFN do winy”. handel ze Wschodem jest ważny bar 2 V — Według monachijskiego dzienni dziej ze względów politycznych, aniżeli ka „Suddeutsche Zeitung’’ został już ekonomicznych. Mimo że udział tego ustalony termin wizyty kanclerza Kohla handlu w ogólnych obrotach handlo W Moskwie. Wizyta ta nastąpi w końcu wych RFN z zagranicą stale w ostat Października lub na początku listopada nich latach malał, to Bonn jest „w sumie tego roku. Jednocześnie Urząd Kancler zadowolone ze stanu tych stosunków”. ski nie przewiduje już podróży Kohla Bangemann przyznał też, że wobec złej do Warszawy, planowanej początkowo sytuacji gospodarczej Polski, Republika na jesień. -

Der Deutsche Bauernver- Band Und Die Gesellschaft
60 Jahre DBV 60 Jahre DBV 16.05.1974 – Helmut Schmidt (SPD) wird der Antragsbürokratie in ihren Büros sowie der 1982 Bundeskanzler – Josef Ertl (FDP) bleibt abgeschirmten Tierställe. Sie sagen auch, diese Kultur auf dem Lande 30.03.1982 – 10.000 Bauern demonstrieren Landwirtschaftsminister. Der Deutsche Bauernver- „Wiedergeburt“ habe etwas mit einer Bundes- in Brüssel für eine Preisanhebung der 09./10.12.1974 – Der „Europäische Rat“ wird ministerin Künast zu tun gehabt, die das Thema Die Enquetekommission „Kultur in Marktordnungsprodukte. gegründet. äußerst polarisierend und eher gesellschafts- Deutschland“ unter Vorsitz der Bundes- 01.10.1982 – Dr. Helmut Kohl (CDU) wird band und die Gesellschaft politisch, weniger fachlich aus dem Dornrös - tagsabgeordneten Gitta Connemann hat Bundeskanzler – Josef Ertl (FDP) wird er- 1975 chenschlaf geholt hat. Da ist vielleicht etwas in ihrem Bericht auch der Kultur auf dem neut Bundeslandwirtschaftsminister. 28.02.1975 – Lomé-Abkommen zwischen der dran und wären die deutschen Bauern alle Öf- Lande ein Kapitel gewidmet. Darin wird EG und 46 Staaten Afrikas, des karibischen fentlichkeitsarbeiter, könnten sie vielleicht festgehalten, dass es ein breites Spektrum 1983 Raumes und des Pazifischen Ozeans (AKP) auch Gefallen an dieser These finden. Daran kultureller Veranstaltungen und Aktivitä- 06.03.1983 – Bei den Wahlen zum 10. Deut- u. a. mit zoll- und kontingentfreiem Zu- Anton Blöth sieht man aber auch die Gefahren, die damit ten auf dem Lande gibt, überwiegend ge- schen Bundestag gelingt der Partei „Die gang zum europäischen Markt und für 94,2 verbunden sind, wenn man auf Feldern mit ho- tragen vom ehrenamtlichen Engagement. Grünen“ erstmals der Einzug. DBV-Präsi- Prozent der Agrarexporte Jetzt ist wieder Fußball-Europameisterschaft. -

Historisch-Politische Mitteilungen 20
Zwischen Abgrenzung und Annäherung. Das Verhältnis der CDU zu den Grünen 1980–1990* Paul Kraatz/Tim B. Peters Das Thema „Schwarz-Grün“, die Debatte über eine politische Zusammenar- beit zwischen den Parteien CDU und Bündnis 90/Die Grünen (bis hin zu mög- lichen Regierungskoalitionen auf Landes- oder Bundesebene), stellt heute eine Konstante im öffentlichen Diskurs dar.1 Stärker ins Bewusstsein getreten ist diese Option seit Mitte der 1990er Jahre, als schwarz-grüne Bündnisse auf kommunaler Ebene zunahmen2 und in der sogenannten Pizza-Connection3 Po- litiker beider Parteien regelmäßig in Bonn zusammentrafen. Für die 1980er Jahre hingegen, als die Grünen sich bundespolitisch formierten, hat sich eher die Erinnerung an Konfrontationen festgesetzt. „Das Verhältnis von CDU und Grünen war in den achtziger Jahren vor allem auf der Bundes- und Länder- ebene durch eine scharfe gegenseitige Abgrenzung bestimmt.“4 Gegensätze prägten das Bild. „,Schwarz-Weiß‘ dominierte das wechselseitige Verhältnis von Schwarz und Grün.“5 Tatsächlich aber war die Beziehung zwischen der CDU und den Grünen im letzten Jahrzehnt der alten Bundesrepublik differen- zierter und vielschichtiger. Kurzen Phasen einer vorsichtigen Annäherung * Die Autoren danken Dr. Stefan Marx und Benedikt Wintgens M.A., für ihre hilfreichen Hinweise sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Archivs für Christlich-Demo- kratische Politik (ACDP) in Sankt Augustin für deren umfangreiche Unterstützung bei den Recherchen. 1 Vgl. hierzu Stephan Eisel: Über den Tag hinaus: Schwarz-Grün. Vom Gedankenspiel zur realistischen Option, in: Die Politische Meinung 383 (2001), S. 33–40; Hubert Kleinert: Schwarz-Grün erweitert Optionen. Zur Auflösung ideologischer Tabus, in: Die Politische Meinung 413 (2004), S. 69–74; Volker Kronenberg/Christoph Weckenbrock (Hg.): Schwarz-Grün. -

UID 1983 Nr. 13, Union in Deutschland
' Z 8398 C lnformationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands Union in. Deutschland Bonn, den 31. März 1983 £gM0. Deutsche Bundestag geht an die Arbeit Helmut Kohl: •ch glaube an die Kraft Unserer Bürger |Jach der Konstituierung und der Wahl des Präsidiums, der Wahl ?es Bundeskanzlers und der Vereidigung des Bundeskabinetts J*nn der 10. Deutsche Bundestag an die Arbeit gehen. Nach Ser* Votum der Wähler am 6. März, die Bundeskanzler Helmut L°h' und seine Koalition der Mitte überzeugend bestätigt ha- K*n' beginnt wieder der politische Alltag. Helmut Kohl sagte *ch seiner Wahl in einem Fernsehinterview: lr haben vier Jahre Zeit, eine volle Legislaturperiode. Das gibt natürlich eine oße Vo Autorität nach einem solchen Wahlsieg wie dem am 6. März. Wir stehen tj Schwierigsten Fragen, das Problem der Abrüstung und die Frage der Sta- lerun $D? 9. die Frage der Stabilisierung des Bündnisses, die notwendigen Ge- ache mit Moskau, die notwendigen Gespräche auch mit der politischen Füh- ^9 der DDR. Und im innenpolitischen Bereich liegen die Probleme für jeder- nn l<6. erkennbar zutage: über zwei Millionen Arbeitslose, Jugendarbeitslosig- Juri ^ Was mich 9anz besonders bedrückt —, die Situation junger Studenten, Q 9akademikerarbeitslosigkeit. S cj*r sind alles Probleme, die jetzt in den Vordergrund treten. Wiederbelebung . Ortschaft! Wir sind auf einem guten Weg. Aber das kostet viel Kraft, p ^'aube, daß die Zeichen der Zeit jetzt zu erkennen sind. Ich habe einige der Uns e 9enannt- Das sind Herausforderungen. Und ich glaube an die Kraft eres Landes, unserer Bürger, daß wir das gemeinsam schaffen werden. UiD 13 • 31. März 1983 • Seite 2 Das Kabinett Helmut Kohl BUNDESKANZLER: BUNDESMINISTER FÜR ARBEIT UND Dr. -

Deutscher Bundestag
Plenarprotokoll 12/46 - Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 46. Sitzung Bonn, Mittwoch, den 9. Oktober 1991 Inhalt: Tagesordnungspunkt 1: Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3834 A Befragung der Bundesregierung (Stand Dr. Martin Mayer (Siegertsbrunn) CDU/ der Verhandlungen zur Gemeinsamen CSU 3834 B Agrarpolitik [GAP]; weitere aktuelle The- men) Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3834 C Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3829 B Günther Bredehorn FDP 3834 C Jan Oostergetelo SPD 3830 A Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3834 C Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3830 B Rudolf Müller (Schweinfurt) SPD 3834 D Jan Oostergetelo SPD 3830 B Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3835 A Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3830 C Wolfgang Roth SPD 3835 B Peter Harry Carstensen (Nordstrand) CDU/ Jürgen W. Möllemann, Bundesminister CSU 3830 C BMWi 3835 C Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3830 D Dr. Willfried Penner SPD 3836 A Peter Harry Carstensen (Nordstrand) CDU/ Dr. Horst Waffenschmidt, Parl. Staatssekre CSU 3831 B tär BMI 3836 A Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3831 B Jürgen W. Möllemann, Bundesminister BMWi 3836 A Dr. Werner Hoyer FDP 3831 C Dr. Willfried Penner SPD 3836 B Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3831 C Dr. Horst Waffenschmidt, Parl. Staatssekre Dr. Uwe Jens SPD 3831 C tär BMI 3836 B Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3831 D Tagesordnungspunkt 2: Dr. Uwe Jens SPD 3832 A Fragestunde Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3832 B — Drucksachen 12/1238 vom 04. 10. 91 Meinolf Michels CDU/CSU 3832 C und 12/1260 vom 09. 10. 91 — Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3832 D Kurzfristige Maßnahmen zur Beendigung Dr. Fritz Schumann (Kroppenstedt) PDS/ der dramatischen Entwicklung in Kroatien; Linke Liste 3833 A diplomatische Anerkennung der Republiken Slowenien und Kroatien Ignaz Kiechle, Bundesminister BML 3833 A DringlAnfr 1, 2 08.