Ausgemusterte Mittel Der Schweizer Luftwaffe Flugzeuge, Helikopter, Flab
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cockpit Juni 2011 Als PDF Herunterladen
Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr. 06/Juni 2011 CHF 8.20 / € 5.50 Virtual Swiss Air Force Cover Story AERO 2011 – Fliegen wir in Zukunft «elektrisch»? Military Aviation Civil Aviation Helicopter Stealth-Heli auf 75 Jahre SKYe SH09 –Schweizer Terroristenjagd Aer Lingus Heli der Extraklasse real watches for real people Oris Swiss Hunter Team PS Edition Automatik-Werk Datumsanzeige Verschraubte Krone Wasserdicht bis 10 bar/100 m www.oris.ch Cockpit 06 2011 Editorial 3 Take-off Liebe Leserinnen und Leser «Ohne Flugplätze kein Luftverkehr!» heisst der dem seit Anfang Jahr eingeführten «Landefranken» tragen auch die Flug- eingängige Slogan des Verbandes Schweizer Flug- platznutzer einen kleinen Beitrag dazu bei, dass die VSF-Vertreter fach- plätze. Diese vier Worte bringen es auf den Punkt. lich und zeitgerecht den Regulierern in Brüssel und Köln auf Augenhöhe Flugplätze, ob klein oder gross, haben oft eine lange begegnen können. Piloten und Flugplatzbetreiber sitzen in einem Boot Tradition. Über Jahrzehnte hinweg dienten sie der – ganz im Sinne des Slogans «Ohne Flugplätze kein Luftverkehr!» Le- Schulung, dem Geschäfts- und Linienverkehr oder sen Sie bitte dazu den Beitrag des Geschäftsführers des VSF, Dr. Pierre dem fliegerischen Freizeitvergnügen. An Flugplät- Moreillon (Seite 26). zen entstanden Wartungs- und Zulieferbetriebe, Anfang Mai ist Cockpit mit dem VSF eine Zusammenarbeit eingegangen. Restaurants und Hotels, Flugschulen und Charter- Monatlich wird der Verband über die wichtigsten und dringlichsten An- betriebe. Und in der Folge weitere Unternehmungen, deren Wertschöpfung liegen berichten. Aktuell und umfassend informiert auch die VSF-Website aus der Luftfahrt stammt. Kurz: Arbeitsplätze, Steuerzahler. aerodromes.ch. Hier finden Sie alles, was zum Thema von Relevanz ist. -

Aircraft Name Stage Flights Aircraft Hours AEROSPATIALE AS350 NO
Public Transport Air Taxi Operations (a) for Year 2019 Table 1.13 Aircraft Name Stage Flights Aircraft Hours AEROSPATIALE AS350 NO MASTER SERIES 3 169 3 307 ASSIGNED AEROSPATIALE AS355 NO MASTER SERIES 4 418 5 715 ASSIGNED AEROSPATIALE AS365 NO MASTER SERIES 8 978 1 916 ASSIGNED AGUSTA A109 NO MASTER SERIES ASSIGNED 12 221 5 323 AGUSTA AW139 NO MASTER SERIES ASSIGNED 16 161 11 514 AGUSTA AW169 NO MASTER SERIES ASSIGNED 8 120 2 198 AGUSTA AW189 NO MASTER SERIES ASSIGNED 5 773 5 120 AIRBUS A321 200N 1 1 ATR ATR42 500 6 17 ATR ATR72 200 2 079 1 896 BAE JETSTREAM 4100 4100 1 783 1 185 BEECH 200 NO MASTER SERIES ASSIGNED 9 396 9 178 BEECH 300 NO MASTER SERIES ASSIGNED 15 14 BEECH 400 NO MASTER SERIES ASSIGNED 1 726 2 721 BEECH 90 NO MASTER SERIES ASSIGNED 202 188 BELL 206 B 9 792 2 264 BELL 429 NO MASTER SERIES ASSIGNED 1 053 951 BOMBARDIER BD100 1A10 NO MASTER SERIES 201 348 ASSIGNED BRITTEN NORMAN BN2A UNDESIGNATED MASTER 7 495 2 242 SERIES BRITTEN NORMAN BN2T NO MASTER SERIES 510 687 ASSIGNED CANADAIR CL600 2B16 600 813 1 438 CESSNA 310 NO MASTER SERIES ASSIGNED 765 747 CESSNA 402 NO MASTER SERIES ASSIGNED 233 199 CESSNA 404 NO MASTER SERIES ASSIGNED 67 57 CESSNA 421 NO MASTER SERIES ASSIGNED 162 167 CESSNA 510 NO MASTER SERIES ASSIGNED 1 044 1 066 CESSNA 525 NO MASTER SERIES ASSIGNED 1 524 1 986 CESSNA 550 NO MASTER SERIES ASSIGNED 1 442 1 902 CESSNA 560 NO MASTER SERIES ASSIGNED 2 970 3 576 CESSNA 680 NO MASTER SERIES ASSIGNED 308 528 CESSNA F406 NO MASTER SERIES ASSIGNED 894 672 DASSAULT FALCON 2000 NO MASTER SERIES 775 1 192 ASSIGNED -

L'industrie Aéronautique Et Spatiale Française
Le Groupement des Industries Françaises, L’industrie Aéronautique et Spatiale Française Chiffre d’affaires ’acte de naissance de l’industrie Aéronautiques et Spatiales ette industrie de souveraineté, de haute technologie, aéronautique, spatial, défense et sécurité en million d’euro (Me). L aéronautique française porte la performante, structurée, économiquement essentielle, Total 2011 estimé 38 500 Me (CA non consolidé). date du 11 janvier 1908. Ce jour là, C participe à la richesse de la France et contribue largement à quelques pionniers dont Louis Blériot, Le Gifas a trois missions principales : son rayonnement dans le monde. Avec 77 % de son chiffre d’affaires 28 % 28 % Louis Breguet, Gabriel Voisin et Robert consolidé réalisé à l’exportation, l’industrie française aéronautique, Militaire Répartition Militaire Représenter et coordonner Étudier et défendre Promouvoir les capacités 10 800 M 10 800 M spatiale, avec sa composante défense et sécurité, est72 le% premier secteur 28 % 72 % civil / militaire Esnault-Pelterie fondent la Chambre Civil Civil 28 % 1/ les activités de la profession 2/ les intérêts de ses adhérents 3/ technologiques industrielles Militaire Militaire 27 700 M Syndicale des Industries Aéronautiques, et humaines de la France dans exportateur français et dégage le premier excédent27 700 Mcommercial. 10 800 M HAUTE-NORMANDIE Le Conseil d’Administration du GIFAS, composé des L’étude et la défense des intérêts de la profession 72 % 72 % 10 800 M DASSAULT AVIATION 3 % Civil avec le but clairement exposé dirigeants des sociétés adhérentes, détermine les lignes entrent dans les missions naturelles de tout groupement le domaine aéronautique et spatial Son carnet de commandes représente l’équivalent de quatre années Civil 27 700 M 27 700 M d’action du GIFAS, en fonction des problèmes communs professionnel. -
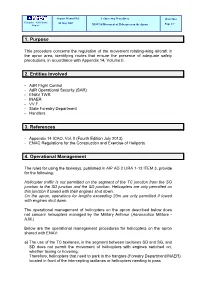
4. Operational Management 3. References 2. Entities Involved 1
Airport Manual Ed. 3. Operating Procedures 15/01/2016 Ciampino - G.B.Pastine 02 May 2007 MOV/14/Movement of Helicopters on the Apron Page 1/7 Airport 1. Purpose This procedure concerns the regulation of the movement rotating-wing aircraft in the apron area, identifying routes that ensure the presence of adequate safety precautions, in accordance with Appendix 14, Volume II. 2. Entities Involved - AdR Flight Control - AdR Operational Security (SAR) - ENAV TWR - INAER - VV.F. - State Forestry Department - Handlers 3. References - Appendix 14 ICAO, Vol. II (Fourth Edition July 2013) - ENAC Regulations for the Construction and Exercise of Heliports 4. Operational Management The rules for using the taxiways, published in AIP AD 2 LIRA 1-12 ITEM 3, provide for the following: Helicopter traffic is not permitted on the segment of the TC junction from the SG junction to the SD junction and the SD junction. Helicopters are only permitted on this junction if towed with their engines shut down. On the apron, operations for lengths exceeding 20m are only permitted if towed with engines shut down. The operational management of helicopters on the apron described below does not concern helicopters managed by the Military Airforce (Aeronautica Militare - A.M.) Below are the operational management procedures for helicopters on the apron shared with ENAV: a) The use of the TC taxilanes, in the segment between taxilanes SD and SG, and SD does not permit the movement of helicopters with engines switched on, whether taxiing or hovering. Therefore, helicopters that need to park in the hangars (Forestry Department/INAER) located in front of the intercepting taxilanes or helicopters needing to pass Airport Manual Ed. -

Military Simulator Census 2014 Flightglobal Insight | 3
IN ASSOCIATION WITH SPECIAL REPORT MILITARY SIMULATOR CENSUS 2014 Flightglobal Insight | 3 Flightglobal_Partner of Choice_Oct2014_AM310.indd 1 2014-10-28 8:37 AM MILITARY SIMULATOR CENSUS 2014 CONTENTS ABBREViaTIONS 4Mil 16 Indonesia 22 ANALYSIS 5Mitsubishi 17 Iran 22 NH Industries 17 Iraq 22 CENSUS BY aiRCRAFT MANUfacTURER Northrop Grumman 17 Israel 22 Aero Vodochody 7 Panavia 17 Italy 23 AgustaWestland 7 Pilatus 17 Japan 23 AIDC 7PZL 17 Jordan 23 Airbus Military 7 Raytheon 18 Kuwait 23 Alenia Aermacchi 8 Saab 18 Malaysia 23 AMX International 8 SEPECAT 18 Mexico 23 Antonov 8 Shenyang 18 Morocco 24 BAE Systems 8 Sikorsky 18 Myanmar 24 Beechcraft 8 Sukhoi 19 Netherlands 24 Bell 9 Transall 19 New Zealand 24 Bell Boeing 10 Tupolev 19 Nigeria 24 Boeing 10 Westland 19 Norway 24 Boeing Vertol 12 Oman 24 Boeing/BAS Systems 12 CENSUS BY OPERATOR COUNTRY Pakistan 24 Chengdu Aviation/Pakistan Aeronautical Complex 12 Algeria 20 Peru 24 CASA 12 Argentina 20 Poland 24 Dassault 12 Australia 20 Portugal 24 Dassault/Dornier 13 Austria 20 Qatar 24 Dassault-Breguet 13 Bahrain 20 Romania 24 Douglas 13 Belgium 20 Russia 24 Embraer 13 Brazil 20 Saudi Arabia 25 Enstrom 13 Brunei 20 Singapore 25 Eurocopter 13 Canada 20 Slovakia 25 Eurofighter 14 Chile 21 South Africa 25 Fairchild Republic 14 Colombia 21 South Korea 25 Hawker Beechcraft 14 Croatia 21 Spain 25 Hindustan Aeronautics 14 Czech Republic 21 Sudan 26 Hongdu 14 Denmark 21 Switzerland 26 IAR 14 Ecuador 21 Taiwan 26 Israel Aerospace Industries 14 Egypt 21 Thailand 26 Korea Aerospace Industries 14 Finland -

THE INCOMPLETE GUIDE to AIRFOIL USAGE David Lednicer
THE INCOMPLETE GUIDE TO AIRFOIL USAGE David Lednicer Analytical Methods, Inc. 2133 152nd Ave NE Redmond, WA 98052 [email protected] Conventional Aircraft: Wing Root Airfoil Wing Tip Airfoil 3Xtrim 3X47 Ultra TsAGI R-3 (15.5%) TsAGI R-3 (15.5%) 3Xtrim 3X55 Trener TsAGI R-3 (15.5%) TsAGI R-3 (15.5%) AA 65-2 Canario Clark Y Clark Y AAA Vision NACA 63A415 NACA 63A415 AAI AA-2 Mamba NACA 4412 NACA 4412 AAI RQ-2 Pioneer NACA 4415 NACA 4415 AAI Shadow 200 NACA 4415 NACA 4415 AAI Shadow 400 NACA 4415 ? NACA 4415 ? AAMSA Quail Commander Clark Y Clark Y AAMSA Sparrow Commander Clark Y Clark Y Abaris Golden Arrow NACA 65-215 NACA 65-215 ABC Robin RAF-34 RAF-34 Abe Midget V Goettingen 387 Goettingen 387 Abe Mizet II Goettingen 387 Goettingen 387 Abrams Explorer NACA 23018 NACA 23009 Ace Baby Ace Clark Y mod Clark Y mod Ackland Legend Viken GTO Viken GTO Adam Aircraft A500 NASA LS(1)-0417 NASA LS(1)-0417 Adam Aircraft A700 NASA LS(1)-0417 NASA LS(1)-0417 Addyman S.T.G. Goettingen 436 Goettingen 436 AER Pegaso M 100S NACA 63-618 NACA 63-615 mod AerItalia G222 (C-27) NACA 64A315.2 ? NACA 64A315.2 ? AerItalia/AerMacchi/Embraer AMX ? 12% ? 12% AerMacchi AM-3 NACA 23016 NACA 4412 AerMacchi MB.308 NACA 230?? NACA 230?? AerMacchi MB.314 NACA 230?? NACA 230?? AerMacchi MB.320 NACA 230?? NACA 230?? AerMacchi MB.326 NACA 64A114 NACA 64A212 AerMacchi MB.336 NACA 64A114 NACA 64A212 AerMacchi MB.339 NACA 64A114 NACA 64A212 AerMacchi MC.200 Saetta NACA 23018 NACA 23009 AerMacchi MC.201 NACA 23018 NACA 23009 AerMacchi MC.202 Folgore NACA 23018 NACA 23009 AerMacchi -

Abschuß Zweier Me 109
Historie Historie Abschuß zweier Me 109 Die schlechten Funkverbindungen machen Dübendorf. Deutschland drohte, sollte die Hitler einschaltet, führt die Besänftigungs- einfachste Worte, wie „ein“, „zwei“ und „drei“ Schweiz die Me 110 nicht herausgeben, sie politik der Schweiz Deutschland gegenüber nicht unterscheidbar. So besteht der Bambini- am Boden zu zerstören. Zu groß war die zum Grounding der Kampfflieger. Code vorwiegend aus italienischen Wörtern: Angst, die Alliierten könnten sie sehen oder Der Schweizer Gesandte Hans Frölicher „uno“, „due“, „tre“. „Bibi“ für Jagdflugzeug, gar in die Hände bekommen. Die Schweiz nennt in Berlin am 10. Juli 1945 die Folgen „Campari“ für Brennstoff, die eigenen sind zeigte sich einverstanden, sie am Boden zu der Fliegerzwischenfälle: „gefährlichste „Angeli“ und feindliche Flieger „Diaboli“. zerstören, wenn sie dafür 12 neueste Me Spannung während des ganzen Krieges“. Auf der Suche 109G erhielten. Diese waren aber so sehr So erkannte die politische und militärische Die Entwicklung von Kampfflugzeugen störanfällig (unsauber montiert oder sabo- Führung, auch wenn die Schweiz nicht wirk- geht rasch voran - nur nicht in der Schweiz. tiert), daß sie schon nach 3 Jahren ausge- lich kriegstaugliche Maschinen beschaffen 1941 ist ihre Flotte inklusive der Me 109 E mustert werden mußten. konnte, daß die Fliegertruppe ihren besten technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Messerschmitt gegen Messerschmitt Dienst leistete, als sie passiv am Boden blieb. Die Eigenentwicklung C-3603, die in Das Verhältnis der Schweizer zu ihrem Andere Entwicklungen Emmen produziert wird, kommt erst 1942 deutschen Nachbarn ist in der Zeit des Zwei- Auch in der Schweiz werden Kraftstoffe Foto©Flugwaffe Schweiz statt 1937 bei der Truppe zum Einsatz. -

Przegląd Geopolityczny
PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY (GEOPOLITICAL REVIEW ) Przegląd Geopolityczny (Geopolitical Review) Lato (summer) 2018 tom (volume): 25 KWARTALNIK RECENZOWANY PEER-REVIEWED QUARTERLY JOURNAL (DOUBLE-BLIND REVIEW PROCESS) DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/. Wszystkie tomy czasopisma w wersji elektronicznej są w otwartym dostępie na stronie internetowej kwartalnika. Wersją pierwotną „Przeglądu Geopolitycznego” jest wersja elektroniczna. Czasopismo ukazuje się w formie elektronicznej i drukowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (www.ptg.edu.pl). Wydawca, adres redakcji (Publisher, editorial adress) P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O G E O P O L I T Y C Z N E ul. mjr Łupaszki 7/26 30-198 Kraków http://www.ptg.edu.pl E-mail: [email protected] PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY (GEOPOLITICAL REVIEW) tom 25: 2018 (vol. 25: 2018) ISSN: 2080-8836 (print) 2392-067X (online) MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA (INTERNATIONAL SCIENTIFIC BOARD) Gideon Biger (Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael), Georges G. Cravins (Uniwersytet Wisconsin-La Crosse, USA), Bretislav Dancak (Uniwersytet im. Masaryka w Brnie, Czechy), Piotr Eberhardt (Polska Akademia Nauk) – przewodniczący Rady, Vit Hloušek (Uniwersytet im. Masaryka w Brnie, Czechy), Robert Ištok (Uniwersytet Preszowski, Słowacja), Anatol Jakobson (Uniwersytet Kolei Państwowych w Irkucku, Rosja), Rustis Kamuntavičius (Uniwersytet im. Wlk. Ks. Witolda w Kownie, Litwa), Vakhtang Maisaia (Międzynarodowy Uniwersytet Kaukaski w Tbilisi, Gruzja), Kaloyan Metodyev (Uniwersytet Południowo-Zachodni w Błagojewgradzie, Bułgaria), John S. -

Als Austauschpilot Im Mirage-Cockpit
Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr. 12/Dezember 2015 CHF 8.20 / € 5.50 Interview mit F/A-18-Pilot Nicolas Rossier Als Austauschpilot im Mirage-Cockpit 12 Military Aviation Civil Aviation Civil Aviation Aeroporto Qatar setzt auf Unterwegs mit Galileo Galilei «Dreamliner» der «Beluga» 9 770010 011006 $OV3LORWPLW (GHOZHLVVGLH:HOW HQWGHFNHQ Sind Sie von der Ferienfliegerei begeistert, technisch interessiert, verantwortungsvoll und zuverlässig? Schätzen Sie es, in einem jungen, professionellen Team zu arbeiten? Bewerben Sie sich jetzt als Ready Entry First Officer oder Linienpilot ab initio: flyedelweiss.com/company/jobs Ƅ\HGHOZHLVVFRP Cockpit 12 2015 Editorial 3 Foto: Florian Trojer Foto: Take your seats Liebe Leserinnen und Leser er Flughafen Zürich ist ein Magnet. Er ist das Tor zur Welt, Lösungen. Sicher ist nur, dass mit dem heutigen Pistensystem die Konsumtempel und eines der grössten Ausflugsziele der Nachfrage in Zürich wohl kaum mehr lange befriedigt werden DSchweiz. Er ist aber auch Zankapfel. Gestritten wird in ers- kann. ter Linie wegen dem auf den An- und Abflugrouten verursachten Deshalb wäre es zu begrüssen, dass sich die Landesregierung stärker Fluglärm. einbringen und den wirtschaftlichen Aspekt des «Tors zur Welt» Dazu kommt noch die Never-ending- höher gewichten würde. Nur so würde gewährleistet, dass das story mit dem fehlenden Staatsvertrag Export- und Tourismusland Schweiz weiterhin wettbewerbsfähig mit Deutschland – der nördliche Nach- bleibt. Doch wie sagte Bundesrätin Doris Leuthard am Forum der bar möchte die Anzahl Anflüge über sein Luftfahrt in Luzern: «Es ist falsch zu erwarten, der Bund könne die Gebiet möglichst auf deren 80 000 be- für die Luftfahrt nötigen Massnahmen allein veranlassen – wie ein schränken. -

17-04-2020 RUAG Modifies Swiss Air Force EC635 Helicopters To
17-04-2020 RUAG Modifies Swiss Air Force EC635 Helicopters to Transport COVID-19 Patients 2020 - 04 - 04 - defpost.com RUAG MRO Switzerland has recently EC635 helicopter model for utility and modified two Swiss Air Force EC635 training missions. They are also used for helicopters to transport COVID-19 individual and patient transport, and for patients, the company announced. The this purpose are equipped with standard time-sensitive project is jointly executed materials for medical care. by RUAG, Swiss Federal defense procurement agency armasuisse and the Due to the current situation brought Swiss Air Force. Two helicopters have about by coronavirus (COVID-19), the already been modified and are ready for Swiss Air Force has commissioned use by the Air Force. RUAG MRO Switzerland to specifically modify the infrastructure of this helicopter Eurocopter EC635 (now Airbus type for the transport of COVID-19 Helicopters H135M) is the military patients. version of the Eurocopter EC135 (now On one hand, spatial separation of the Airbus Helicopters H135). EC135 is the cockpit from the cabin is necessary in most frequently used helicopter for order to protect pilots from the disease to emergency services worldwide. The the greatest extent possible, ensuring Swiss Armed Forces primarily uses the their operational... Lire la suite APPELS D’OFFRES Provision of material for C-295 AND CL215 2020 - 04 - 17 - eportal.nspa.nato.int Ref: MUO20030 Organisme: LA - Aviation Support Date limite: 28.04.2020 E-mail: [email protected] Lire la suite Acquisition -
Magique AIR14
Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr. 10/Oktober 2014 CHF 8.20 / € 5.50 Payerne Magique AIR14 1 0 Military Aviation Civil Aviation Airport Das grosse Handy an Bord: Thomas Kern zum Rätsel F-35 Ja oder nein? Flughafen Zürich 9 770010011006 SCHWEIZER PRÄZISION Nicht nur Schweizer Uhren geniessen weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Anspruchsvolle Kunden schätzen auch Pilatus seit 75 Jahren für herausragende Qualität und erstklassigen Service. Für Privatflüge und Geschäftsreisen ist der PC-12 NG der beliebteste Turboprop auf dem Markt. Oder bei unserem Trainingssystem: Tausende Militärpiloten aus der ganzen Welt beenden ihre Pilotenausbildung erfolgreich auf einem unserer bewährten Trainingsflugzeuge. Pilatus Flugzeugwerke AG • Schweiz • Tel. +41 41 619 61 11 • www.pilatus-aircraft.com PC-21 & PC-12 Cockpit A4_FINAL_120614.indd 1 12/06/14 09:06 Cockpit10_02_Inserate.indd 48 11.09.14 13:47 Cockpit 10 2014 Editorial 3 Foto: AERO Foto: Foto. Luftwaffe Foto. Take your seats Liebe Leserinnen und Leser Die AIR14 ist bereits wieder Vergangenheit. Eigentlich der eigens für die AIR14 choreografierten Flugeinlage der schade. Auch wenn ich eher wenig an Flugshows gehe, hat Patrouille Suisse und des PC-7 TEAMs ganz zu schweigen. mich Payerne positiv überrascht. Ich habe den fliegerischen Das waren fliegerische Leckerbissen. Ich kann nun eher Höchstleistungen der Piloten voller Bewunderung zugese- nachvollziehen, weshalb Hunderttausende weltweit Jahr hen. für Jahr an die diversen Airshows pilgern, keine Kosten Erwähnen könnte man viele Vorfüh- und Mühen scheuen, sich auch von manchmal mühsamen rungen. Herausgepickt habe ich vor Anfahrtswegen und weiten Strecken bis ins Festgelände allem den beeindruckenden Auftritt nicht abhalten lassen. des belgischen F-16 am ersten Wochen- Die Luftwaffe hat beste Werbung für sich gemacht. -

Einladung Zur Vereinsversammlung 2019 25 Jahre Hunterverein / 25 Jahre Papyrus-Hunter Flugplatzfest St
Einladung zur Vereinsversammlung 2019 25 Jahre Hunterverein / 25 Jahre Papyrus-Hunter Flugplatzfest St. Stephan Samstag, 31. August 2019 www.hunterverein.ch Sponsoren und Partner Boltigen Lenk St. Stephan Zweisimmen Obersimmental-Saanenland Kilian + Luzia Wyssen 2 Vorwort der Gemeinderätin Liebe Vereinsmitglieder, Besucherinnen und Besucher Es ist mir eine besondere Ehre, alle Hunterfans zu den 25-Jahr-Jubiläumsfeierlichkeiten des Huntervereins Ober- simmental herzlich in St. Stephan willkommen zu heissen. Wenn ich auf die letzten 25 Jahre Ihres Vereinslebens zu- rückblicke, kommt mir das Sprichwort «wo ein Wille ist, ist auch ein Weg» in den Sinn! Es ist beachtlich mit wie viel Herzblut, ehrenamtlichen Einsätzen und unzähligen Arbeitsstunden es dem Vorstand, den Mechanikern und den Vereinsmitgliedern gelungen ist, den «Papyrus-Hunter» wieder in die Lüfte zu bringen. Ebenfalls ist es dem Vorstand immer wieder gelungen, am Hunterfest vielen begeisterten Be- sucherinnen und Besuchern ein attraktives und abwechslungsreiches Programm zu bieten. Ich denke an die Patrouille Suisse, das «PC-7 TEAM», die Super Cons- tellation, den Vampire und viele andere «Gästeflugzeuge», die den Weg nach St. Stephan unter die Flügel genommen haben. Ein weiterer Höhepunkt war im Jahr 2007 der Besuch des Astronauten Claude Nicollier, der selber Hunterpilot ist. Dank dem Hunterfest erhält unsere Region einen grösseren Bekanntheitsgrad, was ins- besondere aus touristischer Sicht wichtig ist. Bemerkenswert ist auch, wie viele Mitglieder sich dem Hunterverein angeschlossen haben. Das zeigt, wie gross die Verbundenheit und die Begeisterung zur Fliegerei und zum Hunterverein ist. Auch nach dem Abschluss der zivilen Umnutzung des Flugplatzes sollen weiterhin verschiedenste Nutzungen auf dem Areal möglich sein. Ziel ist es, neben der aviati- schen auch die nicht aviatische Nutzung (z.B.