Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Klassifikationen Des Bruno Kreisky Archivs
Klassifikation VII.1. Länderboxen Der Bestand „Länderboxen“ enthält die Kabinettsakten, die die österreichischen Beziehungen zu den jeweiligen Ländern im Zeitraum 1970–1983 beschreiben. Korrespondenzen mit Staatsoberhäuptern sind ebenso enthalten wie die Protokolle gegenseitiger Staatsbesuche, Pressespiegel ausländischer Botschaften etc. Vereinzelt wurden auch länderspezifische Akten aus Kreiskys Zeit als Außenminister (1959–1966) sowie länderspezifische Kopien aus anderen Archiven in den Bestand integriert. Dies ermöglicht einen umfassenden Einlick in die bilateralen Beziehungen Österreichs zu den jeweiligen Ländern. Stand: 2014 Ägypten (EG) Box 1: Mappe. „Bilaterale Besuche 1962-1994 1982-1983 Mappe. „Ägypten. Mubarak“: Rede von Mubarak in der 7. Konferenz der nichtpaktgedundenen Staaten in New Delhi, am 9. März 1983; Presseecho betr. kurzes Treffen Kreisky-Mubarak im Wiener Flughafen, Dezember 1982. Mappe. „Abaza, Maher, PM Ägypten, 12.-17.(19.)9.82“: Informationen betr. offiziellen Besuch des ägypt. Energieminister in Österreich, 12.- 19.9.1982. Mappe. „Kopten“: Informationen, Interventionen, Unterlagen betr. koptische Glaubensgemeinschaft in Ägypten, 1978-1982. Information: Abt. IV/A/10 - BK betr. Entwicklungshilfe Ägypten; Rinderfarm West- Noubaria, 5. März 1982. Bericht: Sektion IV - BK betr. 5. Tagung der österr.-ägypt. Gemischten Kommission in Wien am 22.-26. Februar 1982, 4. März 1982. Konvolut: Briefwechsel BK - ägypt. Botschaft betr. Ansprache Kreiskys an ägypt. Volk, österr. Entwicklungshilfe, 1980-1982. Mappe. „Auslandsreisen“: Mündlicher Bericht des BMf LV betr. einen Besuch der österr. UN-Kontingente im Nahen Osten vom 20. Bis 31.8.1983, 22. Juli 1983; Konvolut: Erhöhung der Budgetpost „Auslandsdienstriesen“, 1982-1983. Klassifikation 1981 Mappe. „Sadat. Attentat“: Konvolut: Reaktionen auf die Ermordung Sadats, Oktober 1981 - 1982. 2 Mappen. „Inoffizieller Besuch des ägypt. Präsidenten Anwar El Sadat in Österreich, August 1981“: Informationsmappe betr. -

Universite De Paris Viii-Vincennes Departement D'allemand a Saint-Denis L
UNIVERSITE DE PARIS VIII-VINCENNES DEPARTEMENT D'ALLEMAND A SAINT-DENIS L ' E V 0 L U T I 0 N I D E 0 L 0 G I Q U E D U P A R T I C H R E T I E N - S 0 C I A L A U P A R T I P 0 P U L I S T E A U T R I C H I E N par Gérard GRELLE Doctorat de 3e cycle 2 INTRODUCTION L'histoire politique de l'Autriche républicaine se divise en deux grandes périodes séparées l'une de l'autre par une troisième qui correspond à celle de l'austrofascisme et de l'occupation nazie. Cette dernière s'étend sur douze années (mars 1933-avril 1945) au cours desquelles l'ordre démocratique est démantelé et baillonné. Cet état de choses n'arrive pas du jour au lendemain; il est l'aboutissement de conflits qui opposent, sous la Première République, le camp conservateur au camp social- démocrate. Le résultat de ces conflits, c'est l'élimination par étapes de la démocratie par le parti chrétien-social et ses alliés fascistes, en particulier les "Heimwehren". Celle-ci s'effectue principalement par le fait qu'en 1933 le Parlement est mis hors d'état d'agir et qu'en 1934 tous les partis politiques sont interdits. On peut au contraire définir les deux grandes périodes démocratiques mentionnées auparavant comme jeu de rapports de force entre les partis politiques, jeu qui se déroule essentiellement dans le cadre des institutions parlementaires. -

CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18
The Schüssel Era in Austria Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES Volume 18 innsbruck university press Copyright ©2010 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Published and distributed in the United States by Published and distributed in Europe by University of New Orleans Press: Innsbruck University Press: ISBN 978-1-60801-009-7 ISBN 978-3-902719-29-4 Library of Congress Control Number: 2009936824 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Assistant Editor Ellen Palli Jennifer Shimek Michael Maier Universität Innsbruck Loyola University, New Orleans UNO/Vienna Executive Editors Franz Mathis, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität -

Wolfgang Schüssel – Bundeskanzler Regierungsstil Und Führungsverhalten“
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit: „Wolfgang Schüssel – Bundeskanzler Regierungsstil und Führungsverhalten“ Wahrnehmungen, Sichtweisen und Attributionen des inneren Führungszirkels der Österreichischen Volkspartei Verfasser: Mag. Martin Prikoszovich angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Politikwissenschaft Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Johann Wimmer Persönliche Erklärung Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbstständig verfertigt habe und dass die verwendete Literatur bzw. die verwendeten Quellen von mir korrekt und in nachprüfbarer Weise zitiert worden sind. Mir ist bewusst, dass ich bei einem Verstoß gegen diese Regeln mit Konsequenzen zu rechnen habe. Mag. Martin Prikoszovich Wien, am __________ ______________________________ Datum Unterschrift 2 Inhaltsverzeichnis 1 Danksagung 5 2 Einleitung 6 2.1 Gegenstand der Arbeit 6 2.2. Wissenschaftliches Erkenntnisinteresse und zentrale Forschungsfrage 7 3 Politische Führung im geschichtlichen Kontext 8 3.1 Antike (Platon, Aristoteles, Demosthenes) 9 3.2 Niccolò Machiavelli 10 4 Strukturmerkmale des Regierens 10 4.1 Verhandlungs- und Wettbewerbsdemokratie 12 4.2 Konsensdemokratie/Konkordanzdemokratie/Proporzdemokratie 15 4.3 Konfliktdemokratie/Konkurrenzdemokratie 16 4.4 Kanzlerdemokratie 18 4.4.1 Bundeskanzler Deutschland vs. Bundeskanzler Österreich 18 4.4.1.1 Der österreichische Bundeskanzler 18 4.4.1.2. Der Bundeskanzler in Deutschland 19 4.5 Parteiendemokratie 21 4.6 Koalitionsdemokratie 23 4.7 Mediendemokratie 23 5 Politische Führung und Regierungsstil 26 5.1 Zusammenfassung und Ausblick 35 6 Die Österreichische Volkspartei 35 6.1 Die Struktur der ÖVP 36 6.1.1. Der Wirtschaftsbund 37 6.1.2. -

Global Austria Austria’S Place in Europe and the World
Global Austria Austria’s Place in Europe and the World Günter Bischof, Fritz Plasser (Eds.) Anton Pelinka, Alexander Smith, Guest Editors CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 20 innsbruck university press Copyright ©2011 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, ED 210, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Book design: Lindsay Maples Cover cartoon by Ironimus (1992) provided by the archives of Die Presse in Vienna and permission to publish granted by Gustav Peichl. Published in North America by Published in Europe by University of New Orleans Press Innsbruck University Press ISBN 978-1-60801-062-2 ISBN 978-3-9028112-0-2 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lindsay Maples University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Helmut Konrad Universität Graz Universität -

Katalog Zur Ausstellung Österreichisches Staatsarchiv - Generaldirektion
Fotos und Dokumente im Österreichischen Staatsarchiv Katalog zur Ausstellung Österreichisches Staatsarchiv - Generaldirektion Text: Robert Stach Layout & Grafi k: Sabine Gfrorner Wien 2010 Zum Geleit Wenige Politiker im Laufe der Geschichte haben das Bild Österreichs im In- und Ausland so geprägt wie Bruno Kreisky (1911-1990). Seine Karriere führte diesen Mann, in verschiedensten Positionen seinem Land dienend, fast bis in das höchste Amt des Staates, eine Funktion für die zu kandidieren er jedoch ablehnte. Verfolgt von der Politik der Dreißigerjahre, als Sozialist, als Jude, kehrte er aus dem schwedi- schen Exil ohne Ressentiments zurück und half von Anfang an die Verwaltung der Zweiten Republik aufzubauen. Schon dabei nützte er die im Ausland geknüpften Kontakte für seine Arbeit und diese Verbindungen trugen in der Folge nicht nur zur Hebung seines Ansehens bei, sondern auch Österreich partizipierte davon. Wie einer seiner Biographen mit Recht meinte, strahlte Bruno Kreisky Charisma und Spontane- ität aus, war abwägend und impulsiv. Wer jemals diesem Mann persönlich begegnete und es leben heute noch viele Menschen, denen er persönlich gegenübertrat, mit ihnen diskutierte oder sie auch nur ansprach, der wird noch heute von dieser Persönlichkeit beeindruckt sein. Natürlich war auch er geprägt von Herkunft, Erziehung und allen Eigenschaften, die einen Menschen im Laufe seines Lebens prägen, aber doch war er für Generationen „der Kreisky“, der an den Staatsvertragsverhandlungen ebenso formend mitwirkte, wie dann als Außenminister in der Südtirolfrage um letzten Endes 13 Jahre als Bundeskanzler zu wirken. Das Österreichische Staatsarchiv nimmt den 100. Geburtstag dieses Staatsmannes zum Anlass in einer umfassenden Foto- und Aktenausstellung nicht nur nostalgische Erinnerungen zu wecken, sondern vor allem der heutigen Jugend mit dem von Kreisky überlieferten Bonmot „Lernen Sie Geschichte...“ mehr als ein Zeitalter nahezubringen. -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Anglo-Austrian Cultural Relations between 1944 and 1955. Influences, Cooperation and Conflicts. Verfasserin Isabella Lehner angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im Juli 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: Univ.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb 2 Eidesstattliche Erklärung Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die Arbeit selbständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und alle aus ungedruckten Quellen, gedruckter Literatur oder aus dem Internet im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt übernommenen Formulierungen und Konzepte gemäß den Richtlinien wissenschaftlicher Arbeiten zitiert, durch Fußnoten gekennzeichnet beziehungsweise mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Ort Datum Unterschrift 3 Acknowledgements This thesis owes much to the generosity and cooperation of others. Firstly, I am highly indebted to my supervisor Professor Oliver Rathkolb for his guidance and support. I owe a special thank you to Dr. Jill Lewis and (soon to be PhD) Helen Steele for repeatedly inspiring and encouraging me. Furthermore, I would like to thank Mag. Florentine Kastner for her support. Thank you for a friendship beyond history. Sincere thanks also go to the staff at The National Archives in Kew, and to the Institute of Germanic and Romance Studies at the University of London, especially Dr. Martin Liebscher, for assisting me during my research in London. A very special thank you goes to Raimund! Without your inspiring ideas, support and understanding this thesis would never have been completed. 4 Contents 1. -

Presse 18.5.1963: Kreisky Drängt Rom Zu Südtirol-Lösung
I.9. Interviews, Beiträge, TV-Diskussionen, Veranstaltungen nach 1984 1. Interviews: 24 Boxen, Standort: Büro III 2. Beiträge: 15 Boxen, Standort: Büro III 3. TV-Diskussionen: 3 Boxen, Standort: Archivraum I 4. Veranstaltungen: 6 Boxen, Standort: Büro III hintere Wand 1. Interviews Box 1 Interviews 1959-1963 Briefe, Fragenkataloge, Interviews sind oft nicht beigefügt Verzeichnis der Kreisky-Artikel 1955-1964 Mappe Zeitungsausschnitte 1963: Kreisky zum Begriff Neutralität Neues Österreich 18.5.1963: Kreisky urgiert Südtirol-Verhandlungen, Kurier 18.5.1963: Kreisky drängt Italien Die Presse 18.5.1963: Kreisky drängt Rom zu Südtirol-Lösung Datum 5911-- versch. Kopien zum Begriff Neutralität Österreichs 590912 Warren W. Unna (Brief) 591030 Sowjetunion heute, J. Wedenski 591014 Zemedelsko Zname (Bulgarien) Brief des Chefredakteurs 591208 Zürcher Presse-Foyer. Hugo Singer 590724 Pressekonferenz Bundesminister-jugoslawische Pressemeldungen 590928 Dr. Heinrich Krone Interview Chruschtschow Amerikareise, Brief 590201 Verz. d. Chefredakteure der Wr. Zeitungen sowie der Vertreter von Tageszeitungen aus der Provinz 59---- Interview für Svenska Dagbladet, Svend Portefe-Bahnsen, Brief 591020 Expressen (Schweden), Jussi Anthal, Brief 591102 Associated Press, Themen: Chruschtschow, Gromyko, UdSSR 591030 Neue Rhein Zeitung 591029 Neue Ruhr Zeitung 591026 Interview für die Zeitschrift Avanti (Italien), Durchschlag und Schriftverkehr, Umfang 13 Bl. Interview mit Dr. Carlo Belihar zu Südtirolpolitik und Rede vor der UNO-Generalversammlung mit hs. Korrekturen 591214 TV-Interview Otto M. Horn (Brief) 600316 P. Heiskanen, US-Konsulat München 600208 Edgar Schranz, Interview für westdeutsche Zeitungen 600310 Expressen (Schweden) 600307 TV-Interview Kamitz – Fischer Karwin 600313 Schweizer Landessender Beromünster 600404 Polen in Wort und Bild 600516 New York Herald Tribune-Interview Dr. Szilard (Atombombe) 60--- Olah “Bitte legen Sie ab” handschriftl. -
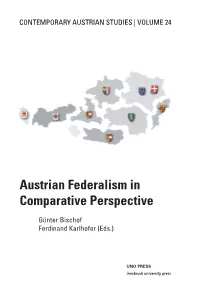
Austrian Federalism in Comparative Perspective
CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 Bischof, Karlhofer (Eds.), Williamson (Guest Ed.) • 1914: Aus tria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I War of World the Origins, and First Year tria-Hungary, Austrian Federalism in Comparative Perspective Günter Bischof AustrianFerdinand Federalism Karlhofer (Eds.) in Comparative Perspective Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) UNO UNO PRESS innsbruck university press UNO PRESS innsbruck university press Austrian Federalism in ŽŵƉĂƌĂƟǀĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 24 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2015 by University of New Orleans Press All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70148, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Book design by Allison Reu and Alex Dimeff Cover photo © Parlamentsdirektion Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press by Innsbruck University Press ISBN: 9781608011124 ISBN: 9783902936691 UNO PRESS Publication of this volume has been made possible through generous grants from the the Federal Ministry for Europe, Integration, and Foreign Affairs in Vienna through the Austrian Cultural Forum in New York, as well as the Federal Ministry of Economics, Science, and Research through the Austrian Academic Exchange Service (ÖAAD). The Austrian Marshall Plan Anniversary Foundation in Vienna has been very generous in supporting Center Austria: The Austrian Marshall Plan Center for European Studies at the University of New Orleans and its publications series. -

Dissertation
DISSERTATION Das Österreichische Fernsehen – demokratiepolitischer Bildungsauftrag oder Quote? Vom Volksbegehren bis zur Gegenwart Mag. rer. soc. oec, Mag. phil Johannes Naderhirn Angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, Dezember 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt A 092 312 Studienrichtung lt. Studienblatt Geschichte Betreuer: Univ.-Prof. DDr. Oliver Rathkolb Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), dt. Dichter Ein Danke im Nachhinein möchte ich meinem Vater sagen, der leider zu früh verstorben ist, um dabei sein zu können. Ich bin sicher, dass er diese Arbeit anderswo anderen vorlesen wird. Er war es, der in mir, seit meiner Kindheit, das Interesse für Geschichte geweckt und oft mit mir über alles – vor allem über Zeitgeschichte – diskutiert hat. Mein Vater hatte ein profundes geschichtliches Wissen, ohne es gelernt oder beruflich genutzt zu haben. Ein Teil meiner Arbeit könnte auch die seine sein. Meiner Mutter gebührt besonderer Dank, weil sie es war und ist, die mich immer wieder unterstützt hat, weil sie an mich glaubte (…und das war gar nicht immer so leicht). Ihr habe ich viel zu verdanken, immerhin kennt sie mich ja schon beinahe 49 Jahre. Ein ganz großes Dankeschön gilt meiner Partnerin Beatrice, die ich in fremden Landen kennenlernen durfte, und wir entdeckten dort, dass wir uns sehr nahe sind. Sie hat viel Geduld bewiesen und auch entscheidend dazu beigetragen, dass die vorliegende Dissertation auch „zum Anschauen ist“. Vielen Dank auch an Dr. Oliver Rathkolb, dessen Wissen und dessen Denken in Zusammenhängen mich sehr faszinieren. Gespräche mit ihm waren und sind sehr anregend, und ich genieße jede Lehrveranstaltung bei ihm. -

Austrian Neutrality in Postwar Europe
67 - 12,294 SCHLESINGER, Thomas Otto, 1925- AUSTRIAN NEUTRALITY IN POSTWAR EUROPE. The American University, Ph.D„ 1967 Political Science, international law and relations University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan © Copyright by Thomas Otto Schlesinger 1967 AUSTRIAN NEUTRALITY IN POSTWAR EUROPE BY THOMAS OTTO SCHLESINGER Submitted to the Faculty of the School of International Service of The American University In Partial Fulfillment of The Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in INTERNATIONAL RELATIONS Signatures of Committee: RttAU Chairma Acting Dean: yilember Member auu. 2 rt£ 7 Datete Approved 2 , 7 June 1967 The American University AMERICAN UNIVERSITY LIRPAOY Washington, D. C. MAY 2 a mi A crMn PREFACE In thought, this dissertation began during the candi date's military service as interpreter to the United States military commanders in Austria, 1954-1955, and northern Italy, 1955-1957. Such assignments, during an army career concluded by retirement in 1964, were in part brought about by the author's European background— birth in Berlin, Ger many, and some secondary schooling in Italy and Switzerland. These circumstances should justify the author's own trans lation— and responsibility therefor— of the German, French, and Italian sources so widely used, and of the quotations taken from these. As will become obvious to any reader who continues for even a few pages, the theoretical conception for this study derives in large part from the teachings of the late Charles O. Lerche, Jr., who was Dean of the School of Inter national Service when the dissertation was proposed. While Dean Lerche's name could not appear in the customary place for approval, the lasting inspiration he provided makes it proper that this student's deepest respect and admiration for him be recorded here. -

Diplomarbeit Sabine Wlazny –
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Das erste Kabinett Kreisky – Aufbruch in eine soziale Zukunft“ Verfasserin Sabine Verena Wlazny angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Politikwissenschaft Betreuer: Univ.-Doz. Dr. Johann Wimmer 2 Inhaltsverzeichnis Vorwort ............................................................................................................................ 7 1 Einleitung ...................................................................................................................... 9 1.1 Forschungsleitende Fragen und methodischer Zugang ........................................ 11 1.2 Aufbau der Arbeit ................................................................................................. 13 2 Theorien ....................................................................................................................... 15 2.1 Der Parlamentarismus – Definition ...................................................................... 15 2.2 Parlamentarismus in Österreich ............................................................................ 17 2.2.1 Der Nationalrat ............................................................................................... 20 2.2.2 Der Bundesrat ................................................................................................. 25 2.2.3