HL 2005 Für Pdf- Ludwig Tent
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Konzept Zur Revitalisierung Der Berner Au Zur Erreichung Des Guten Ökologischen Potenzials
Konzept zur Revitalisierung der Berner Au zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials Planungsgruppe Umwelt Stiftstraße 12 · D-30159 Hannover Tel.: 0511/ 51 94 97 80 Fax: 0511 / 51 94 97 80 e-mai 1: i nfo@pla nungsgruppe-umwelt. de Konzept zur Revitalisierung der Berner Au zur Erreichung des guten ökologischen Potenzials Auftraggeber: Geschäftsbereich Gewässer und Hochwasserschutz Fachbereich Planung und Entwurf Gewässer G1 Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Sachsenfeid 3-5 20097 Hamburg Erstellt durch: Planungsgruppe Umwelt Stiftstraße 12 30159 Hannover Bearbeitung: Projektleitung Bearbeitung: Hannover, den 25.04.2013 PLANUNGSGRUPPE UMWELT PJ Inhalt 1 Einleitung ................................................................................ „.„.„.„.„.„ ........... 2 1.1 Anlass und Zielstellung ......... .... .. .... „ ... • ...... „ ... „ ...... ... „ ...... ..... • ..... „ ... • ...... „ ....... 2 1.2 Planungsgrundlagen .... „ . ..... ..... „ .. ... ... „ .. ... ...... 2 1.2.1 Allgemeine Grundlagen ..... ... 2 1.2.2 Nutzungsinteressen ... 3 1.2.3 Aktuelle Gewässerunterhaltung .... ......... „ „„ ..... „ „ „„ .„.„ „„„ . ..... „„ „ . .... „„ „ . .. ... 3 2 Bestandsbeschreibung der Berner Au ............................................................... 4 2.1 Gewässerstrukturgüte ... ....... .. ... ...... .... „ ...... „ ... • ...... „ ... • ...... „ ... „ ...... „ ... • ...... „ ..... 7 3 Defizitanalyse der Berner Au ................................................................. „.„.„.„ -

Hochwasser an Hamburgs Binnengewässern Am 6. Und 7
Hochwasser an Hamburgs Binnengewässern am 6. und 7. Februar 2011 Berichte des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer Nr. 6 / 2011 2 Hochwasser an Hamburgs Binnen gewässern am 6. und 7. Februar 2011 Berichte des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer Nr. 6 / 2011 3 Vorwort 4 Hochwässer, insbesondere wenn sie mit Schäden die im Winter durch lang anhaltenden Dauerregen verbunden sind, lassen die Betroffenen immer wie- entstehen, wenn die Böden keinen Regen mehr der nach dem Staat rufen. Je nach Größenordnung aufnehmen können, entweder weil sie bereits ge- und Ursache können solche Forderungen auch sättigt oder noch gefroren sind. berechtigt sein. Oft sind die entstandenen Schäden aber auch hausgemacht oder selbst verschuldet. Zu so einem Ereignis kam es im Februar dieses Wie auch immer müssen alle Betroffenen aus Jahres, als es im Nordosten unserer Stadt und Hochwasserereignissen lernen und die richtigen noch stärker im angrenzenden Schleswig-Holstein Konsequenzen ziehen. So können Schäden in der derart regnete, dass die dortigen Gewässer über Zukunft vermieden und Kosten eingespart werden. die Ufer traten und lokal erhebliche Schäden ver- ursachten. Hamburg, die Grüne Metropole am Wasser, bietet aufgrund seiner vielen Gewässer eine besonders Der vorliegende Bericht dient zum einen der hohe Lebensqualität. Ob die Elbe mit dem Weltha- Dokumentation dieses Hochwassers, zum anderen fen, die Binnen- und Außenalster als Wasserspor- dazu, die richtigen Lehren aus dem Ereignis zu trevier oder die vielen Stadtkanäle, Fleete, Mar- ziehen. Wie wichtig gerade letzteres ist, zeigt der schengewässer oder Seen: Wasser ist in Hamburg im Bericht gezogene Vergleich zum Ereignis des allgegenwärtig. Neben den vielen positiven Aspek- Jahres 2002. -

Kleine Anfrage
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 20/12444 20. Wahlperiode 22.07.14 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Roland Heintze und Birgit Stöver (CDU) vom 15.07.14 und Antwort des Senats Betr.: Wie teuer wird die Gewässerinstandhaltung? Die EG-Wasserrahmenrichtlinie sieht vor, dass bis maximal 2027 alle von ihr erfassten Oberflächengewässer und Grundwasser in einem guten Zustand sind. Für Hamburg bedeutet das, dass bis dahin rund 300 Einzelmaßnahmen umgesetzt werden müssen. Die Gesamtkosten wurden mit 57 Millionen Euro veranschlagt. Bis Anfang 2013 waren laut dem Jahresbericht 2014 des Rech- nungshofs 69 Maßnahmen umgesetzt. Die Kosten lagen hierbei rund 85 Pro- zent über der Ausgangsplanung. Wir fragen den Senat: Die BSU als für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zuständige Behörde in Hamburg koordiniert in dieser Funktion auch die Umsetzung der zur Zieler- reichung erforderlichen Maßnahmen mit den tatsächlichen Maßnahmenträgern (vor allem Bezirksämter, HPA). In diesem Zusammenhang wird in regelmäßig stattfindenden Gesprächen insbesondere mit den hamburgischen Bezirksämtern die jährliche Maß- nahmenplanung detailliert besprochen. Dabei werden auch erforderliche Umsteuerun- gen in der Maßnahmenumsetzung, die sich sowohl auf den Wegfall als auch die zusätz- liche Aufnahme von Maßnahmen erstrecken können, in die Wege geleitet. Daraus kön- nen sich Veränderungen bei der Gesamtzahl umzusetzender Maßnahmen und somit auch bei den anfallenden Kosten ergeben. Die in dem Bericht des Rechnungshofs zur Umsetzung der WRRL erwähnte Hochrechnung der Kosten für noch ausstehende Maß- nahmen und der daraus vom Rechnungshof angenommenen zukünftigen Fehlfinanzie- rung basieren auf einer Kostenschätzung der BSU in einem sehr frühen Stadium der WRRL-Umsetzung. Allerdings wurden gerade in den Anfangsjahren der Maßnahmen- umsetzung zahlreiche kostenintensive Maßnahmen umgesetzt (beispielsweise diverse Entschlammungsmaßnahmen). -

Schriftliche Kleine Anfrage Und Antwort Des Senats
BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/32 21. Wahlperiode 10.03.15 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Dennis Thering (CDU) vom 04.03.15 und Antwort des Senats Betr.: Behördenwillkür beenden – Festsetzung des Überschwemmungsge- biets Berner Au endlich stoppen! Der Hamburger Senat plant die Festsetzung von weiteren elf Überschwem- mungsgebieten in Hamburg. Diese wurden von der Behörde für Stadtent- wicklung und Umwelt (BSU) und dem Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) ermittelt und sind jetzt vorläufig gesichert. Bis zum 14.08.2014 konnten betroffene Bürgerinnen und Bürger Stellungnahmen abgeben. Die eingegangen Stellungnahmen sollen danach geprüft und bei der formellen Festsetzung berücksichtigt werden. Die Sorgen bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern wegen der zu erwartenden Wertminderung ihrer Grundstücke und Immobilien sind erheb- lich. Die Auswirkungen einer solchen Wertminderung auf die individuelle Lebensplanung sind groß. Das bisherige Vorgehen der zuständigen Fachbe- hörden ist daher unerklärlich. Wie aus der Antwort des Senats auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Birgit Stöver vom 23.06.2014 (Drs. 20/12233) hervorgeht, war die Informationspolitik gegenüber den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern katastrophal. Und die Notwendigkeit der Festsetzung der neuen Über- schwemmungsgebiete ist ebenfalls nicht detailliert begründet worden. Ein einfacher Verweis auf das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist dafür nicht aus- reichend. Es erklärt nicht, was sich in den letzten Jahren an den Hamburger Gewässern geändert hat, sodass eine Festsetzung weiterer elf Über- schwemmungsgebiete notwendig geworden ist. Insbesondere bei dem neuen Überschwemmungsgebiet Berner Au regt sich heftiger Widerstand gegen das Vorgehen der Behörden. Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich uninformiert, nicht eingebunden und können die bis- herigen Begründungen der Fachbehörde nicht nachvollziehen. -

Die Friedenskirche Und Die Osterkirche in Eilbek.Indd
Die Friedenskirche und die Osterkirche in Eilbek Die Osterkirche Kirche, Park, Kunst & Geschichte Die Lage Die erste urkundliche Erwähnung der Region um 1250 nennt den Erwerb des Hamburger Hospitals zum Heiligen Geist von drei Hufen Land „in Eilenbeke“. Sie lagen zwischen der Eilbek, dem Unterlauf der Wandse und der Landstraße Hamburg - Wandsbek - Lübeck. Lange Jahrhunderte ist über das kleine Bauern- dorf nichts bekannt. Nach der Franzosenzeit begann die langsame Besiedlung Eilbeks, als die Ham- burger aus der Enge der durch Festungswälle eingeschnürten Stadt hinaus- drängten. 1841 wohnten hier 290 Personen. 1848 wurde auf dem zum Dorfe Hamm gehörenden Flurstück „Peterskamp“ ein Friedhof der innerstädtischen St. Jacobikirche angelegt, dem sich 14 Jahre später der neue Hammer Friedhof anschloss. Dieser Friedhof lag in völlig ungewohnter Entfernung vier Kilometer vor der Stadt. Baugeschichte Der Vorstand der Jakobikirche wollte eine besonders schöne Friedhofskapelle haben. Deshalb wurde von den Entwürfen derjenige des berühmten Architekten Alexis de Chateauneuf ausgewählt, der sich nach dem grossen Brand in Ham- burg durch seine Planungen für die Alsterarkaden sowie der neuen Post ausge- zeichnet hatte. Politische Streitigkeiten um eine Torsperre zwischen Hamburg und Wandsbek verzögerten den Baubeginn bis zur Aufhebung dieser Torsperre im Jahre 1863. 1864 war die neugotische Kapelle fertiggestellt; der schnellwachsende Stadtteil Eilbek fügte viele Menschen, Häuser und auch Kirchen hinzu, z.B. die Nachbar- kirchen in Eilbek: Friedenskirche (1885) und Versöhnungskirche(1921). Nach der Aufhebung des Friedhofs in den 20er Jahren zugunsten von Ohlsdorf wurde 1964 aus der Kapelle eine Gemeindekirche. Bei der Gründung wurde der Friedhof kaum besucht, man empfand ihn als aus- serordentlich weit von der Stadt weg; jetzt aber erfreuen sich seit vielen Jahren die Menschen an Ruhe und Schönheit von Kirche und Park ein erholsamer Ort für Leib und Seele mitten in der Stadt. -

2018-04-Farmsen.Pdf
Rundschau Für Leute mit Durchblick 8PIJOEBNJU &JOMBHFSO CFJ1JDLFOT 0800 - 85 85 9 85 www.pickens.de Pickens Wandsbek Holstenhofweg 41 Ostern 2018 ÛAY`j_Yf_ÛÝÛEjÛ E-Mail: [email protected] NACHRICHTEN UND BERICHTE AUS FARMSEN-BERNE & UMGEBUNG Wieder Osterfeuer in Farmsen Viele Jahre lang veranstaltete der Ordnungsbehörde des Bezirksamtes Verein Strandbad Farmsen zum Auf- Wandsbek aufgelegtes Sicherheitskon- takt der Saison ein Osterfeuer - doch zept, in dem unter anderem vorge- ab 2015 blieb es aus. Jetzt lebt die schrieben wurde, daß 20 professionel- Tradition wieder auf. le Sicherheitskräfte zu engagieren Sie gehören zu Ostern wie der Oster- seien, um eine sichere Feier zu gewähr- hase - die traditionellen Osterfeuer. leisten und daß Alkohol lediglich bis Auch auf dem Gelände des Strandba- 20 Uhr ausgeschenkt werden darf. Weil des Farmsen kamen Nachbarn und allein die Personalkosten einen finan- Freunde aus der Umgebung jahrelang ziellen Verlust bedeutet hätten, sah sich zusammen, um gemeinsam zu feiern. der Veranstalter damals gezwungen, Doch 2015 blieb das Feuer zum ersten das Osterfeuer kurzfristig abzusagen. Mal aus. Der Grund war ein von der Fortsetzung auf Seite 3 Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern Frohe Ostern! Termine Seite 4 Branchen Seite 22 Kino Seite 8 Arbeitsmarkt Seite 24 Gute Nachrichten: Das Osterfeuer auf dem Parkplatz des Strandbades Farmsen brennt wieder. Shopping Seite 13 Sport Seite 26 >52#%'56#4 Brillen·Kontaktlinsen ·Vergrößernde Sehhilfen Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang, 52 kW/71 PS UÊ iÌÀÃV iÊ*>ÃÃL`iÀ Neuwagen mit 0 km >ÕV ÊvØÀÊÀ>i>ÃÃi® Wendig. Sparsam. Günstig. Basisversion viele praktische Details großzügiger Innenraum UÊ iÜiÀLÕ}ëÀÌÀ>Ìà Fahrersitz höhenverstellbar elektr. -
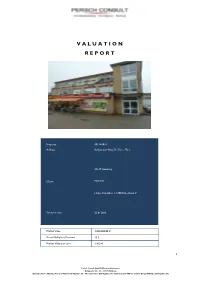
V a L U a T I O N R E P O R T
V A L U A T I O N R E P O R T Property: 0013+0014 Address: Rahlstedter Weg 73, 75a-c, 77a-c 22147 Hamburg Client: Nykredit Under Krystallen 1, 1780 København V Valuation date: 25.01.2016 Market Value 3.090.000,00 € Gross Multiplier (Current) 15,4 Market Value per sq m 1.412 € 1 Persch Consult GmbH | Chartered Surveyors Budapester Str. 47 – 20359 Hamburg Geschäftsführer: Nikolaus Persch | FRICS | CIS HypZert (F) - Thomas Fischer CIS HypZert (F) - Bärbel Strauß MRICS - Steffen Berger MRICS | CIS HypZert (F) STRUCTURE 1 EXECUTIVE SUMMARY 3 2 OBJECT KEY FIGURES AND CASH FLOW ANALYSIS 6 3 GENERAL INFORMATION 16 4 VALUATION 20 5 LIABILITY AND PUBLICATION 21 Preamble to the Valuation Report Our valuation assessment reflects these circumstances as well as the actual market development, according to the valuation standards of RICS Red Book. Definition of market rent (RICS Red Book 2014, Glossary) “The estimated amount for which an interest in real property should be leased on the valuation date between a willing lessor and willing lessee on appropriate lease terms in an arm’s length transaction, after proper marketing and where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.” With reference to RICS Red Book Regulations (VPS 4) and § 10 (1) BelWertV (acc. to German Pfandbrief legislation), valuations based on income approaches have to be calculated on the following mandatory assumptions: When calculating the gross rental income of a property it has to be considered, that only gross rental incomes are relevant, which can be generated by a. -

Jenfeld · Tonndorf · Farmsen-Berne Und Eilbek WI 01-13 18.12.2012 13:14 Uhr Seite 2
WI 01-13 18.12.2012 13:14 Uhr Seite 1 1 Januar 2013 27.Jahrgang Die Monatszeitschrift für Wandsbek (mit Hinschenfelde) · Marienthal · Jenfeld · Tonndorf · Farmsen-Berne und Eilbek WI 01-13 18.12.2012 13:14 Uhr Seite 2 lende Unterstützung zahlreicher Sponsoren gelingt es uns, die Zum Jahreswechsel notwendigen Reparaturen ausführen zu lassen. Dafür sage ich besonders herzlichen Dank. Ein entsprechender Dank geht auch an das Museumsteam, das Grußwort der 1.Vorsitzenden zuverlässig und kompetent den Besuchern zur Verfügung steht des Wandsbeker Bürgervereins sowie an die Betreuerin des Schimmelmann-Mausoleums. Liebe Leserinnen Seit mehr als 25 Jahren erscheint unsere gefragte Monatszeit- und Leser, schrift ‘Wandsbek informativ’ jeweils am Anfang eines Monats und berichtet in bewährter Weise über Aktuelles, Historisches die Festwochen sind vorüber, und Veranstaltungen. Durch die vielfältigen Werbeanzeigen eine Zeit, die wir gern in kann das Erscheinen des Magazins garantiert werden. Auch Gemeinschaft mit der Familie dafür besten Dank. und Freunden verbringen. In Jetzt liegt ein neues Jahr vor uns, in das wir Hoffnungen, Er- der dunklen Jahreszeit ist es be- wartungen und Neugier setzen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihre sonders wichtig, das Miteinan- Vorhaben gelingen mögen und wir im Verein weiterhin ein der zu pflegen, um Einsamkeit harmonisches Miteinander pflegen. Allen Mitgliedern, Sponso- nicht aufkeimen zu lassen. Ein ren und Unterstützern sage ich im Namen des Vorstands herz- freundliches Wort zum Nach- lichen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich freue barn, eine Einladung, Besuche mich auf ein fruchtbares neues Jahr. oder vielfältige Mithilfe und Unterstützung in Vereinen, das Ihre alles gibt uns Zufriedenheit Ingrid Voss und Selbstachtung. -

(2015) Gesamtliste Der Fließgewässer Im Elbeeinzugsgebiet
Stand: 01.07.2015 Gesamtliste der Fließgewässer im Elbeeinzugsgebiet Bergemann, Michael, Behörde für Umwelt und Energie, Hamburg ([email protected]) Ergänzungen von: Böhme, Michael, UFZ Halle-Leipzig Compernolle, Frank, Hamburg Löser, C., Itzehoe Ruß, Mathias Schwehla, Wolfgang, WSA Dresden Wagner, Günther, Hamburg Einleitung Seit 1998 wird diese Fließgewässer-Liste des Elbe-Einzugsgebietes zusammengestellt, um eine Übersicht über die Verzweigungen im Gewässernetz der Elbe zu bekommen. Die Liste ist nach der klassischen Gewässerordnungszahl (s.u.) aufgebaut. Danach ergibt sich die Orientierung der Liste jeweils von der Mündung zur Quelle der Elbe und der Nebenflüsse. Die Gewässerliste, in der inzwischen rd. 8600 Flüsse und Bäche aufgeführt sind, ist noch nicht vollständig. Es fehlen schätzungsweise noch über 250 kleinere Bäche und Gräben, deren Namen schwer zu ermitteln ist. Auch sind die hydrologischen Angaben von unter- schiedlicher Qualität, je nach der verwendeten Quelle. Die Veröffentlichung auf der Home- page der FGG Elbe soll Leser ermutigen, mögliche Fehler und Lücken an den Autor zu melden (s. o.). Diese Informationen können dann eingearbeitet werden. Gewässerordnung Die Gewässerordnungszahl (Flussordnungszahl) gibt den Grad der Verzweigung in einem Gewässernetz an. Bei der klassischen Gewässerordnung bekommt der Strom, der ins Meer mündet, die Ordnungszahl 1, die Nebenflüsse jeweils eine um 1 höhere Ordnung bis hinauf zu den kleinsten Bächen. Dieses System der klassischen Gewässerordnung wurde in der vorliegenden Liste verwendet. Die Gewässerordnungszahl in den verschiedenen Bundesländer-Wassergesetzen richtet sich dagegen nach der wasserwirtschaftlichen Bedeutung eines Fließgewässers. Es gibt somit Unterschiede zu der klassischen Gewässerordnungszahl. II Gewässernamen Kleinere Flüsse können abschnittsweise bis zu fünf verschiedene Namen tragen. Hinzu kommen oft noch mehrere historische Namen. -

Supporting Multi Stakeholder Involvement for Flood Risk Management Planning
Supporting Multi Stakeholder Involvement for Flood Risk Management Planning Natasa Manojlovic, Niloufar Behzadnia, Sandra Hellmers, Dmitrijs Barbarins, Erik Pasche†, Hamburg University of Technology-TUHH Belgrade, 6th, September 2012 Contents • Introduction • SAWA-HH Governance Approach – DSS for FRMP • Implementation • Lessons learned and conclusions Introduction D: Climate change P: Rapid urbanisation (Flood Directive, EC 2007/60 ) 1. preliminary risk assessment 2. flood hazard and risk map 3. flood risk management plan (FRMP) Due – end of 2015 Introduction What says the Flood Directive EC 2007/60 (Article 10 (1)) : Member States shall make available to the public the preliminary flood risk assessment, the flood hazard maps, the flood risk maps and the flood risk management plans. (Article 10 (2)) : Member States shall encourage active involvement of interested parties in the production, review and updating of the flood risk management. Open Question in the context of FRMP What are efficient ways of public and stakeholder participation in the planning procedure? What is the appropriate method to quantify the efficiency and effectiveness of the developed strategies for FRMP? Introduction Governance is a process Definition: the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (UN – Economic and social commission of Asia and the Pacific) - It is about how authorities, institutions and social organizations interact with citizens when making decisions Good Governance stands for . multifaceted decision making process where the societal goals are pursued with the interactions of all the interested actors in all specific fields of development . and in which ethical and democratic issues are respected, such as responsibility, accountability, transparency, equity, and fairness SAWA-HH Governance Approach Bottom up governance strategy for development of a Flood Risk Management Plan: (Adapted from Ashley et al, 2008) SAWA-HH Governance Approach 1. -

Umweltbericht Zum Entwurf Des Flächennutzungsplans Der Stadt Ahrensburg
Umweltbericht zum Entwurf des Flächennutzungsplans der Stadt Ahrensburg Auftraggeber Stadt Ahrensburg Stadtplanung/Bauaufsicht/Umwelt Manfred-Samusch-Straße 5 22926 Ahrensburg Auftragnehmer EGL - Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH Unzerstraße 1-3 22767 Hamburg Tel.: 040/38 91 28-0 Fax : 040/ 38 34 51 Bearbeiter Christiane Buchwald Andrea Keller Katharina Höchst Hamburg, Juni 2016 I Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1 1.1 Anlass und Aufgabenstellung 1 1.2 Rechtsgrundlagen und Verfahrensablauf 2 1.3 Räumlicher Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes 3 1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau des Umweltberichtes 4 1.5 Kurzdarstellung der Inhalte des Flächennutzungsplans 6 2. Umweltziele gemäß Fachgesetzen und Fachplänen 10 2.1 Umweltschutz allgemein, Wechselwirkungen 10 2.2 Schutz des Wohnumfeldes, Gesundheitsschutz 12 2.3 Arten- und Biotopschutz 13 2.4 Bodenschutz 18 2.5 Gewässer-, Hochwasser- und Grundwasserschutz 20 2.6 Klimaschutz, Luftreinhaltung 23 2.7 Denkmalschutz 24 2.8 Landschaftsschutz 25 3. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 27 3.1 Mensch 27 3.2 Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume 29 3.2.1 Charakterisierung des Planungsraumes 29 3.2.2 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 31 3.2.3 Nationale Schutzgebiete 34 3.3 Boden 38 3.3.1 Überblick über die bodenkundlichen Gegebenheiten 38 3.3.2 Altlasten 39 3.4 Wasser 40 3.4.1 Oberflächengewässer 40 3.4.2 Grundwasser 42 3.5 Klima / Luft 42 3.5.1 Klima 43 3.5.2 Luftqualität 43 Umweltbericht zum Entwurf des Flächennutzungsplans der Stadt Ahrensburg Juni 2016 II 3.6 Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung 44 3.7 Kultur- und Sachgüter 45 3.8 Besonders empfindliche Bereiche 47 4. -

Begründung Zum Bebauungsplan Rahlstedt 114/Farmsen-Berne 32 1
Begründung zum Bebauungsplan Rahlstedt 114/Farmsen-Berne 32 1. Grundlage und Verfahrensablauf Grundlage des Bebauungsplans ist das Baugesetzbuch in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137). Da das Planverfahren bereits vor dem In- Kraft-Treten dieser Gesetzesänderung, d.h. vor dem 1. Januar 1998, förmlich eingeleitet worden ist, wird es gemäß § 233 Absatz 1 des Baugesetzbuchs nach den bisher gelten- den Rechtsvorschriften abgeschlossen. In Erweiterung der städtebaulichen Festsetzun- gen enthält der Bebauungsplan bauordnungs- und naturschutzrechtliche Festsetzungen. Das Planverfahren wurde durch den Aufstellungsbeschluss W 3/95 am 5. Juli 1995 mit der Ergänzung vom 2. Mai 1996 (Amtlicher Anzeiger 1995 Seite 1641, 1996 Seite 1185) eingeleitet. Im Rahmen dieser Ergänzung wurde das Plangebiet als Ergebnis der zwi- schenbehördlichen Abstimmung vor der öffentlichen Auslegung um Flächen westlich des Rahlstedter Weges, östlich des Kupferdammes erweitert, um in diesem Bereich die äu- ßere Erschließung sicherzustellen, sowie für den Bereich westlich der Straße Am Lehmberg (Flurstücke 5580, 123, 122, 121 und 3709 der Gemarkung Altrahlstedt) auf- gehoben, weil planerisch keine Veränderungen des Bestandes vorgesehen sind. Die Bürgerbeteiligung mit öffentlicher Unterrichtung und Erörterung und die öffentliche Aus- legung des Plans haben nach den Bekanntmachungen vom 10. August 1995 und 2. Mai 1996 (Amtlicher Anzeiger 1995 Seite 1834, 1996 Seite 1129) stattgefunden. Nach der öffentlichen Auslegung wurde der Bebauungsplan in Einzelheiten geän- dert. Eine Beteiligung der von der Planänderung Betroffenen konnte auf der Grund- lage der bisher geltenden Vorschrift des § 3 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs ohne erneute öffentliche Auslegung vorgenommen werden. Zudem konnten einige Änderungen ohne erneute Beteiligung der Öffentlichkeit vorgenommen werden, da es sich hierbei nur um redaktionelle Änderungen handelt bzw.