Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
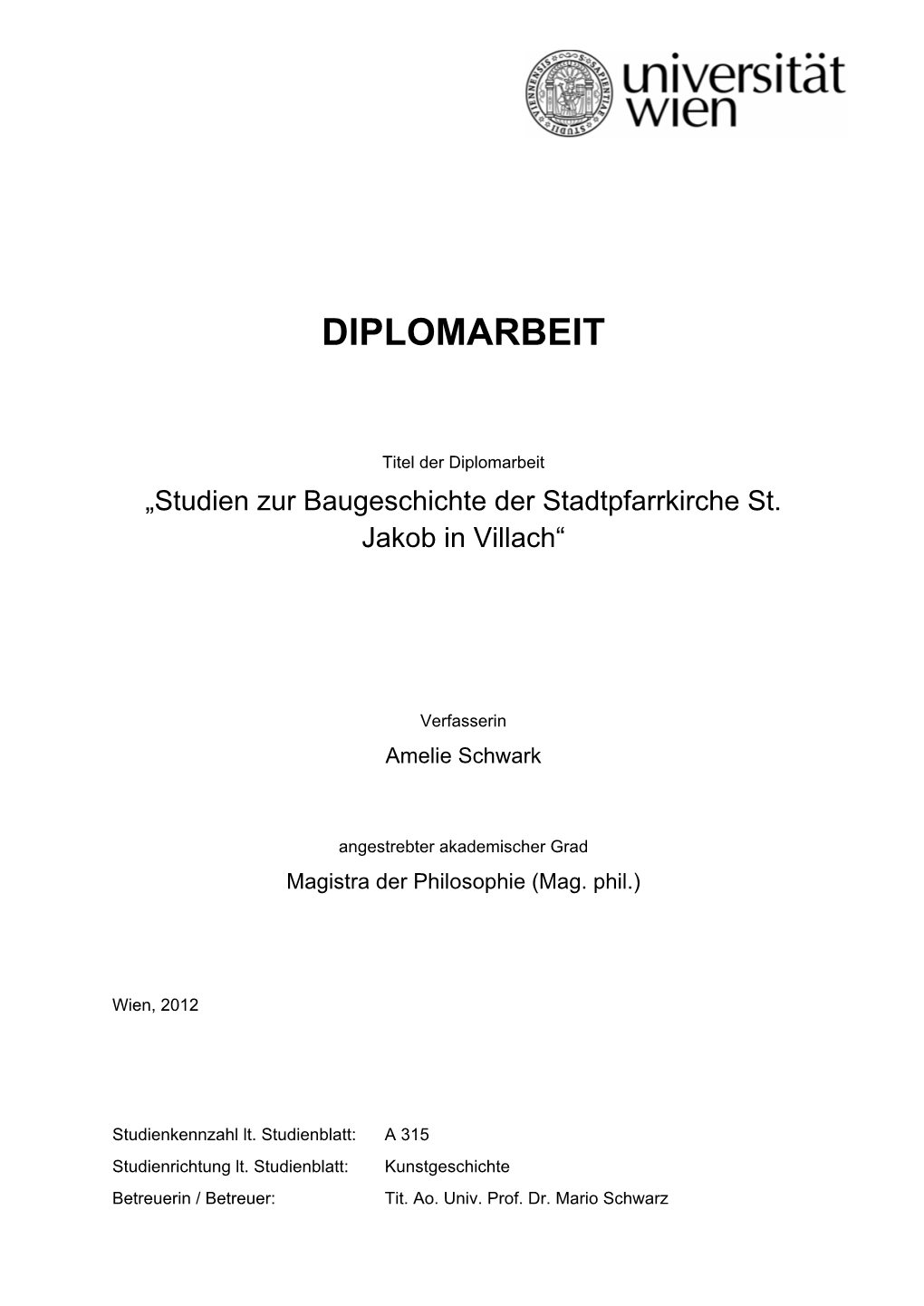
Load more
Recommended publications
-

Kulturbericht 2001 (Pdf)
KulturberichtKulturbericht desdes LandesLandes KärntenKärnten 20012001 Kulturbericht AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG · KULTURREFERENT LANDESHAUPTMANN DR. JÖRG HAIDER des Landes Kärnten 2001 KULTURBERICHT DES LANDES KÄRNTEN Inhaltsübersicht 4 Vorwort 6 Kärntner Kulturgremium: Aufbruch ins neue Jahrhundert 8 Verleihung der kulturellen Preise des Landes Förderungspreis für darstellende Kunst: Mag. Christian Jabornig Förderungspreis für bildende Kunst: Mag. Armin Guerino Förderungspreis für Literatur: Robert Woelfl Förderungspreis für Musik: Eduard Oraˇze Förderungspreis für Volkskultur: Dr. Hartmut Prasch Förderungspreis für Naturwissenschaften/Technische Wissenschaften: Dr. Werner Mussnig Förderungspreis für Geistes- und Sozialwissenschaften: Mag. Dr. Alexander Graf Würdigungspreis für Literatur: Josef Winkler Würdigungspreis für Geisteswissenschaften: Dr. Claudia Fräss-Ehrfeld Kulturpreis des Landes Kärnten: Mag. Reimo Wukounig 12 Stipendium für Musik im Jahr 2001 13 Stipendium für spartenübergreifende Kunstformen 14 Laudatio auf Gernot Kulterer 15 2001 – „Jahr der Volkskultur“ 24 „Schauplatz Mittelalter Friesach“: Eine erfolgreiche Zeitreise 32 Kultursommer in Kärnten 36 Seebühnenerfolg mit „Evita“ 37 Staatsopernballett „Wolfgang Amadé“ 38 galerie.kärnten 40 Landesgalerie 41 Kunstankäufe des Landes Kärnten ÜBERSICHT KULTURBERICHT DES LANDES KÄRNTEN 2001 42 Wissenschaft und Literatur 44 Kulturdenkmäler 47 Bruno Gironcoli 48 Landeskonservatorium – Gedanken über ein traditionelles Kunstinstitut 50 Musikschulwerk 52 Landesarchiv 54 Kulturerbe -

Kärnten Vielseitig | Pestra Koroška Carinzia VERSATILE | Carinthia DIVERSE
EDWIN STRANNER CHRISTIAN LEHNER KÄRNTEN VIELSEITIG | Pestra KORoška CARINZIA VERSATILE | CARINTHIA DIVERSE Edwin Stranner (Fotos | Fotografije | Foto | Images) Christian Lehner (Texte | Besedila | Testi | Texts) Kärnten vielseitig Pestra Koroška Carinzia versatile Carinthia diverse Titelbild | Slika na naslovni strani | Illustrazione di copertina | Cover picture: Pörtschach am Wörthersee | Poreče ob Vrbskem jezeru | Pörtschach am Wörthersee | Pörtschach am Wörthersee Dom zu Gurk | Bazilika v Krki | Duomo di Gurk | Gurk Cathedral Übersetzungen | Prevodi | Traduzioni | Translations: Schweickhardt Das Übersetzungsbüro, Klagenfurt/Celovec Lektorat | Urednik | Redazione | Editing: Susanne Gudowius-Zechner Grafik, Layout & Satz | Grafična priprava in prelom | Grafica, layout & impaginazione | Graphics, layout & typesetting: typedesign Grimschitz, Klagenfurt/Celovec Druck | Tisk | Stampa | Printing: BUCH THEISS GmbH, St. Stefan i. Lavanttal © Verlag Johannes Heyn, Klagenfurt/Celovec 2020 ISBN 978-3-7084-0638-1 Printed in Austria Inhalt | Kazalo | Contenuto | Content 6 Einleitung | Uvod | Introduzione | Introduction 9 Oberkärnten | Zgornja Koroška | Alta Carinzia | Upper Carinthia 64 Mittelkärnten | Srednja Koroška | Carinzia centrale | Central Carinthia 114 Zentralraum Kärnten | Osrednja Koroška | Area centrale della Carinzia | Carinthian central region 174 Unterkärnten | Spodnja Koroška | Bassa Carinzia | Lower Carinthia 228 Die Autoren | Avtorja | Gli autori | The authors Zentralraum Kärnten Osrednja Koroška Area centrale della Carinzia Carinthian -

Zur Biotopausstattung Des Kärntner Zentralraumes 479-486 Carinthia II N 206./126
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Carinthia II Jahr/Year: 2016 Band/Volume: 206_126 Autor(en)/Author(s): Kirchmeir Hanns, Jungmeier Michael, Köstl Tobias Artikel/Article: Zur Biotopausstattung des Kärntner Zentralraumes 479-486 Carinthia II n 206./126. Jahrgang n Seiten 479–486 n Klagenfurt 2016 479 Zur Biotopausstattung des Kärntner Zentralraumes Von Hanns KIRCHMEIR, Michael JUNGMEIER & Tobias KÖSTL Zusammenfassung Schlüsselwörter In den Jahren 2009 bis 2013 wurde für die 40 Gemeinden der Bezirke Klagenfurt, Vegetation, Bio top- Klagenfurt-Land, Villach und Villach Land ein Biotopkataster nach den Richtlinien der erfassung, Natur- Kärntner Landesregierung erstellt. Damit kann erstmals ein vollständiges Bild der schutz, Kärnten, Biotopausstattung der offenen Kulturlandschaften des Zentralraumes gezeichnet Österreich werden. Insgesamt sind 25.324 Biotope mit einer Gesamtfläche von 18.500 ha erfasst und im Kärnten Atlas verfügbar gemacht. Der hohe Anteil schützenswerter Flächen Keywords stellt in Anbetracht der hohen Entwicklungsdynamik des Zentralraumes eine beson- Vegetation, biotop dere naturschutzfachliche Herausforderung dar. Als erster Schritt soll die Auswer- mapping, nature tung der Datensätze vorgenommen werden. conservation, Carinthia, Austria Abstract During the years 2009 to 2013 a habitat register referring to the standards of the Government of Carinthia was elaborated for 40 municipalities of the districts Klagen- furt, Klagenfurt Land, Villach und Villach Land. For the first time this allows for drawing a comprehensive picture on the distribution of habitats in the open landscapes of the Carinthian central region (“Zentralraum”). All in all, 25.324 habitats with an overall acreage of 18.500 ha were mapped and made available in the digital atlas of Carinthia. -

Gemeindezeitung Mai 2020
Amtliche Mitteilung • Zugestellt durch Post at MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE Stockenboi 41. Jahrgang, Mai 2020, Folge 122 • www.stockenboi.at • E-Mail: [email protected] Mitteilungsblatt der Gemeinde Stockenboi 1 Aus der Gemeindestube Liebe Stockenboierinnen, liebe Stockenboier! „Corona-Pan- wahrscheinlich eine Notwendigkeit, hat punkt rücken. Dahingehend richtet sich demie“ – seit dieses Thema inzwischen aber eine neue auch meine Bitte: Nehmt auch weiterhin nunmehr Mitte Dimension angenommen. bewusst Verantwortung auf euch! März haben wir Die „Vorteile“ des Herunterfahrens fast Unsere Gemeinde ist bis dato frei von tagtäglich dieses aller unserer Lebensbereiche erweisen Coronafällen. An dieser Stelle danke ich Wort vor Augen. sich nun als teuer erkauft. Neben hoher allen, die durch Verzicht und Disziplin Wir werden mit Arbeitslosigkeit und sozialer Isolation ist die Maßnahmen mitgetragen haben. Erkenntnissen der Schaden für die Wirtschaft enorm. und Standpunk Mein Dank gilt auch allen, die in diesen Ja, Gesundheit ist ein hohes Gut – unser Tagen dafür sorgen, dass die lebensnot ten konfrontiert, höchstes. Das gilt es zu fördern, zu schüt die unterschiedlicher nicht sein könnten. wendigen Leistungen für uns alle er zen und zu erhalten. Doch wir müssen bracht werden. Dazu kommt eine Fülle an neuen, teil uns auch die Frage stellen: Welchen Preis weise mangelhaften Gesetzen, Erlässen, sind wir dafür bereit zu zahlen? Finanziell wie auch personell gut aufge Verordnungen und Vorgaben. stellt wird unsere Gemeinde aus heutiger Das Virus wird uns – vermutlich – auch Sicht – trotz der derzeit herrschenden Wie gefährlich das CoronaVirus tat in Zukunft erhalten bleiben, wenigstens widrigen Verhältnisse – in der Lage sein, sächlich ist, auch darüber scheiden sich aber noch lange Zeit begleiten. -

Katalog Weg Des Buches 2017 PDF 6 MB
UNTERWEGS AM WAHRSCHEINLICH SCHÖNSTEN PILGERWEG EUROPAS Auf den Spuren der Bibelschmuggler in Österreich Neue Weg des Buches Routen in Deutschland, Slowenien und Italien Wanderangebote für Gruppen und Individualisten Unterwegs am Weg des Buches und auf anderen Glaubens- und Pilgerwegen Was Sie beachten sollen: Alle unsere Wandertouren erfordern eine mittlere Kondition. Unsere ausgebildeten Wanderführer nehmen grundsätzliche Rücksicht auf die Schwächsten der Gruppe – trotzdem wird eine gewisse Vorbereitung vorausgesetzt. Die Übernachtungen erfolgen teilweise in bewirtschafteten Berghütten in Zimmerlagern, meist aber in Gasthöfen und Pensionen. Bei einzelnen Etappen haben wir für Sie auch eine entspannende Hotelnächtigung vorreserviert, indem Sie sich bei Spa & Wellness erholen können. Achten Sie auf eine entsprechende Ausrüstung (Regenschutz, festes Schuhwerk, Erste-Hil- fe-Set). Eine Versicherung für Freizeitunfälle, wie sie der Alpenverein oder die Naturfreunde anbieten, ist Voraussetzung für jede Unternehmung. Das können wir Ihnen bei Ihrer Buchung ebenfalls gerne anbieten. Die innere Einstellung: Wenn Sie sich auf einen Pilger- oder Glaubensweg machen, dann sind die Erwartungen meist größer, als bei einer üblichen Wanderung. Grundsätzlich geht es auch ihren Gefährten/Innen so. Je mehr Sie sich öffnen und je mehr Sie Vorbehalte hinter sich lassen, umso mehr wird die Unternehmung für Sie ein Gewinn für Körper und Seele werden. Und dabei sei auch noch gesagt, dass eine Pilgertour kein Erholungsaufenthalt ist, denn die Belastungen sind höher als das, was Sie zumeist gewohnt sind. Aber das ist gut so, denn erst wenn der Körper neue Impulse erhält, wird auch der Geist freier. Sie werden sich selber kennenlernen und auch ihren Weggefährten, woraus bereichernde Kontakte ent- stehen können. Stellen Sie nicht zu große Erwartungen an die Unterkunft in den Etappenorten, denn Sie sind hier zumeist nur eine Nacht. -
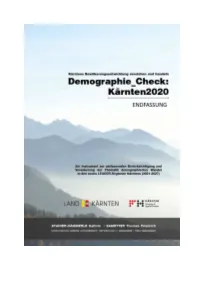
Demographie Check:Kärnten 2020 Endbericht
Demographie_Check: Kärnten 2020 Villach, Juni 2021 Im Auftrag des Landes Kärnten Abteilung 10 – Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum Mag. Christian Kropfitsch Dr. Kurt Rakobitsch Unterabteilungsleiter Sachgebietsleiter Leitung UA Orts- und Regionalentwicklung Landesstelle LEADER Kärnten Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum Ländlicher Raum Tel.: 050 536-11071 Tel.: 050 536-11073 Mail: [email protected] Mail: [email protected] Autor*in Fachhochschule Kärnten – Studienbereich Wirtschaft und Management – Public Management FH-Prof.in MMag.a Dr.in Kathrin Stainer-Hämmerle Mag. Dr. Thomas Friedrich Zametter FH-Professorin für Politikwissenschaft Senior Researcher/Lecturer Leitung BA und MA Public Management Public Management FH-Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung FH-Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung Tel.: 05 90500-2416 Tel.: 05 90500-2459 Mail: [email protected] Mail: [email protected] Kartenmaterial 1 Mag. Birgit Doiber Sachbearbeiterin Regionalentwicklung und GIS Programmmanagement und Projektkoordination Landesstelle LEADER Kärnten Abteilung 10 - Land- und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum Tel.: 050 536-11077 Mail: [email protected] Datenlieferung und unterstützende Informationen Mag. Dr. Angelika Sternath, MSc Dipl.-Ing. Thomas Graf, Bakk. Sozialstatistik Wirtschaftsstatistik Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 1 - Amt der Kärntner Landesregierung Landesamtsdirektion Abteilung 1 - Landesamtsdirektion Landesstelle -

(EEC) No 2052/88
4 . 3 . 95 I EN Official Journal of the European Communities No L 49/65 COMMISSION DECISION of 17 February 1995 establishing, for the period 1995 to 1999 in Austria and Finland , the list of rural areas under Objective 5b as defined by Council Regulation ( EEC) No 2052/88 (Text with EEA relevance) (95/37/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, (EEC) No 2052/88 ; whereas they have been identified as the areas suffering from the most severe rural develop Having regard to the Treaty establishing the European Community, ment problems ; Having regard to Council Regulation (EEC) No 2052/88 Whereas the measures provided for in this Decision are in of 24 June 1988 on the tasks of the Structural Funds and accordance with the opinion of the Committee on Agri their effectiveness and the coordination of their activities cultural Structures and Rural Development, between themselves and with the operations of the Euro pean Investment Bank and the other existing financial HAS ADOPTED THIS DECISION : instruments ('), as last amended by Regulation (EC) No 3193/94 (2), and in particular Article 11a (3) thereof, Article 1 Whereas in accordance with Article 11a (3) of Regulation (EEC) No 2052/88 , the new Member States concerned For the period 1995 to 1999 in Austria and Finland, the have proposed to the Commission the list of areas which rural areas eligible under Objective 5b as defined by they consider should be eligible under Objective 5b and Regulation (EEC) No 2052/88 shall be those listed in the have provided the Commission with all the information Annex hereto. -

Verteilung "Selbsttests" Für Betriebe
Dienststelle Adresse Zugeteilte Betriebe aus den Gemeinden Straßenbaumt Klagenfurt Josef Sablatnig Straße 245 Klagenfurt am Wörthersee 9020 Klagenfurt Krumpendorf am Wörthersee Maria Wörth Moosburg Poggersdorf Pörtschach am Wörther See Techelsberg am Wörther See Straßenmeisterei Rosental Klagenfurter Straße 41 Feistritz im Rosental 9170 Ferlach Ferlach Keutschach am See Köttmannsdorf Ludmannsdorf Maria Rain Rosegg Schiefling am Wörthersee St. Jakob im Rosental St. Margareten im Rosental Zell Straßenmeisterei Eberstein Klagenfurter Straße 7-9 Brückl 9372 Eberstein Eberstein Klein St. Paul Straßburg Weitensfeld im Gurktal Straßenmeisterei St. Ruprechter Straße 20 Albeck Feldkirchen 9560 Feldkirchen Feldkirchen in Kärnten Glanegg Gnesau Himmelberg Ossiach Reichenau St.Urban Steindorf am Ossiacher See Steuerberg Straßenmeisterei Friesach Industriestraße 44 Althofen 9360 Friesach Friesach Glödnitz Gurk Guttaring Hüttenberg Kappel am Krappfeld Metnitz Micheldorf Straßenmeisterei Klagenfurter Straße 51a Deutsch-Griffen St.Veit/Glan 9300 St.Veit/Glan Frauenstein Liebenfels Magdalensberg Maria Saal Mölbling St. Georgen am Längsee St.Veit an der Glan Straßenbauamt Villach Werthenaustraße 26 Arnoldstein 9500 Villach Arriach Feistritz an der Gail Finkenstein am Faaker See Hohenthurn Treffen am Ossiacher See Velden am Wörther See Villach Wernberg Straßenmeisterei Dueler Straße 88 Afritz am See Feistritz/Drau 9710 Feistritz/Drau Bad Bleiberg Feld am See Ferndorf Fresach Nötsch im Gailtal Paternion Stockenboi Weissenstein Straßenmeisterei Hermagor Egger -

Bürgerinformation Ein Service Der Gemeinde Wernberg
Wernberg Bürgerinformation Ein Service der Gemeinde Wernberg www.wernberg.gv.at Amtliche Mitteilung | An einen Haushalt | Zugestellt durch Post.at Amtliche Mitteilung | An einen Haushalt | Zugestellt durch Post.at 1 19Wernberg_30sept_2016.indd 1 30.09.2016 12:39:03 19Wernberg_30sept_2016.indd 1 30.09.2016 12:39:03 Sehenswürdigkeiten Ruine Eichelberg / Aichelberg Die Burg Eichelberg (auch Aichelberg) wurde um 1200 von den Rittern von Aichelberg errichtet. Sie gehörte zu einer Rei- he von Burgen, die alle auf besonderen Felsen erbaut waren. Die Burgherren konnten sich durch Leuchtfeuer verständigen und so aufeinander abstimmen. Um etwa 1500 kam es durch die anstürmenden Ungarn unter König Matthias Corvinus zur Zerstörung der Burg Eichelberg. Die Besitzerfamilie Khevenhüller erhielt die Erlaubnis um 1511 eine Befestigungsanlage statt der zerstörten Burg in Damt- schach zu bauen. Eichelberg ist somit schon seit 500 Jahren eine Ruine und dem Verfall überlassen. Um dem endgültigen Verfall entgegenzuwirken, finden ab 2016 umfassende Sanierungs- & Erhaltungsmaßnahmen an der Burgruine Eichelberg statt. Gerichtsstein Wernberg www.burgen-austria.com/archive.php?id=1292 Das sogenannte „Wern- www.wehrbauten.at berger Kreuz“ westlich des Gasthauses Fruhmann stammt aus dem 16. Jahr- hundert und trägt die Jah- reszahlen 1578 und 1767 im Kreuz. Am Pfeilerschaft sind die Wappen der Äbte von Ossiach und der Fa- milie Khevenhüller ange- bracht. Der Gerichtsstein ist aus grobkristallinem weißem Marmor (vermut- lich Krastaler Marmor) ge- fertigt und zeigt -

Frohe Weihnachten
Amtliche Mitteilung • Zugestellt durch Post.at MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE Stockenboi 36. Jahrgang, Dezember 2015, Folge 109 • www.stockenboi.at • E-Mail: [email protected] Frohe Weihnachten und viel Glück, Gesundheit und Erfolg im Jahr 2016 …wünschen allen GemeindebürgerInnen und Gästen die Gemeindevertretung und die Gemeindebediensteten! Mitteilungsblatt der Gemeinde Stockenboi 1 Liebe Stockenboierinnen, liebe Stockenboier! „Zukunft stellt sich ein, wo immer Abschied genommen wird.“ An diesem Satz ist viel Wahres dran, nicht nur zu Weihnachten. Ja, liebe Stockenboierinnen und Stockenboier, Weihnachten und der Jahreswechsel rücken näher – wieder sind wir auf der Zielgeraden in ein neues Jahr. Jetzt heißt es: Tief Luft holen und tatsächlich anhalten, den Kopf frei bekommen und wohlwollend auf das alte Jahr zurückschauen. Es hat einen guten Abschied verdient. Wenn ich – der Tradition entsprechend – an dieser Stelle kurz zurückschaue, dann ist das nichts anderes als ein Spiegel dessen, was sich im Lauf des zurückliegenden Jahres in unserer Gemeinde getan hat. Ein Rück- blick wäre aber unvollständig, wenn es nicht auch einen kurzen Ausblick gäbe. Der sparsame Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sowie das „richtige Händchen“ bei der Verbesserung der Einnahmenseite haben uns geholfen, dass wir positiv bilanzieren können. Die finanzielle Englage machte es aber notwendig, ein sehr fein abgestimmtes Gewichten von Prioritäten vorzunehmen. Nicht alles, was wir geplant haben, ist deshalb schon zur Tat geworden. So ist die Rückschau auf das Jahr 2015 für uns gleichzeitig ein Arbeitsauftrag für das Jahr 2016: Zahlreiche Projekte und Maßnahmen, die im vergangenen Jahr „geboren“ wurden, treten erst in die Phase der Umsetzung ein. Nicht aus den Augen lassen werden wir auch weiterhin die Maßnahmen, wie die Wildbachverbauung, die die Sicherheit der Menschen in unserem Gemeindegebiet gewährleisten. -

Erläuterungen 200 Arnoldstein
GEOLOGISCHE KARTE DER REPUBLIK ÖSTERREICH 1 : 50.000 ERLÄUTERUNGEN zu Blatt 200 ARNOLDSTEIN zusammengestellt von CHRISTOPH HAUSER mit Beiträgen von NIKOLAUS ANDERLE, CHRISTOPH HAUSER, HERBERT HEINZ, BENNO PLÖCHINGER, MANFRED E. SCHMID und HANS PETER SCHÖNLAUB Mit 13 Abbildungen ra Wien 1982 Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Geologische Bundesanstalt, A-1031 Wien, Rasumofskygasse 23 Anschriften der Verfasser: Dr. NIKOLAUS ANDERLE, Weilburgstraße 18/7/7, A-2500 Baden; Dr. CHRISTOPH HAUSER, Dr. HERBERT HEINZ, Prof. Dr. BENNO PLÖCHINGER, Dr. MANFRED E. SCHMID und Univ.-Doz. Dr. HANS PETER SCHÖNLAUB, Geologische Bundesanstalt, Rasumofskygasse 23, A-1031 Wien. Alle Rechte vorbehalten ISBN 3-900312-18-4 Redaktion: ALOIS MATURA Satz: Geologische Bundesanstalt Druck: Ferdinand Berger & Söhne Gesellschaft m.b.H., 3580 Horn Blatt 200 Arnoldstein und seine Nachbarblätter mit Stand der Bearbeitung (März 1982) Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort (Ch. HAUSER) 3 1. Geographische Übersicht (Ch. HAUSER) 3 2. Erforschungsgeschichte (Ch. HAUSER) 4 3. Geologischer Überblick (Ch. HAUSER) 5 4. Altkristallin des Mirnock- und Wollanig-Gebietes (B. PLÖCHINGER) ... 6 4.1. Gesteinsarten 6 4.2. Tektonik 11 5. Altkristallin und Paläozoikum der Goldeckgruppe (H. HEINZ) 12 6. Drauzug - Permotrias (Ch. HAUSER) 13 6.1. Schichtfolge 13 6.2. Tektonik 21 7. Karbon von Nötsch (H. P. SCHÖNLAUB) 24 8. Gailtaler Kristallin (H. P. SCHÖNLAUB) 26 9. Paläozoikum der Karnischen Alpen und der Karawanken (H. P. SCHÖNLAUB) 26 9.1. Schichtfolge . 26 9.2. Tektonik 31 10. Eruptiva der Karnischen Alpen und der Westkarawanken (N. ANDERLE) 32 11. Südalpine/Dinarische Trias der östlichen Kamischen Alpen und der Westkarawanken (Ch. HAUSER) 33 12. Tertiär - Rosenbacher Kohlenschichten (N. ANDERLE & M. -
Gemeindezeitung Dezember 2020
Amtliche Mitteilung • Zugestellt durch Post.at MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE Stockenboi 41. Jahrgang, Dezember 2020, Folge 124 • www.stockenboi.at • E-Mail: [email protected] Frohe Weihnachten und viel Glück, Gesundheit und Erfolg im Jahr 2021 …wünschen allen GemeindebürgerInnen und Gästen die Gemeindevertretung und die Gemeindebediensteten! Mitteilungsblatt der Gemeinde Stockenboi 1 Liebe Stockenboierinnen, liebe Stockenboier! ia die Zeit sich so geht, Gegenwart und Zukunft mitzugestalten. Die „Pflege“ schnell vaziacht…“ – unserer Heimatgemeinde richtet sich an alle und bean- so steht es in einem der sprucht großen persönlichen Einsatz. Sie dient nicht nur schönsten Kärntnerlieder von den Menschen jetzt, sondern auch den künftigen Gene- Gretl Komposch, dem „Radl rationen. der Zeit“, zu lesen. Das sind Ich danke allen, die das kümmert. Mein besonderer Dank Worte, die ich an dieser Stelle gilt dem Gemeinderat, den Mitarbeiterinnen und Mit- gerne aufgreife. arbeitern in der Verwaltung, im handwerklichen Dienst Ja, liebe Stockenboierinnen, und der Wirtschaft, den Vereinen und allen ehrenamtlich liebe Stockenboier, Advent- Tätigen. und Weihnachtszeit kündigen sich wieder an und bald macht auch das alte Jahr dem Liebe Stockenboierinnen, liebe Stockenboier! neuen Platz. Einmal mehr stellen wir uns jetzt die Frage: „Wenn ihr euch lasst mit Ämtern schmücken, „War es ein gutes Jahr?“ so klaget nicht, dass sie euch drücken.“ Der Jahreswechsel ist immer Anlass, Bilanz zu ziehen und Ja, es ist sicherlich kein leichtes Amt, das ich mit dem des einen Blick nach vorne zu wagen. Das gilt auch für unsere Bürgermeisters übernommen habe. Mein Wunsch war, Arbeit im Gemeinderat. mich um das Wohl meiner Heimatgemeinde zu küm- • Wie unberechenbar Unwetter sind, wurde uns heuer mern, sie zu gestalten und Einfluss auf ihre Entwicklung wie auch im vorigen Jahr einmal mehr drastisch vor zu nehmen.