„Erinnern!“ 1 | 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Visual Arts in the Urban Environment in the German Democratic Republic: Formal, Theoretical and Functional Change, 1949–1980
Visual arts in the urban environment in the German Democratic Republic: formal, theoretical and functional change, 1949–1980 Jessica Jenkins Submitted: January 2014 This text represents the submission for the degree of Doctor of Philosophy (in partial fulfilment of its requirements) at the Royal College of Art Copyright Statement This text represents the submission for the degree of Doctor of Philosophy at the Royal College of Art. This copy has been supplied for the purpose of research for private study, on the understanding that it is copyright material, and that no quotation from this thesis may be published without proper acknowledgment. Author’s Declaration 1. During the period of registered study in which this thesis was prepared the author has not been registered for any other academic award or qualification. 2. The material included in this thesis has not been submitted wholly or in part for any academic award or qualification other than that for which it is now submitted. Acknowledgements I would like to thank the very many people and institutions who have supported me in this research. Firstly, thanks are due to my supervisors, Professor David Crowley and Professor Jeremy Aynsley at the Royal College of Art, for their expert guidance, moral support, and inspiration as incredibly knowledgeable and imaginative design historians. Without a generous AHRC doctoral award and an RCA bursary I would not have been been able to contemplate a project of this scope. Similarly, awards from the German History Society, the Design History Society, the German Historical Institute in Washington and the German Academic Exchange Service in London, as well as additional small bursaries from the AHRC have enabled me to extend my research both in time and geography. -
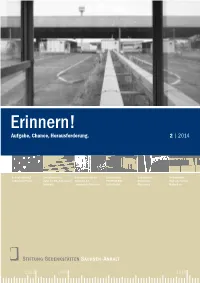
„Erinnern!“ 2 | 2014
Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin Prettiner Landstraße 4 | 06925 Annaburg, OT Prettin | phone (035386) 60 99 75 | fax (035386) 60 99 77 mail: [email protected] | Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 15.30 Uhr Freitag 9 bis 13 Uhr | jeder letzte Sonntag im Monat 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg c/o Fachklinikum für Psychiatrie Bernburg | Olga-Benario-Str. 16/18 | 06406 Bernburg phone (03471) 31 98 16 | fax (03471) 64 09 691 | mail: [email protected] Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr | Freitag 9 bis 12 Uhr jeder erste Sonntag im Monat 11 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte für die Opfer des KZ Langenstein-Zwieberge Vor den Zwiebergen 1 | 38895 Halberstadt, OT Langenstein | phone (03941) 56 73 24 | phone/fax (03941) 30 248 mail: [email protected] | Öffnungszeiten (Dauerausstellung): Dienstag bis Freitag 9 bis 15.30 Uhr | jedes letzte Wochenende (Samstag und Sonntag) in den Monaten April bis Oktober 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale) Am Kirchtor 20 b | 06108 Halle | phone (0345) 22 01 337 | fax (0345) 22 01 339 mail: [email protected] | Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr jedes erste Wochenende im Monat (Samstag und Sonntag) 10 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg Umfassungsstraße 76 | 39124 Magdeburg | phone (0391) 24 45 590 | fax (0391) 24 45 599 9 mail: [email protected] | Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 9 bis 16 Uhr Donnerstag: 9 bis 18 Uhr | Freitag 9 bis 14 Uhr | jeder erste Sonntag im Monat 10 bis 16 Uhr Erinnern! sowie nach Vereinbarung Aufgabe, Chance, Herausforderung. -

Bibliotheksbestand LAMV Stand 16.01.2020.Xlsx
Verfasser Titel Untertitel Ort Jahr Signatur Kernkraft in der DDR: Zwischen nationaler Industriepolitik und sozialistischer Zusammenarbeit Kernenergieentwicklung in der DDR. Atomkraftwerke und Widerstand gegen Atomkraft in Abele, Johannes 1963-1990 der DDR. Dresden 2000 Ge-199/26 Politischer Umbruch und Neubeginn in Wismar von Politischer Umbruch in der DDR und in Wismar 1989.Vorgeschichte 1985-1989. Profilierung Abrokat, Sven 1989 bis 1990: der politischen Parteien.+ Dokumente Hamburg 1997 Ge-403 Ackermann, Anton An die lernende und suchende deutsche Jugend: Berlin; Leipzig 1946 DDR-212 Die Jenaer Schulen im Fokus der Staatssicherheit: Eine Abhandlung zur Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR-Schulwesen. Führungs-IM -System in Jena. Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ackermann, Jens P. DDR Ministerium für Staatssicherheit. Weimar 2005 Ge-1021 Christliche Frauen in der DDR: Alltagsdokumente Ackermann, Sonja einer Diktatur in Interviews Studie zur Situation christlicher Frauen in der DDR. 97 Interviews. Leipzig 2005 Ge-1024 A.S. Makarenko- Erzieher im Dienste der Bad Adolphes, Lotte Revolution: Versuch einer Interpretation Eine Makarenko-Studie. Godesberg 1962 Ge-1009 Agsten, Rudolf; Bogisch, LDPD auf dem Weg in die DDR: Zur Geschichte der Manfred LDPD in den Jahren 1946-1949 Berlin 1974 DDR-0001 Feiertage der DDR - Feiern in der DDR. Zwischen Ahbe, Thomas Umerziehung und Eigensinn Feiertage in der DDR. Ritale und Botschaften. Jugendweihe. Erfurt 2017 Ge-1744 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. Entstehung der Ostalgie nach 1990 und ihre Ursachen. Erfurt 2016 Ge-1668 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. -

Der 17. Juni 1953, Der Anfang Vom Ende Des Sowjetischen Imperiums
DER 17. JUNI 1953 DER ANFANG VOM ENDE DES SOWJETISCHEN IMPERIUMS DEUTSCHE TEIL-VERGANGENHEITEN - AUFARBEITUNG WEST: DIE INNERDEUTSCHEN BEZIEHUNGEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE ENTWICKLUNG IN DER DDR DOKUMENTATION 4. BAUTZEN-FORUM DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 17. BIS 18. JUNI 1993 INHALTSVERZEICHNIS 5 Vorwort 75 Waleri Alexandrowitsch Wolin Rußland rehabilitiert die durch sowjetische 7 Dr. Joachim Kahlert Militärtribunale unschuldig Verurteilten Auf dem langen Weg zur Einheit die Orientie- rung verloren? 89 Prof. Dr. Jens Hacker Einsichten und Ansichten zur Deutschlandpolitik Die CDU - Vom Alleinvertretungsanspruch zur De-facto-Anerkennung der vormals 21 Winfried Schneider-Deters sogenannten DDR Begrüßung und Einführung 107 Dr. Johannes L. Kuppe 27 Heinder Sandig Die Deutschlandpolitik der SPD -Von der Politik Grußwort des Vizepräsidenten des der deutschen Einheit zur Politik des Status quo Sächsischen Landtages der deutschen Teilung 31 Dr. Karl-Heinz Kunckel 121 Ulrich Schacht Grußwort des Vorsitzenden der sozialdemokra- Der SED-Staat und seine intellektuellen tischen Fraktion im Sächsischen Landtag Kollaborateure in Westdeutschland 35 Karl Wilhelm Fricke 133 Dr. Hans-Hermann Hertle Der 17. Juni 1953 - Der erste Arbeiteraufstand Die Deutschlandpolitik des DGB in den 70er und gegen die kommunistische Diktatur im 80er Jahren - ost-westdeutscher Schulterschluß sowjetischen Imperium im „Kampf gegen das Kapital"? 45 Dr. Bernd Faulenbach 145 Podiumsdiskussion des Bautzen-Komitees Der 17. Juni im westdeutschen Bewußtsein 149 „Stasi-Poeme" - Gedichte aus DDR-Gefängnissen 55 Dr. Falco Werkentin von Dr. Wilhelm Koch Die strafrechtliche „Bewältigung" des 17. Juni 1953 in der DDR 153 Gedenkveranstaltung am Gedenkstein für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in 63 Dr. Armin Mitter den Bautzner Gefängnissen „... Gegen das Volk regieren" - Der Ausbau des Disziplinierungsapparates nach dem 157 Referenten und Teilnehmer an den 17. -

Zaglada8 KSIAZKA.Indb
Wendy Lower Sprawcy i sprawczynie Zagłady a podejście do sprawiedliwości w NRD w latach 1949–19631 Na podstawie świeżo udostępnionej dokumentacji tajnej policji i sądów oraz innych dokumentów z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) w ni- niejszym studium przeanalizowano przebieg dwóch mniej znanych procesów na- zistowskich sprawców Zagłady na terenie Galicji. Bohaterem pierwszego z nich był typowy niemiecki żandarm, uznany za winnego, lecz zwolniony z więzienia w la- tach pięćdziesiątych XX w.; drugi natomiast dotyczył małżeństwa, które w gospo- darstwie rolnym SS dopuściło się zabójstw Żydów i przedstawicieli innych narodo- wości. Oba przypadki uwydatniają metody śledcze stosowane w NRD oraz sposób wykorzystania dowodów przez prokuratorów, a ten drugi pozwala przeanalizować kwestie płci w kontekście zbrodni wojennych i procesów powojennych. Na pod- stawie tych procesów autorka rozpatruje, w jaki sposób zmieniające się nastroje polityczne lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wpływały na dochodzenia, procesy sądowe, a także wyroki. Kiedy w listopadzie 1989 r. padał mur berliński, zwany przez mieszkańców Nie- miec Wschodnich „antyfaszystowskim wałem ochronnym”, pewna 69-letnia kobie- ta, Erna Petri, siedziała w swojej celi w osławionym więzieniu Hoheneck w Saksonii. Jej uwięzienie zbiegło się z budową muru w sierpniu 1961 r. i ze względu na to, że mur ten właśnie likwidowano, mogła żywić nadzieję na zwolnienie. W następnych miesiącach i latach prawnicy, głównie ci z byłych Niemiec Zachodnich, dokonywali 1 Artykuł ukazał się pierwotnie w języku angielskim w „Holocaust and Genocide Studies”, wiosna 2010, t. 24, nr 1, s. 56–84. Redakcja dziękuje autorce oraz wydawcy za udzielenie zgo- dy na tłumaczenie i przedruk. Jesteśmy też wdzięczni autorce za życzliwe odniesienie się do pytań, jakie zrodziły się w toku prac nad przekładem – przyp. -

Foresight Study Thematic Report IV Secondary Raw Materials (Including Mine Wastes)
Minerals4EU FP7-NMP.2013.4.1-3 Foresight Study Thematic Report IV Secondary Raw Materials (Including Mine Wastes) Compiled by: Dominic Wittmer, Henrike Sievers Contributing authors: Petr Rambousek, Tereza Jandová, Vít Štruple János Kiss and Zoltán Horváth Kerstin Kuhn, Andreas Kamradt, Philipp Büttner Daniel de Oliveira, Lídia Quenta, Catarina Lopes Henning Wilts, Luis Tercero Espinoza, Dominic Wittmer 1 WP6 – Foresight Study Minerals4EU FP7-NMP.2013.4.1-3 Preliminary note This thematic report has been developed within the Minerals4EU project in the context of the first Foresight Study report (WP6) that comprises a central report and five thematic reports. These contributions were designed according to a well-defined structure to fit the purposes of the central Foresight Study report. The scope and targets of the first Foresight Study significantly determine the nature of the documents and may not be suited for unspecified or differing purposes. The topics of the five thematic reports containing topic papers and case studies are: I. European raw material potential II. Legislative and governmental controlled challenges with regard to European mineral raw materialdeposist III. Societal challenges of mineral raw material deposits accessibility IV. Secondary raw materials (including mine wastes) V. Developments on the raw material markets The following institutions contributed to WP6 in the Minerals4EU project: GTK (Geologian Tutkimuskeskus, Finland) BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Germany) CGS (Ceska Geologicka -

Bibliotheksbestand: September 2011
Bibliotheksbestand: September 2011 Verfasser Titel Untertitel ErschOrt Jahr Signatur Kernkraft in der DDR: Zwischen Kernenergieentwicklung in Abele, nationaler Industriepolitik und der DDR. Atomkraftwerke Dresden 2000 Ge-199/26 Johannes sozialistischer Zusammenarbeit 1963- und Widerstand gegen 1990 Atomkraft in der DDR. Politischer Umbruch in der DDR und in Wismar Politischer Umbruch und Neubeginn in 1989.Vorgeschichte 1985- Abrokat, Sven Hamburg 1997 Ge-403 Wismar von 1989 bis 1990: 1989. Profilierung der politischen Parteien.+ Dokumente Ackermann, ¬An die lernende und suchende Berlin; Leipzig 1946 DDR-212 Anton deutsche Jugend: ¬Die Jenaer Schulen im Fokus der DDR-Schulwesen. Führungs- Staatssicherheit: Eine Abhandlung zur IM -System in Jena. Ackermann, Mitarbeit von Lehrern und Schülern Mitarbeit von Lehrern und Weimar 2005 Ge-1021 Jens P. beim Ministerium für Staatssicherheit Schülern beim Ministerium der DDR für Staatssicherheit. Christliche Frauen in der DDR: Studie zur Situation Ackermann, Alltagsdokumente einer Diktatur in christlicher Frauen in der Leipzig 2005 Ge-1024 Sonja Interviews DDR. 97 Interviews. A.S. Makarenko- Erzieher im Dienste Adolphes, der Revolution: Versuch einer Eine Makarenko-Studie. Bad Godesberg 1962 Ge-1009 Lotte Interpretation Agsten, LDPD auf dem Weg in die DDR: Zur Rudolf; Geschichte der LDPD in den Jahren Berlin 1974 DDR-0001 Bogisch, 1946-1949 Manfred Umgang mit DDR- Vergangenheit in den 90er Jahren. Erfahrungen der Ostalgie: Zum Umgang mit der DDR- Ostdeutschen.Ostalgie. Ahbe, Thomas Erfurt 2005 Ge-1037 Vergangenheit in den 1990er Jahren Zwischenbilanz der Vereinigung: Ostdeutsche Gewinne und Verluste im Spiegel der Statistik. Analyse der Generationen der DDR und in Ahbe, Geschichte der Generationen in der Ostdeutschland. Gliederung Thomas; DDR und in Ostdeutschland: Ein in sechs Generationen und Erfurt 2007 Ge-1368 Gries, Rainer Panorama Darstellung ihres Wesens.+ zahlreiche Fotos+ Literaturverzeichnis. -

50 Jahre Streitfall Halle-Neustadt
Peer Pasternack u. a. 2014 jährt sich die Grundsteinlegung für Halle- Neustadt zum fünfzigsten Mal. 25 der bisherigen Jahre lagen in der DDR, weitere 25 im vereinigten 50 Jahre Streitfall Deutschland. Un umstritten war Halle- Neustadt von Beginn an nicht. Der in dustrielle Platten bau brach gründlich mit der Vorstellung von der ge- Halle-Neustadt wachsenen Stadt. Doch die Einwohner arrangierten sich. Halle-Neustadt war einst gebraucht worden Idee und Experiment. für 90.000 Menschen, und es wird heute gebraucht für 45.000. Peer Pasternack und 46 weitere Auto- Lebensort und Provokation ren liefern kontro verse Ansichten zu dieser größten Stadt, die nach 1945 im Osten Deutschland er - richtet worden war. Halle-Neustadt 50 Jahre Streitfall Streitfall Jahre 50 g a l r e v r e h c s t u e d l e t t i mitteldeutscher verlag m Peer Pasternack u.a. 50 Jahre Streitfall Halle-Neustadt Peer Pasternack 50 Jahre Streitfall Halle-Neustadt Idee und Experiment. Lebensort und Provokation Mit weiteren Mehrfachbeiträgen von Joachim Bach, Frank-Torsten Böger, Frank Eckardt, Udo Grashoff, Annette Harth, Wolfgang O. Kirchner, Jana Kirsch, Benjamin Köhler, Peter Laub, Elisabeth Merk, Udo Mittinger, Paul Rieth, Harald Roscher, Karlheinz Schlesier und Einzelbeiträgen von Lisa Albrecht-Dimitrowa, Tobias Bochmann, Sebastian Bonk, Gesa Dralle, Harald Engler, Benjamin Foerster-Baldenius, Christine Hannemann, Kathy Hannemann, Saskia Hebert, Antje Heuer, Sebastian Horn, Bernd Hunger, Wolfgang Hütt, Ingrid Kiesewetter, Florian Key, Wolfgang Kil, Susanne Knabe, Katja -

Social Democratic Responses to Antisemitism and The'judenfrage'in
Social Democratic Responses to Antisemitism and theJudenfrage in Imperial Germany: Franz Mehring (A Case Study) PhD Thesis Lars Fischer Hebrew and Jewish Studies Department University College London ProQuest Number: U642720 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest U642720 Published by ProQuest LLC(2015). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract This thesis examines German attitudes towards Jews in the late nineteenth and early twentieth century, focusing on a dimension of political discourse typically noted for its resistance to antisemitism: Social Democracy. Most scholarship on the dealings of Imperial German society with matters Jewish tends to focus specifically on self-defined antisémites and overt manifestations of antisemitism. In contrast, this study examines how a broader set of prevalent perceptions of (supposedly) Jewish phenomena was articulated by theoretically more sophisticated Social Democrats. Their polemics against antisémites frequently used the term 'antiSemitic' simply to identify their party-political affiliation without necessarily confronting their hostility to Jews, let alone did it imply a concomitant empathy for Jews. While the party-political opposition of Social Democracy against party-political antisemitism remains beyond doubt, a genuine anathematization of anti- Jewish stereotypes was never on the agenda and the ambiguous stance of Franz Mehring (1846- 1919) was in fact quite typical of attitudes prevalent in the party. -

Peter Lang Zeitschrift Für Germanistik, Neue Folge Zfg 2020-1.Inddallpages D Und Fragen Auszublenden
Peter Lang Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge ( ) Mark-Georg Dehrmann • Friederike Felicitas Günther (Hrsg.) Brockes-Lektüren. Ästhetik – Religion – Politik Bern, 2020. 326 S., 6 s/w Abb., 2 farb. Abb. Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik. Bd. 32 Herausgegeben von der Philosophischen Fakultät II / 1/2020 Institut für deutsche Literatur der Humboldt-Universität zu Berlin • br. ISBN 978-3-0343-3682-6 CHF 103.– / €D 89.95 / €A 91.50 / € 83.20 / £ 68.– / US-$ 100.95 XXX eBook ISBN 978-3-0343-3923-0 • CHF 103.– / €D 98.95 / €A 99.80 / € 83.20 / £ 68.– / US-$ 100.95 €D inkl. MWSt. – gültig für Deutschland und Kunden in der EU ohne USt-IdNr· €A inkl.MWSt. – gültig für Österreich as Werk des Hamburger Ratsherrn Barthold Heinrich Brockes hat in der Forschung einige D wirkungsmächtige Deutungen erfahren. Sie betonen seinen Stellenwert als wichtigen Dich- Zeitschrift für ter der Frühaufklärung. Gleichzeitig neigen sie dazu, sein umfangreiches Werk jeweils im Licht Neue Folge Neue Folge bestimmter Traditionslinien zu erschließen, dabei aber andere, ebenso zentrale Traditionslinien • und Fragen auszublenden. Der Band möchte gegenüber solchen übergreifenden Einordnungen einen Schritt zurücktre- ten. Die Beiträge versuchen, sich stärker in die außerordentliche Komplexität der Texte und auch der Paratexte der Originaldrucke einzulassen. Sie rekonstruieren deren politische und kulturel- le Kontexte, zeichnen detailliert poetische und rhetorische Verfahren einzelner Gedichte nach, folgen ihren Gattungsreferenzen und den Lektüremodi, die sie vorführen und einüben wollen. GERMANISTIK Das Themenspektrum umfasst u. a. Poetik, Musik, Bildende Kunst, Politik, Diplomatie, Naturge- schichte, Medizin und Theologie. Inhalt: Kevin Hilliard: «Dieß Ungefehr ist nicht von ungefehr.» Theologie und Ästhetik der ‹spie- lenden Natur› bei Barthold Heinrich Brockes • Hans Graubner: Brockes’ Theologie der ästhetischen Erfahrung der Natur als «Kinderphysik» • Daniel Zimmer: Brockes als Hofdichter. -

Sammelrez: Der 17. Juni Der Berliner Republik
Hans Bentzien. Was geschah am 17. Juni?: Vorgeschichte - Verlauf - Hintergründe. Berlin: edition ost, 2003. 213 S. broschiert, ISBN 978-3-360-01042-1. Burghard Ciesla. Freiheit wollen wir!: Der 17. Juni 1953 in Brandenburg. Berlin: Christoph Links Verlag, 2003. 255 S. , broschiert, ISBN 978-3-86153-288-0. Torsten Diedrich. Waffen gegen das Volk: Der Aufstand vom 17. Juni 1953. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2003. 259 S. , gebunden, ISBN 978-3-486-56735-9. Torsten Diedrich, Hans Hermann Hertle. Alarmstufe "Hornisse": Die geheimen Chef-Berichte der Volkspolizei über den 17. Juni 1953. Berlin: Metropol Verlag, 2003. 464 S. , , ISBN 978-3-936411-27-0. H-Net Reviews Thomas Flemming. Kein Tag der deutschen Einheit: 17. Juni 1953. Berlin: be.bra Verlag, 2003. 168 S. EUR 19.00, broschiert, ISBN 978-3-89809-038-4. Jan Foitzik. Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa 1953-1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volksaufstand: Politische, militärische, soziale und nationale Dimension. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2001. 393 S. DM 98.00, gebunden, ISBN 978-3-506-72590-5. Karl W. Fricke, Roger Engelmann. Der "Tag X" und die Staatssicherheit: 17. Juni 1953. Reaktionen und Konsequenzen im DDR-Machtapparat. Bremen: Edition Temmen, 2003. 346 S. , gebunden, ISBN 978-3-86108-386-3. Martin Greschat, Jochen-Christoph Kaiser. Die Kirchen im Umfeld des 17. Juni 1953. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2003. 303 S. , broschiert, ISBN 978-3-17-018348-3. Christoph Kleßmann, Bernd Stöver. 1953 - Krisenjahr des Kalten Krieges in Europa. Köln: Böhlau Verlag, 1999. 246 S. , gebunden, ISBN 978-3-412-03799-4. 2 H-Net Reviews Hubertus Knabe. -

Freies Deutschland«
Rosa-Luxemburg-Stiftung Manuskripte 53 Rosa-Luxemburg-Stiftung GOTTFRIED HAMACHER unter Mitarbeit von André Lohmar, Herbert Mayer, Günter Wehner und Harald Wittstock Gegen Hitler. Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung »Freies Deutschland« Kurzbiografien Karl Dietz Verlag Berlin Gottfried Hamacher unter Mitarbeit von André Lohmar, Herbert Mayer, Günter Wehner und Harald Wittstock: Gegen Hitler. Deutsche in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung »Freies Deutschland«. Kurzbiografien (Reihe: Manuskripte/Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 53) Berlin: Dietz, 2005 ISBN 3-320-02941-X © Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2005 Satz: Jörn Schütrumpf 2., korr. Auflage Umschlag, Druck und Verarbeitung: MediaService GmbH BärenDruck und Werbung Printed in Germany Zum Geleit Wenn wir es nicht machen, wird es niemand tun – so lässt sich am besten die Haltung beschreiben, die den letzten Überlebenden, unterstützt von wenigen selbstlosen Enthusiasten, die Kraft verlieh, den Stoff, der dieses Buch aus- macht, zusammenzufügen. Den Frauen und Männern, die bis 1945 außerhalb Deutschlands gegen das alle Freiheit und Menschenwürde zermalmende deutsche NS-Regime – die brutalste, heimtückischste und aggressivste Spielart des Faschismus – kämpf- ten, ist in diesem Deutschland nur selten gedankt worden. Die meisten sind nicht nur vergessen, sondern wurden vorsätzlich vergessen gemacht. Die Differenz zwischen dem sich antifaschistisch verstehenden Deutsch- land in den Grenzen der DDR und der sich selbst als Fortführerin des Deut- schen Reiches deklarierenden Bundesrepublik wirkt noch immer fort. Dabei gab es Verdächtigungen, Verunglimpfungen, selbst Verfolgungen zu unter- schiedlichen Zeiten in beiden deutschen Staaten, wenn auch zumeist ge- gensätzlich politisch motiviert, für ehemalige Widerstandskämpfer, die auf »Feindesboden« gegen den Hitlerfaschismus gekämpft hatten.