Der 17. Juni 1953 in Halle (Saale)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
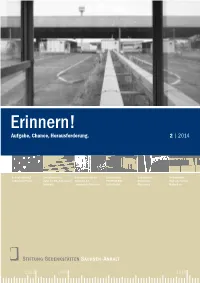
„Erinnern!“ 2 | 2014
Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin Prettiner Landstraße 4 | 06925 Annaburg, OT Prettin | phone (035386) 60 99 75 | fax (035386) 60 99 77 mail: [email protected] | Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 15.30 Uhr Freitag 9 bis 13 Uhr | jeder letzte Sonntag im Monat 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg c/o Fachklinikum für Psychiatrie Bernburg | Olga-Benario-Str. 16/18 | 06406 Bernburg phone (03471) 31 98 16 | fax (03471) 64 09 691 | mail: [email protected] Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr | Freitag 9 bis 12 Uhr jeder erste Sonntag im Monat 11 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte für die Opfer des KZ Langenstein-Zwieberge Vor den Zwiebergen 1 | 38895 Halberstadt, OT Langenstein | phone (03941) 56 73 24 | phone/fax (03941) 30 248 mail: [email protected] | Öffnungszeiten (Dauerausstellung): Dienstag bis Freitag 9 bis 15.30 Uhr | jedes letzte Wochenende (Samstag und Sonntag) in den Monaten April bis Oktober 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale) Am Kirchtor 20 b | 06108 Halle | phone (0345) 22 01 337 | fax (0345) 22 01 339 mail: [email protected] | Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr jedes erste Wochenende im Monat (Samstag und Sonntag) 10 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg Umfassungsstraße 76 | 39124 Magdeburg | phone (0391) 24 45 590 | fax (0391) 24 45 599 9 mail: [email protected] | Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 9 bis 16 Uhr Donnerstag: 9 bis 18 Uhr | Freitag 9 bis 14 Uhr | jeder erste Sonntag im Monat 10 bis 16 Uhr Erinnern! sowie nach Vereinbarung Aufgabe, Chance, Herausforderung. -

Bibliotheksbestand LAMV Stand 16.01.2020.Xlsx
Verfasser Titel Untertitel Ort Jahr Signatur Kernkraft in der DDR: Zwischen nationaler Industriepolitik und sozialistischer Zusammenarbeit Kernenergieentwicklung in der DDR. Atomkraftwerke und Widerstand gegen Atomkraft in Abele, Johannes 1963-1990 der DDR. Dresden 2000 Ge-199/26 Politischer Umbruch und Neubeginn in Wismar von Politischer Umbruch in der DDR und in Wismar 1989.Vorgeschichte 1985-1989. Profilierung Abrokat, Sven 1989 bis 1990: der politischen Parteien.+ Dokumente Hamburg 1997 Ge-403 Ackermann, Anton An die lernende und suchende deutsche Jugend: Berlin; Leipzig 1946 DDR-212 Die Jenaer Schulen im Fokus der Staatssicherheit: Eine Abhandlung zur Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR-Schulwesen. Führungs-IM -System in Jena. Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ackermann, Jens P. DDR Ministerium für Staatssicherheit. Weimar 2005 Ge-1021 Christliche Frauen in der DDR: Alltagsdokumente Ackermann, Sonja einer Diktatur in Interviews Studie zur Situation christlicher Frauen in der DDR. 97 Interviews. Leipzig 2005 Ge-1024 A.S. Makarenko- Erzieher im Dienste der Bad Adolphes, Lotte Revolution: Versuch einer Interpretation Eine Makarenko-Studie. Godesberg 1962 Ge-1009 Agsten, Rudolf; Bogisch, LDPD auf dem Weg in die DDR: Zur Geschichte der Manfred LDPD in den Jahren 1946-1949 Berlin 1974 DDR-0001 Feiertage der DDR - Feiern in der DDR. Zwischen Ahbe, Thomas Umerziehung und Eigensinn Feiertage in der DDR. Ritale und Botschaften. Jugendweihe. Erfurt 2017 Ge-1744 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. Entstehung der Ostalgie nach 1990 und ihre Ursachen. Erfurt 2016 Ge-1668 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. -

Der 17. Juni 1953, Der Anfang Vom Ende Des Sowjetischen Imperiums
DER 17. JUNI 1953 DER ANFANG VOM ENDE DES SOWJETISCHEN IMPERIUMS DEUTSCHE TEIL-VERGANGENHEITEN - AUFARBEITUNG WEST: DIE INNERDEUTSCHEN BEZIEHUNGEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE ENTWICKLUNG IN DER DDR DOKUMENTATION 4. BAUTZEN-FORUM DER FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 17. BIS 18. JUNI 1993 INHALTSVERZEICHNIS 5 Vorwort 75 Waleri Alexandrowitsch Wolin Rußland rehabilitiert die durch sowjetische 7 Dr. Joachim Kahlert Militärtribunale unschuldig Verurteilten Auf dem langen Weg zur Einheit die Orientie- rung verloren? 89 Prof. Dr. Jens Hacker Einsichten und Ansichten zur Deutschlandpolitik Die CDU - Vom Alleinvertretungsanspruch zur De-facto-Anerkennung der vormals 21 Winfried Schneider-Deters sogenannten DDR Begrüßung und Einführung 107 Dr. Johannes L. Kuppe 27 Heinder Sandig Die Deutschlandpolitik der SPD -Von der Politik Grußwort des Vizepräsidenten des der deutschen Einheit zur Politik des Status quo Sächsischen Landtages der deutschen Teilung 31 Dr. Karl-Heinz Kunckel 121 Ulrich Schacht Grußwort des Vorsitzenden der sozialdemokra- Der SED-Staat und seine intellektuellen tischen Fraktion im Sächsischen Landtag Kollaborateure in Westdeutschland 35 Karl Wilhelm Fricke 133 Dr. Hans-Hermann Hertle Der 17. Juni 1953 - Der erste Arbeiteraufstand Die Deutschlandpolitik des DGB in den 70er und gegen die kommunistische Diktatur im 80er Jahren - ost-westdeutscher Schulterschluß sowjetischen Imperium im „Kampf gegen das Kapital"? 45 Dr. Bernd Faulenbach 145 Podiumsdiskussion des Bautzen-Komitees Der 17. Juni im westdeutschen Bewußtsein 149 „Stasi-Poeme" - Gedichte aus DDR-Gefängnissen 55 Dr. Falco Werkentin von Dr. Wilhelm Koch Die strafrechtliche „Bewältigung" des 17. Juni 1953 in der DDR 153 Gedenkveranstaltung am Gedenkstein für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in 63 Dr. Armin Mitter den Bautzner Gefängnissen „... Gegen das Volk regieren" - Der Ausbau des Disziplinierungsapparates nach dem 157 Referenten und Teilnehmer an den 17. -

Zaglada8 KSIAZKA.Indb
Wendy Lower Sprawcy i sprawczynie Zagłady a podejście do sprawiedliwości w NRD w latach 1949–19631 Na podstawie świeżo udostępnionej dokumentacji tajnej policji i sądów oraz innych dokumentów z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) w ni- niejszym studium przeanalizowano przebieg dwóch mniej znanych procesów na- zistowskich sprawców Zagłady na terenie Galicji. Bohaterem pierwszego z nich był typowy niemiecki żandarm, uznany za winnego, lecz zwolniony z więzienia w la- tach pięćdziesiątych XX w.; drugi natomiast dotyczył małżeństwa, które w gospo- darstwie rolnym SS dopuściło się zabójstw Żydów i przedstawicieli innych narodo- wości. Oba przypadki uwydatniają metody śledcze stosowane w NRD oraz sposób wykorzystania dowodów przez prokuratorów, a ten drugi pozwala przeanalizować kwestie płci w kontekście zbrodni wojennych i procesów powojennych. Na pod- stawie tych procesów autorka rozpatruje, w jaki sposób zmieniające się nastroje polityczne lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wpływały na dochodzenia, procesy sądowe, a także wyroki. Kiedy w listopadzie 1989 r. padał mur berliński, zwany przez mieszkańców Nie- miec Wschodnich „antyfaszystowskim wałem ochronnym”, pewna 69-letnia kobie- ta, Erna Petri, siedziała w swojej celi w osławionym więzieniu Hoheneck w Saksonii. Jej uwięzienie zbiegło się z budową muru w sierpniu 1961 r. i ze względu na to, że mur ten właśnie likwidowano, mogła żywić nadzieję na zwolnienie. W następnych miesiącach i latach prawnicy, głównie ci z byłych Niemiec Zachodnich, dokonywali 1 Artykuł ukazał się pierwotnie w języku angielskim w „Holocaust and Genocide Studies”, wiosna 2010, t. 24, nr 1, s. 56–84. Redakcja dziękuje autorce oraz wydawcy za udzielenie zgo- dy na tłumaczenie i przedruk. Jesteśmy też wdzięczni autorce za życzliwe odniesienie się do pytań, jakie zrodziły się w toku prac nad przekładem – przyp. -

Bibliotheksbestand: September 2011
Bibliotheksbestand: September 2011 Verfasser Titel Untertitel ErschOrt Jahr Signatur Kernkraft in der DDR: Zwischen Kernenergieentwicklung in Abele, nationaler Industriepolitik und der DDR. Atomkraftwerke Dresden 2000 Ge-199/26 Johannes sozialistischer Zusammenarbeit 1963- und Widerstand gegen 1990 Atomkraft in der DDR. Politischer Umbruch in der DDR und in Wismar Politischer Umbruch und Neubeginn in 1989.Vorgeschichte 1985- Abrokat, Sven Hamburg 1997 Ge-403 Wismar von 1989 bis 1990: 1989. Profilierung der politischen Parteien.+ Dokumente Ackermann, ¬An die lernende und suchende Berlin; Leipzig 1946 DDR-212 Anton deutsche Jugend: ¬Die Jenaer Schulen im Fokus der DDR-Schulwesen. Führungs- Staatssicherheit: Eine Abhandlung zur IM -System in Jena. Ackermann, Mitarbeit von Lehrern und Schülern Mitarbeit von Lehrern und Weimar 2005 Ge-1021 Jens P. beim Ministerium für Staatssicherheit Schülern beim Ministerium der DDR für Staatssicherheit. Christliche Frauen in der DDR: Studie zur Situation Ackermann, Alltagsdokumente einer Diktatur in christlicher Frauen in der Leipzig 2005 Ge-1024 Sonja Interviews DDR. 97 Interviews. A.S. Makarenko- Erzieher im Dienste Adolphes, der Revolution: Versuch einer Eine Makarenko-Studie. Bad Godesberg 1962 Ge-1009 Lotte Interpretation Agsten, LDPD auf dem Weg in die DDR: Zur Rudolf; Geschichte der LDPD in den Jahren Berlin 1974 DDR-0001 Bogisch, 1946-1949 Manfred Umgang mit DDR- Vergangenheit in den 90er Jahren. Erfahrungen der Ostalgie: Zum Umgang mit der DDR- Ostdeutschen.Ostalgie. Ahbe, Thomas Erfurt 2005 Ge-1037 Vergangenheit in den 1990er Jahren Zwischenbilanz der Vereinigung: Ostdeutsche Gewinne und Verluste im Spiegel der Statistik. Analyse der Generationen der DDR und in Ahbe, Geschichte der Generationen in der Ostdeutschland. Gliederung Thomas; DDR und in Ostdeutschland: Ein in sechs Generationen und Erfurt 2007 Ge-1368 Gries, Rainer Panorama Darstellung ihres Wesens.+ zahlreiche Fotos+ Literaturverzeichnis. -

Sammelrez: Der 17. Juni Der Berliner Republik
Hans Bentzien. Was geschah am 17. Juni?: Vorgeschichte - Verlauf - Hintergründe. Berlin: edition ost, 2003. 213 S. broschiert, ISBN 978-3-360-01042-1. Burghard Ciesla. Freiheit wollen wir!: Der 17. Juni 1953 in Brandenburg. Berlin: Christoph Links Verlag, 2003. 255 S. , broschiert, ISBN 978-3-86153-288-0. Torsten Diedrich. Waffen gegen das Volk: Der Aufstand vom 17. Juni 1953. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2003. 259 S. , gebunden, ISBN 978-3-486-56735-9. Torsten Diedrich, Hans Hermann Hertle. Alarmstufe "Hornisse": Die geheimen Chef-Berichte der Volkspolizei über den 17. Juni 1953. Berlin: Metropol Verlag, 2003. 464 S. , , ISBN 978-3-936411-27-0. H-Net Reviews Thomas Flemming. Kein Tag der deutschen Einheit: 17. Juni 1953. Berlin: be.bra Verlag, 2003. 168 S. EUR 19.00, broschiert, ISBN 978-3-89809-038-4. Jan Foitzik. Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa 1953-1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volksaufstand: Politische, militärische, soziale und nationale Dimension. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag, 2001. 393 S. DM 98.00, gebunden, ISBN 978-3-506-72590-5. Karl W. Fricke, Roger Engelmann. Der "Tag X" und die Staatssicherheit: 17. Juni 1953. Reaktionen und Konsequenzen im DDR-Machtapparat. Bremen: Edition Temmen, 2003. 346 S. , gebunden, ISBN 978-3-86108-386-3. Martin Greschat, Jochen-Christoph Kaiser. Die Kirchen im Umfeld des 17. Juni 1953. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2003. 303 S. , broschiert, ISBN 978-3-17-018348-3. Christoph Kleßmann, Bernd Stöver. 1953 - Krisenjahr des Kalten Krieges in Europa. Köln: Böhlau Verlag, 1999. 246 S. , gebunden, ISBN 978-3-412-03799-4. 2 H-Net Reviews Hubertus Knabe. -

Der 17. Juni 1953
Der 17. Juni 1953 Auswahlbibliographie zusammengestellt durch die Bibliothek der Konrad-Adenauer-Stiftung 3. verb. und erg. Aufl. Stand: Juni 2003 Ansprechpartner: Hildegard Krengel Bibliothek der Konrad-Adenauer-Stiftung Rathausallee 12 53757 Sankt Augustin Tel.: 02241 / 246-204 E-Mail: [email protected] Gliederung Aktuelle Neuerscheinungen zum 50. Jahrestag 2003 3 Allgemeine Darstellungen und Sammelbände ........................................................7 Bildbände und Ausstellungskataloge .......................................................................8 Dokumentationen zu Vorgeschichte, Verlauf, Folgen ............................................9 Dokumentationen der Bundesregierung ...............................................................11 Zeitzeugenberichte, autobiographische Zeugnisse und Quellen .........................12 Literarische Rezeption (Literatur und Theater) ..................................................14 Einzelanalysen ..........................................................................................................17 • Deutschlandpolitik und Kalter Krieg .......................................................17 • Vergleichende Studien .............................................................................18 • Regionale Studien ....................................................................................19 • Opposition und Widerstand .....................................................................22 • Bürgerliche Parteien und Kirchen ...........................................................23 -

„Erinnern!“ 1 | 2013
Gedenkstätte KZ Lichtenburg Prettin Prettiner Landstraße 4 | 06925 Annaburg, OT Prettin | phone (035386) 60 99 75 | fax (035386) 60 99 77 mail: [email protected] | Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 15.30 Uhr Freitag 9 bis 13 Uhr | jeder letzte Sonntag im Monat 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg c/o Fachklinikum für Psychiatrie Bernburg | Olga-Benario-Str. 16/18 | 06406 Bernburg phone (03471) 31 98 16 | fax (03471) 64 09 691 | mail: [email protected] Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr | Freitag 9 bis 12 Uhr jeder erste Sonntag im Monat 11 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte für die Opfer des KZ Langenstein-Zwieberge Vor den Zwiebergen 1 | 38895 Halberstadt, OT Langenstein | phone (03941) 56 73 24 | phone/fax (03941) 30 248 mail: [email protected] | Öffnungszeiten (Dauerausstellung): Dienstag bis Freitag 9 bis 15.30 Uhr | jedes letzte Wochenende (Samstag und Sonntag) in den Monaten April bis Oktober 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale) Am Kirchtor 20b | 06108 Halle | phone (0345) 22 01 337 | fax (0345) 22 01 339 mail: [email protected] | Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 16 Uhr jedes erste und dritte Wochenende im Monat (Samstag und Sonntag) 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg Umfassungsstraße 76 | 39124 Magdeburg | phone (0391) 24 45 590 | fax (0391) 24 45 599 9 mail: [email protected] | Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch 9 bis 16 Uhr Donnerstag: 9 bis 18 Uhr | Freitag 9 bis 15 Uhr | jeder erste Samstag im Monat 10 bis 12 Uhr Erinnern! sowie nach Vereinbarung Aufgabe, Chance, Herausforderung. -

Erna Dorn“ KZ-Kommandeuse Und Rädelsführerin Des 17
Tizian Gräb Der Fall „Erna Dorn“ KZ-Kommandeuse und Rädelsführerin des 17. Juni 1953 ? Der Fall „Erna Dorn“ Tizian Gräb Der Fall „Erna Dorn“ KZ-Kommandeuse und Rädelsführerin des 17. Juni 1953? Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnd.d-nb.de abrufbar. CXLX © Universitätsverlag Halle-Wittenberg, Halle an der Saale 2017 Umschlaggestaltung: pixzicato GmbH Hannover, Horst Stöllger Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der photomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. ISBN 978-3-86977-149-6 5 Vorwort Die hier im Druck vorgelegte Studie ist eine Seminarhausarbeit, welche aus dem von mir im Sommersemester 2015 veranstalteten rechtsgeschichtlichen Seminar „Frauen vor Gericht – ‚Geschlechterkampf‘ in Prozessform“ hervorgegangen ist. Es war der hallischen Professorin Dr. iur. Gertrud Schubart-Fikentscher (1896– 1985), der ersten Frau auf einem juristischen Lehrstuhl im deutschsprachigen Raum, anlässlich ihres 30. Todestages gewidmet. Die Einzelthemen erstreckten sich von der Antike über das Mittelalter und die Frühe Neuzeit bis hin zu den 1970er Jahren. Das Seminar erfreute sich nicht nur regen Zulaufs, sondern brachte an seinem Ende eine stattliche Anzahl von gut und sehr gut zu bewertenden Seminarhausarbeiten hervor. In Anbetracht dieses posi- tiven Ergebnisses reifte der Plan, die besten Arbeiten zu publizieren. Dieser ist nun- mehr realisiert. Das kritische Leserpublikum wird gebeten, zu beachten, dass es sich hier um Erstlingswerke ganz junger und begabter studentischer Autorinnen und Autoren handelt. Kleinere Unzulänglichkeiten, nicht ganz überzeugende Verkürzungen u. ä. möge man großherzig verzeihen. Das Genre „Seminarhausarbeit“ ist an strenge Umfangsvorgaben gebunden, so dass der Platz für die Durchdringung des jewei- ligen Themas und dessen konzise Darstellung von vornherein knapp ist. -

Falco Werkentin, Recht Und Justiz Im SED-Staat, Bonn 2000, (Deutsche Zeitbilder), S.27Ff
Falco Werkentin, Recht und Justiz im SED-Staat, Bonn 2000, (Deutsche ZeitBilder), S.27ff. (Auszug) (...) Wenige Wochen nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 machte Hilde Benjamin, soeben zur neuen Justizministerin der DDR ernannt, den Richtern und Staatsanwälten diese Praxis zum Vorwurf. ”So führte zum Beispiel die überhöhte Festsetzung des Ablieferungssolls für Großbauern zu Strafverfahren, in denen, gestützt auf unsere Gesetze, die Großbauern wegen Nichterfüllung des Ablieferungssolls verurteilt wurden; durch die Anwendung der Einkommenssteueränderungsverordnung vom 5. März d.J. wurde die Nichtbezahlung von Steuerschulden in größerem Umfang bestraft. Diese Fehler (...) wurden von den Staatsanwälten und Richtern in der Überzeugung begangen, dadurch mit der Rechtsprechung dem beschleunigten Aufbau des Sozialismus zu dienen.” 38 Strafrechtliche Reaktion auf den Volksaufstand vom 17. Juni In den ersten Junitagen des Jahres 1953 bestellte das Politbüro der Kommunistische Partei der Sowjetunion KPdSU führende Vertreter der SED nach Moskau. Hier erhielten sie Anweisung, umgehend den extrem harten Kurs beim Aufbau des Sozialismus in der DDR zu mildern und die Urteile der in den Haftanstalten Sitzenden überprüfen zu lassen mit dem Ziel von Massenentlassungen. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte früher als ihre deutschen Genossen erkannt, wie explosiv sich die Stimmungslage in der DDR entwickelt hatte. Am 9. Juni 1953 verkündete die SED der Bevölkerung ihren ”neuen Kurs” und versprach, Haftstrafen zu überprüfen und Häftlinge zu entlassen. Doch bestand die SED-Führung weiterhin darauf, dass demnächst eine allgemeine Normerhöhung um zehn Prozent erfolgen sollte. In sogenannten Normen waren für jeden Arbeitszweig Mindestleistungen festgelegt, die ein Arbeiter erfüllen musste, um seinen vollen Tariflohn zu erhalten. Eine zehnprozentige Normerhöhung bedeute also eine Lohnkürzung um zehn Prozent, es sei denn, die Werktätigen leisteten für dasselbe Geld zehn Prozent mehr Arbeit. -

SHARE YOUR SLATE at the European Film MARKET 2014 February 8Th - 12Th Presented by Creative Europe Desks Germany
SHARE YOUR SLATE AT THE EuropEAn FiLm mARKET 2014 February 8th - 12th presented by Creative Europe Desks Germany Creative Europe SHARE YOUR SLATE AT THE EuropEAn FiLm mARKET 2014 February 8th - 12th presented by Creative Europe Desks Germany Creative Europe Creative Europe Desk Hamburg Friedensallee 14-16 22765 Hamburg +49 40 390 65 85 Adresses Creative Europe mEDiA stand at the EFm Martin-Gropius-Bau Berlin Stand No. 25 Niederkirchnerstr. 7 10963 Berlin Creative Europe Desk phone at the stand: +49 30 863 950 442 Coordination in Berlin: Christiane Siemen, Britta Erich, Lisa Emer; Susanne Schmitt, Mirja Frehse, Uta Eberhardt; Ingeborg Degener, Ewa Szurogajlo; Heike Meyer-Döring Contact person at the stand: Robin Müller, Cell +49 152 575 807 94 Organized by Creative Europe Desk Hamburg Friedensallee 14-16 22765 Hamburg, Germany phone +49 40 390 65 85 [email protected] http://www.creative-europe-desk.de Fotonachweis Coverbild “ÜBER-ICH UND DU” von Benjamin Heisenberg, Komplizen Film GmbH. Der von MEDIA mit einer Projektentwicklung geförderte Film feiert Premiere im Panorama Special der 64. Internationalen Filmfest- spiele Berlin. © Komplizen Film GmbH p articipants Activist 38 Bulgaria 4 Agitprop Bulgaria 8 ALEF Slovakia 12 Amp polska Poland 14 Amrion Estland 18 Arkadia, Rohde-Dahl Poland / Germany 22 Close Up Films Switzerland 24 Danish Documentary production Denmark 28 DFm Sweden 32 fernsehbüro Germany 34 Gala Film Bulgaria 38 Gebrueder Beetz, Berlin Germany 42 Gebrueder Beetz, Hamburg Germany 46 Graffiti Doc Italy 50 Hob AB Sweden 52 Human Ark Poland 56 illume Oy Finland 58 making movies Oy Finland 62 miR Cinematografica Italy 64 Odeon / Hoffmann & Voges Germany 68 Off World Belgium 72 Savage Film Belgium 76 Senator Film Belgium 80 Spiritus movens Croatia 82 Trigon Slovakia 86 unafilm Germany 90 3 Company Activist 38 149 B Rakovski Street, Sofia 1000, Bulgaria phone: +359 2 9867556, [email protected] Activist38 was founded in 2008 by Mina Mileva and Vesela Kazakova. -

Soviet Espionage
50 COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN SOVIET ESPIONAGE ATOMIC ESPIONAGE AND ITS SOVIET “WITNESSES” The publication this past spring of the memoirs of for Memoirs of an Unwanted Witness—A Soviet Spymaste by Vladislav Zubok Leona P. Schecter (Little, Brown, and Co., 1994)—spark prominent scientists who participated in the Manhattan No trial jury should render a guilty verdict without solid evidence, and neither should including J. Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Leo scholars. Therefore historians and scientists reacted with deep skepticism when in his nuclear information to Soviet intelligence. In newspaper recently-published memoir, Special Tasks, Pavel Sudoplatov, a notorious operative of programs, as well as at a forum CWIHP-sponsored forum Stalin’s secret service, asserted that the KGB received secret atomic information from prominent historians of nuclear issues and of the KGB denounced the charges of atomic spying as at worst scur several eminent scientists who worked on the Manhattan Project, including J. Robert 1 Special Tasks, and some supporters, stuck to their accou Oppenheimer, Enrico Fermi, Leo Szilard, and Niels Bohr. Sudoplatov’s claim that Bohr would eventually be released to buttress their account. had knowingly given sensitive atomic data to a Soviet intelligence operative in November about the controversy.) The allegations raised serious q 1945, thereby helping the USSR to start its first controlled nuclear chain reaction for the about how to evaluate the memoirs and oral histories of C production of weapons-grade plutonium,2 generated particular surprise and disbelief given the shadowy world of the intelligence agencies, where d the renowned Danish physicist’s towering reputation for integrity and loyalty in the In the hope of helping readers evaluate at least on scientific world.