100 X Kleine Geschichte(N) an Der VIA REGIA
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
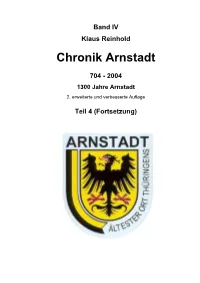
Chronik Band 4
Band IV Klaus Reinhold Chronik Arnstadt 704 - 2004 1300 Jahre Arnstadt 2. erweiterte und verbesserte Auflage Teil 4 (Fortsetzung) Hebamme Anna Kessel (Weiße 50) verhalf am 26.10.1942 dem viertausendstem Kind in ihrer langjährigen beruflichen Laufbahn zum Leben. 650 „ausgebombte“ Frauen und Kinder aus Düsseldorf trafen am 27.10.1942 mit einem Son- derzug in Arnstadt ein. Diamantene Hochzeit feierte am 28.10.1942 das Ehepaar Richard Zeitsch (86) und seine Ehefrau Hermine geb. Hendrich (81), Untergasse 2. In der Nacht vom Sonntag, dem 1. zum 2.11.1942, wurden die Uhren (um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr) um eine Stunde zurückgestellt. Damit war die Sommerzeit zu Ende und es galt wieder Normalzeit. Zum ersten Mal fand am 14.11.1942 in Arnstadt eine Hochzeit nach dem Tode statt. Die Näherin Silva Waltraud Gertrud Herzer heiratete ihren am 9.8.1941 gefallenen Verlobten, den Obergefreiten Artur Erich Hans Schubert mit dem sie ein Töchterchen namens Jutta (7 30.8.1939 in Arnstadt) hatte. Die Heirat erfolgte mit Wirkung des Tages vor dem Tode, also 8.8.1941. Die Tochter wurde „durch diese Eheschließung legitimiert“. 1943 Der Sturm 8143 des NS-Fliegerkorps baute Anfang 1943 auf dem Fluggelände Weinberg bei Arnstadt eine Segelflugzeughalle im Werte von 3500 RM. Die Stadt gewährte einen Zuschuß von 1000 RM und trat dem NS-Fliegerkorps als Fördermitglied mit einem Jahres- beitrag von 100,00 RM bei. Der fast 18-jährige Schüler Joachim Taubert (7 24.2.1925 in Arnstadt) wurde am 6.1.1943, 9.00 Uhr, in der Wohnung seiner Mutter, der Witwe Gertrud Elisabeth Taubert geb. -

Veranstaltungen 30 Jahre Mauerfall
30J_Mauerfall_236x118_V12.qxp_236x118 23.05.19 14:33 Seite 1 Hessische Landesregierung 30 JAHRE MAUERFALL VERANSTALTUNGSKALENDER 30J_Mauerfall_236x118_V12.qxp_236x118 23.05.19 14:04 Seite 2 30J_Mauerfall_236x118_V12.qxp_236x118 23.05.19 14:04 Seite 1 „Wir leben Freiheit” ... ... das ist das Motto der Veranstaltungsreihe, Jüngere Menschen kennen die Ereignisse des deren Programmheft Sie in der Hand halten. Jahres 1989 und die Schrecken des SED-Regimes Mit dieser Reihe erinnern wir an den Fall der wie der anderen Diktaturen nicht aus eigener Berliner Mauer und die Öffnung der innerdeut- Wahrnehmung. An sie richtet sich die Veranstal- schen Grenze vor 30 Jahren. tungsreihe deshalb ausdrücklich ebenso. Wer 1989 alt genug war, um das politische Die Reihe macht die Geschichte erfahrbar und Geschehen wahrnehmen und einordnen zu das in den vergangenen drei Jahrzehnten Er- können, wusste sehr bald: Dieses Jahr markiert reichte sichtbar. Nicht zuletzt zeigt sie: Freiheit, eine Zeitenwende. Die Teilung Deutschlands, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit sind nicht Europas und der Welt war zu Ende. Die Freiheit selbstverständlich und müssen in einer Demo- konnte sich jetzt auch in den Teilen Europas öst- kratie immer wieder aufs Neue verteidigt werden. lich der alten Trennlinie entfalten, das nach der nationalsozialistischen Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg geteilte Deutschland fand zur Wieder- vereinigung. VolkerVolker BouffierBouffier Hessischer Ministerpräsident 1 30J_Mauerfall_236x118_V12.qxp_236x118 23.05.19 14:04 Seite 2 30J_Mauerfall_236x118_V12.qxp_236x118 23.05.19 14:04 Seite 3 ... ist der Titel der Veranstaltungsreihe „30 Jahre Philippsthal und Vacha. Gemeinsam daran zu erinnern, dass die Freiheit FREIHEITWir leben Mauerfall vom 13. August bis zum 9. November kein selbstverständliches Gut ist und ihre Bedeutung immer wieder 2019. -

Berliner Mauer Und Innerdeutsche Grenze Bestandsverzeichnis Aus Der Bibliothek Der Bundesstiftung Aufarbeitung
Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze Bestandsverzeichnis aus der Bibliothek der Bundesstiftung Aufarbeitung In der Nacht zum 13. August 1961 begann die Abriegelung der Grenze zu den Berliner Westsektoren durch das SED-Regime. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Volks- und Grenzpolizei sowie Betriebskampfgruppen der SED wurden Verbindungs- straßen aufgerissen, Spanische Reiter und Stacheldrahtverhaue errichtet und der öffentliche Nahverkehr zwischen den beiden Stadtteilen dauerhaft unterbrochen. In den folgenden Tagen und Wochen wurden die provisorischen Stacheldrahtsperren unter scharfer Bewachung durch DDR-Grenzposten mit einer Mauer aus Hohlblock- steinen und Betonplatten ersetzt. Walter Ulbricht hatte sein Ziel erreicht. Der letzte noch offene Fluchtweg in den Westen war geschlossen und die bis dahin stetig wachsende Fluchtbewegung aus der DDR gestoppt. Die Berliner Mauer existierte über 28 Jahre lang und wurde zum Symbol für das menschenverachtende Regime in der DDR-Diktatur und zum Symbol der Deutschen Teilung und des Kalten Krieges. Die Mauer stand zudem für die Unerbittlichkeit eines Regimes, das auch vor Todesschüssen auf Flüchtlinge nicht zurückschreckte. Die vorliegende Bibliographie umfasst sämtliche Monographien, Broschüren und audiovisuellen Medien aus dem Bestand der Stiftungsbibliothek, die sich dem Themenkomplex Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze widmen. Das Verzeichnis ist in folgende Rubriken gegliedert: Mauerbau und Vorgeschichte ● Leben mit der Mauer ● Innerdeutsche Grenze ● Flucht und Opfer der Mauer/innerdeutschen Grenze ● Grenze und Fluchtbewegung vor 1961 ● Gedenkstätten und Erinnerung ● Ausreise Mauerbau und Vorgeschichte 3 x durch den Zaun. Bonn: Büro Bonner Berichte, 1963. Signatur: F 9591 13. August 1961. Bonn: Kuratorium Unteilbares Deutschland, 1961. Signatur: F 9963 13. August 1961. 2., überarb. Aufl. Bonn: Gesamtdt. Inst., 1986. (Seminarmaterial des Gesamtdeutschen Instituts). -

Rundbrief Der SED-Diktatur 18.8
Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt Veranstaltungen (online) zur Aufarbeitung Rundbrief der SED-Diktatur 18.8. (Mi), 15---19.30 Uhr + 19.8. (Do), 10---19.30 Uhr ● Livestream (Übertragung aus Berlin); auch danach im „Channel‘‘ der Bundesstiftung Aufarbeitung abrufbar Dealing with the Past --- Erinnerung und Aufarbeitung nach Systemumbrüchen im späten 20. Jahrhundert August 2021 Während der Konferenz sollen verschiedene „Transitional Justice“-Ansätze im internationalen Vergleich vorgestellt und dabei u.a. folgenden Fragen nachgegangen werden: Wie gestalteten sich Systemumbrüche in verschiedenen Staaten? Wie wirkten sich die politischen Ereignisse Schleinufer 12 Tel.: 03 91 / 5 60 15 01 der Umbruchszeit auf die persönlichen Biographien der Menschen aus? Welche Verwerfungen 39104 Magdeburg Fax: 03 91 / 5 60 15 20 und Einschnitte sind auch heute noch spürbar? Vor welchen Herausforderungen und Aufgaben https://aufarbeitung.sachsen-anhalt.de E-Mail: [email protected] stehen demokratische Gesellschaften beim Umgang mit ihrer diktatorischen Geschichte? Wel- che verschiedenen Wege haben unterschiedliche Länder bei der Auseinandersetzung mit ihrer Tel. Geschäftszeiten: Mo---Do 9.00---15.00 Uhr; Fr 9.00---13.00 Uhr jüngeren, oft von Gewalt geprägten Vergangenheit beschritten? Was können wir gegenseitig voneinander aus den unterschiedlichen Erfahrungen lernen und welche gemeinsamen Wege Ausführlichere Informationen sowie aktuelle Ergänzungen auf unserer Website unter „Termine‘‘ können wir gehen? Beiträge: Prof. Dr. Jan Eckel, Eberhard Karls Universität Tübingen; Prof. Dr. Aurel Croissant, Liebe Leserin, lieber Leser, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Prof. Dr. Sabine Kurtenbach, GIGA Institut für Lateinamerika-Studien, Hamburg; Prof. Dr. Carola Lentz, Goethe- der August ist voller wichtiger historischer Daten. Zu einigen wird es Veranstaltungen geben, Institut, München; Prof. -

Geschichte Der Naturwissenschaft, Der Technik Und Der Medizin in Deutschland
German National Committee Geschichte der Naturwissenschaft, der Technik und der Medizin in Deutschland History of Science, Technology and Medicine in Germany 2009-2012 edited by Bettina Wahrig / Julia Saatz Braunschweig 2013 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055530 23/01/2014 Zusammengestellt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Dieser Bericht wurde aus Anlass des XXIV. Internationalen Kongresses für Wissenschaftsgeschichte in Manchester mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) erstellt. Der Bericht erscheint als PDF-File auf CD-ROM oder kann auch von der Homepage des Nationalkomitees der IUHPS/DHS heruntergeladen werden: <http://www-wissenschaftsgeschichte.uni-regensburg.de/NK.htm>. Verwiesen sei auch auf die Online-Datenbank WissTecMed*Lit, mit deren Hilfe die hier veröffentlichte Forschungsbibliographie erstellt wurde. Diese Datenbank zu wissenschafts-, medizin- und technikhistorischer Forschungsliteratur wird weiterhin aktualisiert im Internet zur Verfügung stehen: http://lit.wisstecmed.de/detail.php. Weitere Exemplare der CD-ROM können angefordert werden von b.wahrig[at]tu-braunschweig.de. This brochure was prepared for the XXIV. International Congress of History of Science in Manchester; compilation was supported by the German Research Foundation (DFG). The CD-ROM contains the complete text as a PDF file, which is also available for download from the homepage of the German National Committee <http://www-wissenschaftsgeschichte.uniregensburg.de/NK.htm>. The data have been compiled via the web based catalogue WissTecMed*Lit. This data base of publications on the history of science, technology and medicine shall be continuously updated and can be accessed at http://lit.wisstecmed.de/detail.php. Additional copies of the CD-ROM can be obtained by sending an email to: b.wahrig[at]tu- braunschweig.de. -

Cyril Buffet the German Philosopher Walter Benjamin Considered That
Brolly. Journal of Social Sciences 2 (3) 2019 THE COLD WAR AS A VISUAL CONFLICT: PHOTOGRAPHIC REPRESENTATIONS OF THE BERLIN WALL Cyril Buffet PhD, historian of international relations. He has written and edited volumes on Germany (Histoire de Berlin, Fayard, Paris, 1993; Le Jour où le Mur est tombé, Larousse, Paris, 2009), myths in world politics (with Beatrice Heuser, Haunted by History, Berghahn, Oxford, 1998) and on the history of film (Défunte Defa, Corlet, Paris, 2007; Cinema in the Cold War. Political Projections, Routledge, Abingdon, 2016). [email protected] Abstract. This article deals with the iconology of the Berlin Wall from its construction, in August 1961, to its fall, in November 1989. The Berlin Wall was the symbol of the Cold War. It was the most photographed and filmed motif of that period. In this regard, the West and the East gave each other a battle of images: some of them became world-famous. They included photographs that proclaimed the Wall to be an “antifascist rampart” on one side and a “Wall of Shame” on the other side. These photographs formed binary couples: freedom vs. peace, concrete and barbed wire vs. human flesh, victims vs. martyrs. Keywords: Berlin Wall, Cold War, GDR, iconography, propaganda, memorials The German philosopher Walter Benjamin considered that “history is broken down into images”1. History produces pictures – paintings, and more recently, photos, and the pictures in turn influence history, influence our collective historical memory2. Pictures of the past determine our image of the past. Some pictures have the power to crystallize interpretations of an event in our head, to shape its perception and to fix it in the collective memory. -

Bibliotheksbestand LAMV Stand 16.01.2020.Xlsx
Verfasser Titel Untertitel Ort Jahr Signatur Kernkraft in der DDR: Zwischen nationaler Industriepolitik und sozialistischer Zusammenarbeit Kernenergieentwicklung in der DDR. Atomkraftwerke und Widerstand gegen Atomkraft in Abele, Johannes 1963-1990 der DDR. Dresden 2000 Ge-199/26 Politischer Umbruch und Neubeginn in Wismar von Politischer Umbruch in der DDR und in Wismar 1989.Vorgeschichte 1985-1989. Profilierung Abrokat, Sven 1989 bis 1990: der politischen Parteien.+ Dokumente Hamburg 1997 Ge-403 Ackermann, Anton An die lernende und suchende deutsche Jugend: Berlin; Leipzig 1946 DDR-212 Die Jenaer Schulen im Fokus der Staatssicherheit: Eine Abhandlung zur Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR-Schulwesen. Führungs-IM -System in Jena. Mitarbeit von Lehrern und Schülern beim Ackermann, Jens P. DDR Ministerium für Staatssicherheit. Weimar 2005 Ge-1021 Christliche Frauen in der DDR: Alltagsdokumente Ackermann, Sonja einer Diktatur in Interviews Studie zur Situation christlicher Frauen in der DDR. 97 Interviews. Leipzig 2005 Ge-1024 A.S. Makarenko- Erzieher im Dienste der Bad Adolphes, Lotte Revolution: Versuch einer Interpretation Eine Makarenko-Studie. Godesberg 1962 Ge-1009 Agsten, Rudolf; Bogisch, LDPD auf dem Weg in die DDR: Zur Geschichte der Manfred LDPD in den Jahren 1946-1949 Berlin 1974 DDR-0001 Feiertage der DDR - Feiern in der DDR. Zwischen Ahbe, Thomas Umerziehung und Eigensinn Feiertage in der DDR. Ritale und Botschaften. Jugendweihe. Erfurt 2017 Ge-1744 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. Entstehung der Ostalgie nach 1990 und ihre Ursachen. Erfurt 2016 Ge-1668 Ostalgie: Zu ostdeutschen Erfahrungen und Ahbe, Thomas Reaktionen nach dem Umbruch Umgang mit DDR-Vergangenheit. -

Bestandsverzeichnis Mauerbau Stand 2013 09 18
50. Jahrestag des Mauerbaus Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze – Illustriertes Bestandsverzeichnis aus der Bibliothek der Bundesstiftung Aufarbeitung In der Nacht zum 13. August 1961 begann die Abriegelung der Grenze zu den Berliner Westsektoren durch das SED-Regime. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Volks- und Grenzpolizei sowie Betriebskampfgruppen der SED wurden Verbindungs- straßen aufgerissen, Spanische Reiter und Stacheldrahtverhaue errichtet und der öffentliche Nahverkehr zwischen den beiden Stadtteilen dauerhaft unterbrochen. In den folgenden Tagen und Wochen wurden die provisorischen Stacheldrahtsperren unter scharfer Bewachung durch DDR-Grenzposten mit einer Mauer aus Hohlblock- steinen und Betonplatten ersetzt. Walter Ulbricht hatte sein Ziel erreicht. Der letzte noch offene Fluchtweg in den Westen war geschlossen und die bis dahin stetig wachsende Fluchtbewegung aus der DDR gestoppt. Die Berliner Mauer existierte über 28 Jahre lang und wurde zum Symbol für das menschenverachtende Regime in der DDR-Diktatur und zum Symbol der Deutschen Teilung und des Kalten Krieges. Die Mauer stand zudem für die Unerbittlichkeit eines Regimes, das auch vor Todesschüssen auf Flüchtlinge nicht zurückschreckte. Die vorliegende Bibliographie umfasst sämtliche Monographien, Broschüren und audiovisuellen Medien aus dem Bestand der Stiftungsbibliothek, die sich dem Themenkomplex Berliner Mauer und innerdeutsche Grenze widmen. Das Verzeichnis ist in folgende Rubriken gegliedert: Mauerbau und Vorgeschichte – Leben mit der Mauer – Innerdeutsche Grenze – Flucht und Opfer der Mauer/innerdeutschen Grenze – Grenze und Fluchtbewegung vor 1961 – Gedenkstätten und Erinnerung – Ausreise Mauerbau und Vorgeschichte 3 x durch den Zaun. Bonn: Büro Bonner Berichte, 1963. [Signatur: F 9591] 13. August 1961. Bonn: Kuratorium Unteilbares Deutschland, 1961. [Signatur: F 9963] 13. August 1961. 2., überarb. Aufl. Bonn: Gesamtdt. -

Eiserner Vorhang Arnstadt Rudi
NAME Rudi Arnstadt Arnstadt, Rudi Geboren am 3. September 1926 in Erfurt | erschossen am GESCHLECHT 14. August 1962 | Ort des Vorfalls: Grenzabschnitt männlich Wiesenfeld, auf der Westseite nahe Hünfeld (Hessen) GEBURTSDATUM 3. September 1926 GEBURTSORT Erfurt LETZTER WOHNORT Wiesenfeld, Ortsteil von Geisa STAAT DES VORFALLS Bundesrepublik REGION DES VORFALLS Quelle: public domain Hessen ORT DES VORFALLS Er gehörte zu den Helden der DDR-Grenztruppen. Bis 1982 erhielten insgesamt über 50 Grenzabschnitt Wiesenfeld, auf der Brigaden, Hundertschaften der Kampfgruppen, Reservistenkollektive, GST- Westseite nahe Hünfeld Grundorganisationen, das Grenzausbildungsregiment in Plauen, Schulen und Lehrlingseinrichtungen den Namen Arnstadts. Sein Tod an der innerdeutschen Grenze löste ein großes Medienecho auf beiden Seiten aus. TODESURSACHE Schusswaffen Er gehörte zu den Helden der DDR-Grenztruppen. Bis 1982 erhielten insgesamt über 50 Brigaden, Hundertschaften der Kampfgruppen, Reservistenkollektive, GST- DATUM DES VORFALLS Grundorganisationen, das Grenzausbildungsregiment in Plauen, Schulen und 14. August 1962 Lehrlingseinrichtungen den Namen Arnstadts. Sein Tod an der innerdeutschen Grenze löste ein großes Medienecho auf beiden Seiten aus. TODESALTER 35 Rudi Arnstadt kam als uneheliches Kind zur Welt. Sein Vater starb ein Jahr nach seiner Geburt. Er wurde evangelisch getauft, besuchte von 1933 bis 1940 die Volksschule und TEILPROJEKT arbeitete danach in einer Erfurter Eisengießerei. Seine Pflegeeltern Berthold und Therese innerdeutsche Grenze Morgenroth gehörten seit Ende der 1920er Jahre der KPD an. Im Sommer 1943 kam Rudi Arnstadt zunächst zum Reichsarbeitsdienst, bevor er im September 1943 Soldat beim FALLGRUPPE Panzerregiment I, Erfurt, wurde. Sein älterer Stiefbruder Hermann, der vor 1933 ebenfalls ohne Fluchtabsicht KPD-Mitglied war, fiel im gleichen Jahr. Rudi Arnstadt selbst nahm 1945 an Kampfhandlungen im Raum Aachen teil. -

5. Wahlperiode Drucksache 5/5925 27.03.2013 U N T E R R I C H T U N G
THÜRINGER LANDTAG Drucksache 5/ 5. Wahlperiode 5925 27.03.2013 U n t e r r i c h t u n g durch die Präsidentin des Landtags Tätigkeitsbericht 2012 der Landesbeauftragten des Frei- staats Thüringen für die Unterlagen des Staatssicher- heitsdienstes der ehemaligen DDR gemäß § 6 Satz 1 des Thüringer Landesbeauftragtengesetzes Die Landesbeauftragte des Freistaats Thüringen für die Unterlagen des Staatssicherheits dienstes der ehemaligen DDR hat mit Schreiben vom 27. März 2013 den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012 übersandt. Birgit Diezel Präsidentin des Landtags Hinweis der Landtagsverwaltung: Der Tätigkeitsbericht 2012 ist als Anlage übernommen. Druck: Thüringer Landtag, 10. April 2013 Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012 vorgelegt der Präsidentin des Thüringer Landtages am 27. März 2013 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 3 1. Beratungstätigkeit der Landesbeauftragten 5 1.1 Beratung öffentlicher Stellen 5 1.2 Bürgerberatung und psychosoziale Betreuung 6 1.3 Rehabilitierung nach dem Strafrechtlichen und nach dem Beruflichen 9 Rehabilitierungsgesetz? 1.4 Nach-Wirkungen politischer Haft 10 1.5 Keine Rehabilitierung nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz 12 1.6 Stiftung für ehemalige politische Häftlinge 13 1.7 Statistik der Beratungsgespräche im Berichtsjahr 14 1.8 Statistik zu Rehabilitierungen nach SED-UnBerG im Berichtsjahr 15 1.9 Aus der Beratung 17 2. Veranstaltungen, Publikationen und Ausstellungen 18 2.1 Einzelveranstaltungen TLStU mit diversen Partnern 18 2.2 Workshop „60 Jahre Gründung der Stasi-Bezirks-U-Haftanstalten“ 23 2.3 TLStU-Publikation 24 2.4 Ausstellungen 25 2.4.1 TLStU-Ausstellung 2012 – Konzept, Erarbeitung, Präsentation 25 2.4.2 Weitere Ausstellungen 26 2.5 Mitherausgabe und weitere Publikationen 26 3. Pädagogische Bildungsangebote 28 3.1 Erstellung weiterer Quellen-Zeitzeugen-Projekte 28 3.2 Quellen-Zeitzeugen-Projekte 28 3.3 Betreuung von Seminarfacharbeiten 30 3.4 Zeitzeugen-Hör-Archiv 30 4. -
Downloads/CHECK Universitaetsleitung in Deutsc Hland.Pdf
Brolly Journal of Social Sciences ADVISORY BOARD Pierre-Yves Beaurepaire, PhD, Professor, Université de Nice Sophia-Antipolis, France Patrick Flanagan, PhD, Associate Professor, St. John's University, New York, USA Francisco-Javier Herrero-Hernandez, PhD, Professor, Pontifical University of Salamanca, Spain Fernando Martín, PhD, Professor, San Pablo CEU University, Madrid, Spain Marina Prusac Lindhagen, PhD, Associate Professor, Museum of Cultural History, University of Oslo, Norway Francisco Marcos Marin, PhD, Professor, University of Texas at San Antonio, USA Barbara Pazey, Associate Professor, University of North Texas, USA Federico Del Giorgio Solfa, PhD, Professor, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina Gabriel J. Zanotti, PhD, Professor, Austral University, Buenos Aires, Argentina Antonella Nuzzaci, PhD, Associate Professor, University of L'Aquila, Italy Daniele Schiliro, PhD, Associate Professor, University of Messina, Italy Iris Gareis, PhD, Associate Professor, Goethe University, Frankfurt am Main, Germany Vicente Da Haro Romo, PhD, Professor, Universidad Panamericana, Mexico Ruben Safrastyan, PhD, Professor, American University of Armenia Cameron A. Batmanghlich, PhD, Professor, Varna University of Management, Bulgaria Riyas Sulaima Lebbe, PhD, Professor, British American University, Republic of Benin Yuliya Shamaeva, PhD, Associate Professor, V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine EDITORIAL BOARD Editor-in-Chief Madalin Onu, PhD Editor Cristina Lucia Sutiu, PhD Brolly Journal of Social Sciences Vol. 2, No. 3 (December 2019) Copyright © 2019 London Academic Publishing All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review or scholarly journal. -

Sonderdruck Der Arbeitsgruppe Grenze
Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung e.V. Der Vorstand Sonderdruck der Arbeitsgruppe Grenze < Herbsttreffen 2013> Für Mitglieder und Sympathisanten November 2013 2 3 Inhaltsverzeichnis Seite OSL. a.D. Siegfried Hannig, Einschätzung 4 Beitrag OSL a. D Siegfried Hannig 5 Referat Hans Bauer, Vorsitzender der GRH, „20 Jahre GRH, 20 Jahre politische Kampforganisation und Interessenvertretung für die Opfer der politisch motivierten Strafverfolgung sowie für die Angehörigen der Grenztruppen der DDR“ 6 Begrüßung durch Oberst a.D. Sygmund Seynik, ehemaliger Angehöriger der polnischen Grenzschutzorgane 13 Oberst i.R. Dr. Milan Richter, Stellvertretender Vorsitzender des Nationalrates des Clubs der Tschechischen Grenzgebiete (KCP), Grußwort 14 Admiral a.D. Theodor Hoffmann, Vorsitzender des Verband zur Pflege der Trationen der NVA und der Grenztruppen der DDR, Grußwort 15 Oberst a.D. Heinz Schubert, Fünf Jahre IGRA unter dem Dach der GRH 16 OSL a.D. Horst Liebig; Die Geschichte der Grenztruppen ist noch nicht geschrieben 17 Begrüßung durch OSL a.D. Dr. Jaroslav Horak, ehemaliger Angehöriger der tschechoslowakischen Grenzschutzorgane 20 Martina Holzinger, Aktion „Das Begräbnis oder die Himmlichen Vier“ 20 Andreas Maluga, DDR-Kabinett Bochum e.V. 22 Oberst a.D. Günter Leo, Die GRH aus der Sicht eines Verurteilten 23 OSL a.D. Herbert Kierstein, Der Weg ins Internet, Möglichkeiten für Ausgegrenzte 26 OSL a.D. Günter Ganßauge 27 Major a.D. Herbert Wagner, Kameradschft „Florian Geyer“ (schriftlich eingereicht) 27 Dr. Klaus Emmerich, Buchempfehlungen (schriftlich eingereicht) 29 Günter Seidel, Stellvertretender Vorsitzender der GRH, Schlußwort 29 Anlage Dokumentation zur geschichtlichen Entwicklung der Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung e.V. (GRH) und ihrer Arbeitsgruppe Grenze 1993 – 2013, Aktivitäten und Erfolge 31 4 Siegfried Hannig Einschätzung Das diesjährige 28.