Europaschutzgebiet Untere Traun
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Physiotherapeutinnen Ohne Vertrag 2021
HINWEIS: Diese Listen finden Sie auch auf unserer Homepage www.oegk.at (Vertragspartner-Service-Therapeutensuche) PhysiotherapeutInnen ohne Vertrag 2021 Wir erlauben uns Sie darauf hinzuweisen, dass Wahltherapeuten nicht verpflichtet sind uns Änderungen mitzuteilen und die Daten daher nicht immer den letzten Stand entsprechen. BRAUNAU Name Straße Ort TelefonNr. 2. TelefonNr. E-Mail Zusatzausbildungen HB weitere Informationen AUER Harald Braunauerstr. 17 4962 Mining 0664/73069927 [email protected] HB AUGUSTIN Barbara Hofstätterstr. 7 5274 Burgkirchen 0699/11876315 [email protected] MLD HB BARTH Christian Weilhartstraße 40 5121 Ostermiething 06278/7117 0179/1204601 [email protected] MLD BARTOSCH-DICK Ursula Auerbach 18 5222 Auerbach 07747/20030 Erwachsenenbobath HB BAUCHINGER Jürgen Salzburgerstr. 120 5280 Braunau 0676/4622327 [email protected] MLD nein BAUER Christian Leithen 12 4933 Wildenau 0680/3256602 [email protected] HB BEINHUNDNER Silvia Pischelsdorf 56 5233 Pischelsdorf 07742/7075 0650/6680212 [email protected] HB BREITENBERGER Christina Davidstraße 17 5145 Neukirchen 0650/9208214 [email protected] Erwachsenenbobath HB BURGSTALLER Christoph Straussweg 7 5211 Friedburg 0660/3160350 [email protected] HB CHRISTL Birgit Dr. Finsterer Weg 6/2 5252 Aspach 0664/9509960 [email protected] Erwachsenenbobath HB siehe auch Ried/I. DAXER Johannes Rieder Hauptstrasse 42 5212 Schneegattern 0677/63156023 [email protected] MLD, Bindegewebsmass. HB DEMM Tanja Mitterweg 1 5230 Mattighofen 0664/2119110 [email protected] Kinderbobath HB siehe auch Linz Stadt und in Neudorf 22 5231 Schalchen DENK Wiebke Mittererb 5 5211 Friedburg 07746/2795 MLD DENK Gertraud Aham 2 4963 St. Peter/Hart 07722/62666 DENK Daniela Kerschham 26 5221 Lochen 0680/2353433 [email protected] MLD HB siehe auch Ried/I. -

Bezirk Stadt/Gemeinde Sprengel Bezeichnung Des Wahllokales Postleitzahl Adresse Des Wahllokales Beginn Ende Wahlkarten- Lokal WL
WL Wahlkarten- Bezirk Stadt/Gemeinde Sprengel Bezeichnung des Wahllokales Postleitzahl Adresse des Wahllokales Beginn Ende barrierefrei lokal erreichbar Aichkirchen 26, 4671 Wels-Land Aichkirchen 1 4671 07:30 11:30 ja ja Aichkirchen Wels-Land Bachmanning 1 Gemeindeamt 4672 Dorfpl. 5, 4672 Bachmanning 07:30 12:00 ja ja Markt 1, 4654 Bad Wimsbach- Wels-Land Bad Wimsbach-Neydharting 1 Marktgemeindeamt 4654 08:00 12:00 ja ja Neydharting FF Haus Bergham-Kößlwang Haag 32, 4654 Bad Wimsbach- Wels-Land Bad Wimsbach-Neydharting 2 4654 08:00 12:00 ja ja (Fahrzeughalle) Neydharting Mühlenweg 4, 4654 Bad Wels-Land Bad Wimsbach-Neydharting 3 Kindergarten 4654 08:00 12:00 ja ja Wimsbach-Neydharting Seulbergerstr. 2, 4654 Bad Wels-Land Bad Wimsbach-Neydharting 4 VS Wimsbach (Foyer) 4654 08:00 12:00 ja ja Wimsbach-Neydharting Neue Mittelschule Wels-Land Buchkirchen 1 4611 Schulstr. 4, 4611 Buchkirchen 08:00 15:00 ja ja Buchkirchen Neue Mittelschule Wels-Land Buchkirchen 2 4611 Schulstr. 4, 4611 Buchkirchen 08:00 15:00 ja ja Buchkirchen Neue Mittelschule Wels-Land Buchkirchen 4 4611 Schulstr. 4, 4611 Buchkirchen 08:00 15:00 ja ja Buchkirchen Neue Mittelschule Wels-Land Buchkirchen 5 4611 Schulstr. 4, 4611 Buchkirchen 08:00 15:00 ja ja Buchkirchen Landwirtschaftliche Schlossweg 1, 4613 Wels-Land Buchkirchen 3 4613 08:00 15:00 ja ja Fachschule Mistelbach Buchkirchen Hauptstr. 15, 4653 Wels-Land Eberstalzell 1 Gemeindeamt Eberstalzell 4653 07:00 13:00 ja ja Eberstalzell Am Schulberg 2, 4653 Wels-Land Eberstalzell 2 Volksschule Eberstalzell 4653 07:00 13:00 ja ja Eberstalzell Sonnleiten 2, 4653 Wels-Land Eberstalzell 3 Altenheim Eberstalzell 4653 07:00 13:00 ja ja Eberstalzell Zoblstr. -

Militärmusik OÖ
22. Juli bis 8. September 2019 / Ausgabe 6 Das Kulturmagazin der Region Wels Bachmanning • Bad Wimsbach Neydharting • Eberstalzell • Edt bei Lambach • Fischlham • Gunskirchen • Lambach Marchtrenk • Neukirchen bei Lambach • Offenhausen • Pichl bei Wels • Pennewang • Sattledt • Stadl-Paura • Schleißheim Steinerkirchen an der Traun • Sipbachzell • Thalheim bei Wels • Weißkirchen an der Traun • Wels Editorial Sehr geehrte Damen und Herren! Unser Ziel ist es, die maßgebli- Liebe Kulturfreunde che Informations-Drehscheibe für in Wels und Wels Land! Kultur in der Region zu werden. Vielfalt lebt bei uns! Mit unserer Initiative wird Kultur Dieser Satz und dieses Sujet ste- in der Region noch sichtbarer und hen künftig für umfassende Kultur- ein Zugehörigkeitsgefühl und re- information im Bezirk Wels Land. gionales Selbstbewusstsein wird geschaffen. Im Mittelpunkt ste- Was bislang in Wels und Thalheim hen die Region und die Veranstal- „Wels Erlebt“ geheißen hat geht tungen. Diesen wird hier der Vor- nun in „Vielfalt“ auf. zug gegeben, im Wissen, dass die Bewohner der Region mobil, selb- Engagiert in Sachen Kulturmagazin: Von links nach rechts Heidi Strauß, Claudia Huber, Das Projekt einer Kulturzeitung, ständig und eigenverantwortlich Regina Lindt, Stefan Haslinger, Gudrun Pollhammer, Johann Knoll, Andreas Gatterbauer, die 20 Gemeinden und Städte er- ihr individuelles Programm zu- Szilárd Zimányi und Magdalena Hellwagner. fasst und aus Mitteln der Leader- sammenstellen werden. region Wels-Land gefördert wird, ist nach einer Vorlaufzeit von ein- Wir wünschen Ihnen viel Spaß einhalb Jahren Realität geworden. beim Durchblättern, gustieren, aber vor allem beim Besuch einer Wir, der Verein Kultur.Region.Wels der zahlreichen Veranstaltungen und die Stadt Wels sind stolz da- in der Kulturregion Wels. -

Gemeindeliste Sortiert Nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt Am: 21.05.2015 14:29:08
Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt am: 21.05.2015 14:29:08 Gemeinde Gemeinde PLZ des Gemeindename Status weitere Postleitzahlen kennziffer code Gem.Amtes 10101 Eisenstadt 10101 SS 7000 10201 Rust 10201 SS 7071 10301 Breitenbrunn am Neusiedler See 10301 M 7091 10302 Donnerskirchen 10302 M 7082 10303 Großhöflein 10303 M 7051 10304 Hornstein 10304 M 7053 2491 10305 Klingenbach 10305 7013 10306 Leithaprodersdorf 10306 2443 10307 Mörbisch am See 10307 7072 10308 Müllendorf 10308 7052 10309 Neufeld an der Leitha 10309 ST 2491 10310 Oggau am Neusiedler See 10310 M 7063 10311 Oslip 10311 7064 10312 Purbach am Neusiedler See 10312 ST 7083 10313 Sankt Margarethen im Burgenland 10313 M 7062 10314 Schützen am Gebirge 10314 7081 10315 Siegendorf 10315 M 7011 10316 Steinbrunn 10316 M 7035 2491 10317 Trausdorf an der Wulka 10317 7061 10318 Wimpassing an der Leitha 10318 2485 10319 Wulkaprodersdorf 10319 M 7041 10320 Loretto 10320 M 2443 10321 Stotzing 10321 2443 10322 Zillingtal 10322 7034 7033 7035 10323 Zagersdorf 10323 7011 10401 Bocksdorf 10401 7551 10402 Burgauberg-Neudauberg 10402 8291 8292 10403 Eberau 10403 M 7521 7522 10404 Gerersdorf-Sulz 10404 7542 7540 10405 Güssing 10405 ST 7540 7542 10406 Güttenbach 10406 M 7536 10407 Heiligenbrunn 10407 7522 10408 Kukmirn 10408 M 7543 10409 Neuberg im Burgenland 10409 7537 10410 Neustift bei Güssing 10410 7540 10411 Olbendorf 10411 7534 10412 Ollersdorf im Burgenland 10412 M 7533 8292 Q: STATISTIK AUSTRIA 1 / 58 Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand -

Bericht Bezirk Wels Oge
München Stuttgart Forchheim Köln Leipzig Lübeck Ried(A) CIMA Beratung + Management GmbH Johannesgasse 8 4910 Ried i. I. Kaufkraftstrom--- und EinzelhandelsstrukturEinzelhandelsstruktur---- T +43-7752-71117-0 untersuchung OberösterreichOberösterreich----NiederbayernNiederbayern F +43-7752-71117-17 [email protected] Bezirksbericht Wels-Land/-Stadt www.cima.co.at samt besonderer Berücksichtigung der zentralen Handelsstandorte Wels, Gunskirchen, Lambach, Marchtrenk, Sattledt Stadtentwicklung Marketing Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement Immobilien Organisationsberatung Kultur Tourismus Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse OÖ-Niederbayern – Detailbericht Bezirk Wels Land/Stadt Wels Bearbeitungsteam Olga Fedik, MMMScMScScSc Junior Consultant CIMA Austria Mag. Roland MURAUER [email protected] Geschäftsführender Gesellschafter der CIMA Austria [email protected] Weitere involvierte CIMACIMA----MitarbeiterInnen:MitarbeiterInnen: Projektleitung Sandra Baumgarten, CIMA Austria Christina Haderer, CIMA Austria Dipl. GeogrGeogr.. MichaMichaeeeell SEIDEL Mateja Kolar, CIMA Austria Projektleiter CIMA München Maximilian Mayer, CIMA Austria [email protected] Alexander Murauer, CIMA Austria Stefanie Peterbauer, CIMA Austria Co-Projektleitung Natalie Pommer, CIMA Austria Sandra Schwarz, CIMA Austria Ing. Mag. Georg GUMPINGER Helen Störk, CIMA Austria Prokurist der CIMA Austria Diana Wirth, CIMA Austria [email protected] MMMag.Mag. Christian STREITBERGER MSc Junior Consultant CIMA Austria [email protected] 2 -

Gemeinderundschreiben März
Zugestellt durch Post.at Bachmanning, am 25.03.2021 AMTLICHE MITTEILUNG Gemeindeamt Bachmanning GEMEINDEINFORMATION Foto: Gemeinde Bachmanning Wir wünschen allen Bürgern von Bachmanning ein frohes Osterfest und vor allem viel Gesundheit! 1.) Auszug aus der Gemeinderatssitzung 2.) Die Seite des Bürgermeisters 3.) Informationen aus dem Gemeindeamt 4.) Neuigkeiten aus Bachmanning 5.) Gesunde Gemeinde 6.) Historisches aus Bachmanning 7.) Ausschuss für Familie, Schul- und Kindergartenangelegenheiten 8.) Ausschuss für Jugend und Sport 9.) Informationen der Sozialberatungsstelle Lambach 10.) Regionalentwicklungsverband LEWEL 11.) Bezirksabfallverband – neue Informationen 12.) Infos vom Reinhaltungsverband Raum Lambach 1.) Auszug aus der letzten Gemeinderatssitzung Folgende Tagesordnungspunkte wurden einstimmig beschlossen: 1. Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2020 2. Flächenwidmungsplan Nr. 4/2012 - Änderung Nr. 08, Ansuchen um Umwidmung der Parz. 291/2 von derzeit Grünland - LW in Wohngebiet - W – Einleitung des Verfahrens gemäß den Bestim- mungen des § 33 in Verbindung mit § 36Oö. ROG 1994 3. Das Baugrundvergabesystem der Gemeinde Bachmanning 4. Die vorliegenden Darlehensurkunden bzgl. Aufnahme eines Darlehens in Höhe von € 297.400,-- für die Errichtung der Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 (Kobel) und eines Darlehens in Höhe von € 40.500,-- für die Errichtung der Wasserversorgungsanlage BA 07 (Kobel) 5. Auftragsvergabe an die Firma Porr Bau GmbH, 4020 Linz, Arthur-Porr-Straße 2, für die Arbeiten zur Errichtung der Abwasserbeseitigungsanlage-BA 7 (Kobel), zur Errichtung der Wasserversor- gungsanlage-BA 07 (Kobel) sowie für den nicht förderbaren Straßenbau (Kobel) 6. Die Finanzierungsbestätigung für die Errichtung eines Geh- und Radweges Bachmanning Süd 7. Die SATZUNG des Gemeindeverbandes „Haager Lies reloaded“ der Gemeinden 1.Haag am Hausruck, 2.Weibern, 3.Gaspoltshofen, 4.Bachmanning, 5.Aichkirchen, 6.Neukirchen bei Lambach 8. -

OÖ. Landesstraßen (Einschließlich Ergänzungsstraßen) Zum Stichtag 01.01.2021
Amt der Oö. Landesregierung Direktion Straßenbau und Verkehr Abteilung Straßenneubau und -erhaltung 4021 Linz • Bahnhofplatz 1 Tel. +43 732 7720 - 12212 Fax. +43 732 7720 - 212877 Email: [email protected] Straßenverzeichnis OÖ. Landesstraßen (einschließlich Ergänzungsstraßen) zum Stichtag 01.01.2021 © erstellt: BauNE - Ing. Klaus Maier / Tel: 0664 - 60072 12984 / email: [email protected] Amt der OÖ. Landesregierung Linz, im Jänner 2021 Direktion Straßenbau und Verkehr Straßenverzeichnis Abteilung Straßenneubau und -erhaltung zum Stichtag 1.1.2021 Str.Nr. Straßenname Beschreibung - Straßenverlauf Länge (Ergänzungsstraßen) [km] Landesgrenze Niederösterreich, Enns, Kristein, Asten, Linz, Neubau, Marchtrenk, Wels, Edt/Lambach, Lambach, Schwanenstadt, Attnang- B1 Wiener Straße Puchheim, Vöcklabruck, Timelkam, Bierbaum, Mösendorf, 107,721 Frankenmarkt, Landesgrenze Salzburg B1_168_K1 B1, Wiener Straße - Mitterfeld - Kreisverkehr 1 0,037 B1_173_K1 B1, Wiener Straße - Asten - Kreisverkehr 1 0,042 B1_173_B1 B1, Wiener Straße - Asten - Bypass 1 0,031 B1_D173_R1 B1, Wiener Straße - Knoten Asten - Rampe 1 0,136 B1_D173_R2 B1, Wiener Straße - Knoten Asten - Rampe 2 0,129 B1_D173_R3 B1, Wiener Straße - Knoten Asten - Rampe 3 0,123 B1_D173_R4 B1, Wiener Straße - Knoten Asten - Rampe 4 0,135 B1_179_K1 B1, Wiener Straße - Mona Lisa-Tunnel - Kreisverkehr 1 0,024 B1_184_G1 B1, Wiener Straße - Kreuzung Wiener-/Salzburger Straße - Einbahn, Richtungsfahrbahn 1 0,076 B1_186_G1 B1, Wiener Straße - Knoten A7/Salzburger Straße - Einbahn, Richtungsfahrbahn -
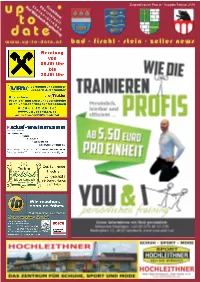
Ein Fischlham V.L.N.R
Zugestellt durch Post.at - Ausgabe Februar 2019 up-to--date news Wir haben uns zum Ziel ge- setzt, interessante Informa- tionen von unseren schönen Heimatgemeinden Bad Wimsbach-Neydhar- ting, Eberstalzell, Edt bei Lambach, Fischlham, Lam- bach, Stadl-Paura, Steiner- kirchen an der Traun und Umgebung der Bevölke- rung mitzuteilen. Weiters haben wir unseren Unternehmen die Möglich- keit geschaffen, sich mit ihren Produkten und Dienst- Redaktionsschlüsse und Erscheinungster- leistungen zu präsentieren. Bitte informieren Sie uns mine für die nächsten Ausgaben und senden Sie einfach Ihre bad - fischl - stein - zeller news news from edt - lambach - stadl-paura Fotos in bester Qualität und Beiträge in Microsoft Word an: Erscheinungstermine 2019/2020 Erscheinungstermine 2019/2020 [email protected] Ausgabe 2/2019 Anfang April Ausgabe 2/2019 Anfang März Ausgabe 3/2019 Anfang Juni Ausgabe 3/2019 Anfang Mai Impressum Ausgabe 4/2019 Anfang August Ausgabe 4/2019 Anfang Juli Herausgeber, Herstellung Ausgabe 5/2019 Anfang Oktober Ausgabe 5/2019 Anfang September und Redaktion Ausgabe 6/2019 Anfang Dezember Ausgabe 6/2019 Anfang November Ausgabe 1/2020 Anfang Februar Ausgabe 1/2020 Anfang Jänner Das Team von up-to-date Josef Stinglmayr und Maria Brandstätter Am Federbühel 10 ACHTUNG! Der Anzeigenschluss für die einzelnen Ausgaben ist immer ca. 1 Monat vorher. 4652 Steinerkirchen Tel.: (07241) 2128 [email protected] Anzeigenverkauf Werbung & EDV up-to-date Zeitung ist bereits Tradition Josef Stinglmayr Am Federbühel 10 4652 Steinerkirchen Seit 13 Jahren schaffen wir mit unseren Zeitungen nun die Möglichkeit für Firmen, Vereine und Tel.: (07241) 2128 Gruppierungen ihre Produkte, Dienstleistungen und Aktivitäten zu präsentieren. -

Vorläufiger Stellungsplan Oberösterreich
Vorläufiger Stellungsplan des Militärkommandos OBERÖSTERREICH Geburtsjahrgang 2003 Bitte beachten Sie Folgendes: 1. Für den Bereich des Militärkommandos Oberösterreich werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungskommission Oberösterreich, Garnisonstraße 36, 4018 Linz der Stellung unterzogen. Das Stellungsverfahren nimmt in der Regel 1 1/2 Tage in Anspruch. 2. Die Stellungspflichtigen haben sich bis 0600 des Stellungstages im Stellungshaus einzufinden, können aber, wenn es aus verkehrstechnischen Gründen zwingend erforderlich ist, schon am Vorabend bis 2100 Uhr erscheinen (für Unterkunft im Stellungshaus ist gesorgt). Aufgrund der aktuellen COVID-Lage wird empfohlen, erst am Stellungstag anzureisen. 3. Zur Überprüfung der Identität und Staatsbürgerschaft sind mitzubringen: Amtlicher Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis der Republik Österreich, Führerschein usw.), eigener Staatsbürgerschaftsnachweis (entfällt bei Vorlage von Reisepass oder Personalausweis der Republik Österreich), bei Doppelstaatsbürgerschaft ein entsprechender Nachweis, Geburtsurkunde, E-Card, eventuell Heiratsurkunde. 4. Zur Beurteilung des Gesundheitszustandes sind mitzunehmen: Eventuell vorhandene ärztliche Atteste (hierfür besteht kein Anspruch auf Kostenvergütung) sowie der ausgefüllte und unterschriebene medizinische Fragebogen, falls er dem Stellungspflichtigen zugestellt wurde. 5. Zur Beurteilung des Ausbildungsstandes ist mitzunehmen: Eine gültige Schulbestätigung bzw. ein gültiger Lehrvertrag. 6. Bei Vorliegen besonders schwerwiegender Gründe besteht -

OBERÖSTERREICH 1. Teil
Historisches Ortslexikon Statistische Dokumentation zur Bevölkerungs- und Siedlungsgeschichte OBERÖSTERREICH 1. Teil Statutarstädte (Linz, Steyr, Wels), Braunau am Inn, Eferding, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land Datenbestand: 31.8.2016 1 OBERÖSTERREICH Um 780: etwa 230 nachgewiesene Althöfe und Altsiedlungen. – Um 1000: 100-150.000 E, vor 1350: 300.000. - 1527: *60.000-335.000 (korrigiert: *315.000 E), *1550: 352.000, *1600: 380.000 E, *1700: 450.000, 1754: 540.000, 1780: 97.896 H, 1781: 609.069, 1782: 98.272- 611.312, 1783: 613.876, 1784: 99.033-621.333, 1785: 99.347-619.220, 1786: 619.220, 1787: 99.949-624.636 (anw. 625.251), 1788: 622.830, 1789: 620.000, 1792: 637.292, 1798: 628.739, 1800: 102.977-629.945, 1805: 102.546-646.619, 1806: 102.713-631.818, 1807: 102.647-625.867 (anw. 625.217), 1808: 102.697-630.883, 1817: 102.491-637.009, 1818: 102.648-639.229, 1819: 102.689-645.271, 1820: 102.738-649.998, 1821: 651.911, 1824: 668.910, 1827: 103.558-681.705, 1830: 104.106-682.140, 1831: 688.668, 1834: 104.692- 689.659, 1837: 105.214-693.149 (anw. 697.119, mit Militär 703.900), 1840: 699.324, 1843: 106.476-705.489, 1846: 107.119-702.559 (anw. 713.005), 1851: 107.870-688.848 (anw. 706.316), 1857: 109.106-688.294 (anw. 707.450), 1869: 110.510-736.856, 1880: 114.544- 760.091, 1890: 115.742-786.496, 1900: 118.139-810.854, 1910: 122.634-853.595, 1923: 124.494-876.698, 1934: 132.457-902.965, 1939: 927.583, 1951: 150.518-1,108.720, 1961: 180.788-1,131.623, 1971: 216.880-1,229.972, 1981: 269.652-1.269.540, 1991: 307.850- 1,333.480, 2001: 352.326-1,376.607, 2011: 383.429-1,413.762, 2012: 1,418.498, 2013: 1,425.422, 2014: 1,437.251, 2015: 1,453.948, 6/2016: 1,460.575. -

Traumhaft Reiten
Region Wels-Land ZIELSETZUNGEN: Region Vöckla-Ager Traunsteinregion ➢ Schaffung von „geordneten Verhältnissen“ in den Regionen – Nutzungsvereinbarungen zwischen Interessengruppen ➢ Anbindung des Reitwegenetzes an die angrenzenden Regionen Traumhaft ➢ Verbindung von bestehenden Pferdehöfen, Gasthöfen und Jausensta/onen Stark verwurzelt in der Region ➢ Vermarktung des Wegenetzes in Koopera/on Mit über 400 Bankstellen in Oberösterreich sind wir stark ver- Reiten wurzelt und stehen für Stabilität, Kompetenz und Kundenorien- mit den Tourismusverbänden tierung. Dabei setzen wir auf eine nachhaltige Strategie und sind sicher, verlässlich und nahe bei unseren Kunden. ➢ San er Tourismus: Reiten, Wandern, Radfahren www.raiffeisen-ooe.at .com/raiffeisenooe ➢ Zugewinn an Wertschöpfung ➢ Wesentliches Element der Landscha spflege durch Landnutzung ZIELGRUPPEN: LEMA makes the world go clean ➢ Bewohner der Regionen und Urlaubsgäste, Zur Landesausstellung in Stadl-Paura im Jahr 2016 soll die mit dem eigenen Pferd oder Leihpferden das Reitwegenetz im vollen Umfang ausgebaut sein. die Landscha genießen möchten Obfrau Dr. Andrea Holzleithner, Tel. 0 67 6/ 49 44 077 p.A. Pferdezentrum Stadl-Paura ➢ Wanderreiter Stallamtsweg 1, 4651 Stadl-Paura [email protected] www.traunreiter.at ➢ Ansässige Reitställe I I I R G N U B R E W V I T K A E R K LEADER-REGION VÖCKLA-AGER: o vieles wächst und gedeiht, da kann auch etwas A0nang-Puchheim - Atzbach - Desselbrunn zusammenwachsen - um dann gemeinsam weiterzuwachsen! Lenzing - Niederthalheim Oberndorf bei Schwanenstadt - Pilsbach WUnter diesem Mo0o sind es die starken, beliebten Reit- Pitzenberg - Pühret - Redlham - Regau regionen Wels-Land, Vöckla-Ager und die Traunsteinregion, Rüstorf - Rutzenham - Schla0 die sich verknüpfen. Ein paradiesisches Wegenetz entsteht Schwanenstadt - Timelkam - Vöcklabruck dadurch in einer atemberaubenden Landscha . -

Unbewegliche Und Archäologische Denkmale Unter Denkmalschutz
Oberösterreich unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz 21.06.2016 (rechtlich nicht verbindlich) Gemeinde KG Bezeichnung Adresse GdstNr Status Bad-Haller-Straße Adlwang 49001 Adlwang Pfarrhof 6 .21/1 § 2a Kath. Filialkirche, Wallfahrtskirche St. Grünburger Straße Adlwang 49001 Adlwang Blasien 117 .66 § 2a Mesnerhaus, Grünburger Straße Adlwang 49001 Adlwang Blasenhaus 119 .65 § 2a Kath. Pfarrkirche, Wallfahrtskirche Sieben Schmerzen Adlwang 49001 Adlwang Mariä Kirchenplatz 1 .1 § 2a Adlwang 49001 Adlwang Pfarrheim Kirchenplatz 10 .10 § 2a Mandorfer Strasse Adlwang 49001 Adlwang Kapelle hl. Brunnen 19, nahe .15 § 2a Ahorn 47302 Ahorn Ruine Piberstein Piberstein 1 .12 Bescheid Kath. Pfarrkirche hll. Peter und Paul mit Aichkirchen 51101 Aichkirchen Friedhof Aichkirchen .130, 582/1 § 2a Aichkirchen 51101 Aichkirchen Pfarrhof Aichkirchen 1 .136 § 2a Aigen im Kalvarienbergkapelle Mühlkreis 47001 Aigen mit Kreuzweg Aigen 2929/1 Bescheid Aigen im Mühlkreis 47001 Aigen Pfarrhof Hauptstraße 14 1213 § 2a Aigen im Kath. Filialkirche hl. Mühlkreis 47001 Aigen Martin Hauptstraße 15 1050 § 2a Aigen im Mühlkreis 47001 Aigen Amtsgebäude Kirchengasse 4 .80 § 2a Kath. Pfarrkirche hl. Aigen im Johannes Mühlkreis 47001 Aigen Evangelista Marktplatz 1155/1 § 2a Aigen im Mühlkreis 47001 Aigen Brunnen Marktplatz 2860/1 § 2a Aigen im Mühlkreis 47001 Aigen Mariensäule Marktplatz 2860/1 § 2a Aigen im Mühlkreis 47001 Aigen Bürgerhaus Marktplatz 13, 13a .20/2; .20/1 Bescheid Aigen im Mühlkreis 47001 Aigen Ackerbürgerhaus Marktplatz 25 1119 Bescheid Aigen im Mühlkreis 47001 Aigen Bürgerhaus Marktplatz 6 .65 Bescheid Aigen im Mühlkreis 47001 Aigen Bildstock Schlossergasse 2860/21 § 2a Wasserschloss 23, 24/1, 24/2, 98, .1, .2, .3, .4, .5, Aistersheim 44102 Aistersheim Aistersheim Aistersheim 1, 2, 3 .8/1, .8/2 Bescheid Pfarrhof, ehem.