Medien in Konflikten Grewenig / Jäger
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UID 1987 Nr. 12, Union in Deutschland
CDU-Informationsdienst Union in Deutschland Bonn, den 2. April 1987 12/87 Heiner Geißler: Brandts Rücktritt ist der Ausdruck einer Führung^ und Programmkrise der SPD % Brandts Rücktritt ist die logische Konse- silt1^ aus der Zerstrittenheit und Richtungslo- HEUTE AKTUELL . gkeit der deutschen Sozialdemokratie. Wegen I .res Anpassungskurses gegenüber den Grünen SBrandt und der SPD nicnt • Debatte zur Dnr - gelungen, eine Regierungserklärung j "tische Alternative in der Opposition aufzu- Unsere Argumente gegen falsche Behauptungen und ,erdlngs ist nicht damit zu rechnen, daß die deut- Tatsachenverdrehungen von s SPD und Grünen, 2u . Sozialdemokraten nach dem Rücktritt Brandts ab Seite 3 . einem Kurs der Konsolidierung finden und einen le Zur Regierungserklärung des dJ rparteilichen Klärungsprozeß herbeiführen wer- pro rarnmat sc Bundeskanzlers gibt es ein M h 8 i hen Aussagen des SPD- „CDU-extra" und eine Bro- Sch heitsflügels um 0skar Lafontaine, Gerhard schüre. undr0der' Erhard EpP'er und Hans-Ulrich Klose Seite 37 . d die personellen Weichenstellungen der letzten ^onate lassen nicht erwarten, daß die SPD den • Öffentlichkeitsarbeit e8 zurück zur Volkspartei des Godesberger Pro- Am 19. April 1967 starb Konrad Adenauer. Aus diesem Anlaß ems finden wird. möchten wir den CDU-Verbän- * Ende der Ära Brandt befindet sich die SPD in den einige Anregungen geben. j em Zustand der Zerrüttung und des Niedergangs. Seite 38/39 6reSSe einer funktionsfani en muR 8 Demokratie • Register '86 sichr 6 SPD Jetzt inre Kräfte darauf konzentrieren, Das Stichwortregister — ein un- tis h'11 der °PP°sition personell und programma- ZU re e entbehrlicher Helfer für alle z£ 8 nerieren. Dieser Prozeß braucht viel UiD-Leser. -

Continuity Within Change: the German-American Foreign and Security Relationship During President Clinton’S First Term”
“Continuity within Change: The German-American Foreign and Security Relationship during President Clinton’s First Term” Dissertation zur Erlangung des Grades Dr. phil. bei dem Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin vorgelegt von Thorsten Klaßen Berlin 2008 Erstgutachter: Prof. Dr. Eberhard Sandschneider Zweitgutachter: Priv.-Doz. Dr. Peter Rudolf Datum der Disputation: 10.12.2008 2 Table of Contents Abbreviations ............................................................................................................................. 6 Introduction ................................................................................................................................ 7 A Note on Sources .................................................................................................................... 12 I. The United States After the End of the Cold War ................................................................ 13 I.1. Looking for the Next Paradigm: Theoretical Considerations in the 1990s.................... 13 I.1.1 The End of History ................................................................................................... 13 I.1.2 The Clash of Civilizations ....................................................................................... 15 I.1.3 Bipolar, Multipolar, Unipolar? ................................................................................ 17 I.2. The U.S. Strategic Debate ............................................................................................. -

RG04 Interior.Qxd
Gernika y Alemania Historia de una reconciliación Michael Kasper RED gERnika bakeaz gernika gogoratuz Gernika y Alemania Historia de una reconciliación Esta investigación ha sido patrocinada por Gernika Gogoratuz en colaboración con el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y la Dirección General IA Derechos Humanos y Democratización de la Comisión Europea. COMISIÓN EUROPEA Dirección General IA Relaciones Exteriores: Europa y Nuevos Estados Independientes, Política Exterior y de Seguridad Común, Servicio Exterior Dirección A - Relaciones Multilaterales Derechos humanos y democratización Gernika y Alemania Historia de una reconciliación Michael Kasper Colección Red Gernika Director de la colección: Juan Gutiérrez © Michael Kasper, 1998 © Bakeaz, 1998 Avda. Zuberoa, 43-bajo • 48012 Bilbao Tel. 94 4213719 • Fax 94 4216502 E-mail: [email protected] © Gernika Gogoratuz, 1998 Artekale, 1 • 48300 Gernika-Lumo Tel. 94 6253558 • Fax 94 6256765 E-mail: [email protected] http: // www.sarenet.es /gernikag ISBN: 84-88949-27-8 Depósito legal: BI-719-98 Índice Presentación de Gernika Gogoratuz 9 Prólogo del Alcalde-Presidente de Gernika-Lumo 11 Introducción 13 I. Reconciliación 19 II. La restitución de los damnificados por los crímenes nazis 21 III. La superación del pasado alemán 27 IV. La Comisión Gernika 35 V. Petra Kelly y el Centro de Investigación por la Paz 45 VI. El ejército alemán y el ‘Guernica’ de Picasso 55 VII. El hermanamiento entre Gernika y Pforzheim 57 VIII. El Proyecto Gernika 65 IX. La Iniciativa Contra el Olvido 77 X. Gernika Gogoratuz y el mensaje del presidente alemán 81 XI. Conclusiones 87 Notas 91 Bibliografía básica 99 7 Presentación ernika Gogoratuz tiene la misión de hacer aportaciones al G símbolo de Gernika, para lo cual acordó con la catedrática de Historia Contemporánea Mª Jesús Cava Mesa que realizase un tra - bajo de investigación que se publicó en el año 1996 con el título Memoria colectiva del bombardeo de Gernika . -

Introduction: the Nuclear Crisis, NATO's Double-Track Decision
Introduction Th e Nuclear Crisis, NATO’s Double-Track Decision, and the Peace Movement of the 1980s Christoph Becker-Schaum, Philipp Gassert, Martin Klimke, Wilfried Mausbach, and Marianne Zepp In the fall of 1983 more than a million people all across West Germany gathered under the motto “No to Nuclear Armament” to protest the imple- mentation of NATO’s Double-Track Decision of 12 December 1979 and the resulting deployment of Pershing II and cruise missiles in West Germany and other European countries.1 Th e media overfl owed with photos of human chains, sit-in blockades, and enormous protest rallies. Th e impressive range of protest events included street theater performances, protest marches, and blockades of missile depots. During the fi nal days of the campaign there were huge mass protests with several hundred thousand participants, such as the “Fall Action Week 1983” in Bonn on 22 October and a human chain stretching about 108 km from Ulm to Stuttgart. It seemed as if “peace” was the dominant theme all over Germany.2 Despite these protests, the West German Bundestag approved the missile deployment with the votes of the governing conservative coalition, thereby concluding one of the longest debates in German parliamentary history.3 A few days later the fi rst of the so-called Euromissiles were installed in Mut- langen, near Stuttgart, and in Sigonella, on the island of Sicily.4 Th e peace movement had failed to attain its short-term political aim. However, after a brief period of refl ection, the movement continued to mobilize masses of people for its political peace agenda. -

The 'General Staff' for a Hot Autumn in Western Europe, and Who's
Click here for Full Issue of EIR Volume 10, Number 36, September 20, 1983 introduction. of Eastern values of this sort against the Judeo Christianrationalism of Schiller's and Humboldt's Germany. The Moscow clearance to order the shooting -down of the Korean airliner is a characteristic expression of a world outlook akin to the Nazis' Nietzschean philosophy of the Triumph of the Will, the anti-rationalist conception of Will associated with William of Ockham, Bernard of Clairvaux, and others. To deal with the West by display of a terrifying exertion of the Russian Will, is the essence of the airliner incident. The 'general staff' for a It was a Hitler-like expression in foreign-policy, a char acteristically brutal expression of a "Third Rome" state of mind. in Western Europe, and It is the same state of mind which prompts the Soviet command to deem a beast as morally and mentally depraved Jo Leinen, a leader of the German "peace movement" and as Khomeini to impose its "dark age" upon the people of Iran, speaker of the BB V environmentalist association, announced to unleash Qaddafi against the nations and peoples of Africa. last October that "the Federal Republic should be made un It is that same wicked state of mind which prompts the Soviet governable" if necessary to stop deployment of U.S. Persh leadership to adopt the cause of the forces of a new dark age ing II and cruise missiles. A year later, the peace movement in Germany, the Green Party, and which brings Soviet asset is efficiently organized to accomplish this goal. -
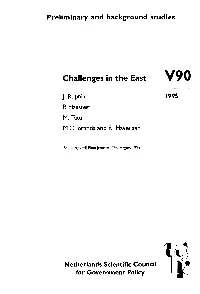
Challenges in the East V90
Preliminary and background studies Challenges in the East V90 1. Rupnik 1995 I?Hassner M. Tatu M.C. Brands and R. Havenaar Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, The Hague, 1995 Netherlands Scientific Council for Government Policy CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Challenges Challenges in the East 1 J. Rupnik, P. Hassner, M. Tatu, M.C. Brands and R. Havenaar. - The Hague : Sdu Uitgeverij Plantijnstraat. - (Preliminary and Background Studies I Netherlands Scientific Council for Government Policy, ISSN 0169-5688 ; V 90) ISBN 90-399-0899-0 Trefw.: vrede en veiligheid ; Europa. Preface One of the most daunting challenges of Europe in the immediate future is to overcome the consequences of the unnatural division of Western and Eastern Europe in separate geopolitical spheres, without relapsing into older, histori- cal patterns of division between East and West. In preparation of its report 'Stabiliteit en veiligheid in Europa' to the government on Dutch foreign policy in coming years, the Scientific Council has commissioned a number of studies and analyses on developments in Eastern and Central Europe that are inclu- ded in the present publication. A discussion on the future of Europe without due regard to developments in Russia is unthinkable. This aspect is covered by an analysis on future deve- lopments in Russia by Michel Tatu, a well-known expert in this field. Two studies deal with the situation and developments in Central Europe and the Balkans. Jacques Rupnik, author of 'The other Europe', provided us with a lucid analysis of the political situation in Central Europe and its implications for the European Union. Pierre Hassner contributed an analysis of the most complex region of Europe, the Balkans. -

Rechtsextremismus Und Antifaschismus Herausgegeben Von Klaus Kinner Und Rolf Richter
Rechtsextremismus und Antifaschismus herausgegeben von Klaus Kinner und Rolf Richter 1 Schriften 5 herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen e. V. und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e. V. 2 Rechtsextremismus und Antifaschismus Historische und aktuelle Dimensionen herausgegeben von Klaus Kinner und Rolf Richter Karl Dietz Verlag Berlin 3 Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Rechtsextremismus und Antifaschismus : historische und aktuelle Dimensionen / hrsg. von Klaus Kinner und Rolf Richter. – Berlin : Dietz, 2000 (Schriften / Rosa-Luxemburg-Stiftung ; Bd. 5) ISBN 3-320-02015-3 © Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2000 Umschlag: Egbert Neubauer, MediaService Fotos: Gabriele Senft, Berlin Typografie: Brigitte Bachmann Satz: MediaService, Berlin Druck und Bindearbeit: BärenDruck, Berlin Printed in Germany 4 INHALT Editorial 7 WERNER BRAMKE Antifaschistische Tradition und aktueller Antifaschismus 8 ROLF RICHTER Über Theoretisches und Praktisches im heutigen Antifaschismus 14 KLAUS KINNER Kommunistischer Antifaschismus – ein schwieriges Erbe 45 ANDRÉ HAHN Zum Umgang mit Rechtsextremen in den Parlamenten 52 NORBERT MADLOCH Rechtsextremismus in Deutschland nach dem Ende des Hitlerfaschismus 57 Vorbemerkung 58 Rechtsextremistische Tendenzen und Entwicklungen in der DDR, speziell in Sachsen, bis Oktober 1990 63 Hauptetappen der Entwicklung des Rechtsextremismus in den alten Bundesländern bis zur deutschen Vereinigung 1990 106 Zur Entwicklung des Rechtsextremismus im geeinten Deutschland 1990 bis 1990 – besonders in den neuen Bundesländern 146 Ursachen und Perspektiven des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik 206 ROLAND BACH Zur nationalen und sozialen Demagogie der extremen Rechten 215 5 Anhang 251 NORBERT MADLOCH Lexikalische Erläuterungen zu den im Rechtsextremismus-Teil verwandten Hauptbegriffen 252 Rechtsextremismus 253 Rechtsradikalismus = Grauzone 255 Rechtspopulismus 256 Faschismus/Nazismus – Neofaschismus/Neonazismus 257 Neue Rechte 261 Rassismus 264 Ausländer- bzw. -

Der Verein Deutsche Sprache
1 Bamberger Beiträge zur Linguistik Der Verein Deutsche Sprache Hintergrund, Entstehung, Arbeit und Organisation eines deutschen Sprachvereins von Karoline Wirth UNIVERSITY OF BAMBERG PRESS Bamberger Beiträge zur Linguistik 1 Bamberger Beiträge zur Linguistik hrsg. von Thomas Becker, Martin Haase, Sebastian Kempgen, Manfred Krug und Patrizia Noel Aziz Hanna Band 1 University of Bamberg Press 2010 Der Verein Deutsche Sprache Hintergrund, Entstehung, Arbeit und Organisation eines deutschen Sprachvereins von Karoline Wirth University of Bamberg Press 2010 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Informationen sind im Internet über http://dnb.ddb.de/ abrufbar Diese Arbeit hat der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften der Otto-Friedrich- Universität als Dissertation vorgelegen 1. Gutachter: Prof. Dr. Helmut Glück 2. Gutachter: PD Dr. Friederike Schmöe Tag der mündlichen Prüfung: 2. Juli 2009 Dieses Werk ist als freie Onlineversion über den Hochschulschriften- Server (OPUS; http://www.opus-bayern.de/uni-bamberg/) der Universitätsbibliothek Bamberg erreichbar. Kopien und Ausdrucke dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden. Herstellung und Druck: docupoint GmbH, Magdeburg Umschlaggestaltung: Dezernat Kommunikation und Alumni © University of Bamberg Press Bamberg 2010 http://www.uni-bamberg.de/ubp/ ISSN: 2190-3298 ISBN: 978-3-923507-65-8 eISBN: 978-3-923507-66-5 URN: urn:nbn:de:bvb:473-opus-2415 Danksagung Herzlicher Dank geht an Prof. Dr. Helmut Glück, der diese Arbeit be- treut hat, und an PD Dr. Friederike Schmöe, meine Zweitgutachterin. Danken möchte ich auch Prof. Dr. Walter Krämer, der mir für die Re- cherchen seine Archive zur Verfügung gestellt hat und mir erlaubt hat, alle Materialien auch zu verwenden. -

Executive Intelligence Review, Volume 12, Number 16, April 23, 1985
There's a Renaissance Beginning Under the Dome... In Leesburg} \h. The beautiful bookstore and domed recital hall of Ben Franklin Booksellers, Inc. in Leesburg (25 miles west of Washington, D.C.) is fast emerging as the center of a cultural and scientific revolution in America. The book collection is hand picked to bring you hard-to-find classics at reasonable prices. The children's books section is widely acclaimed. The bookstore hosts regular musical events, poetry recitations, and other cultural activities. Among our featured selections: o PLATO--The Collected Dialogues. $2l. 00 o DANTE-The Divine Comedy (translations by Mandelbaum and Ciardi). Three volumes for $9.50 o NICOLAUS OF CUSA-The Vision of God and The Layman. Two volumes for $23.95 o LEONARDO DA VINCI-Notebooks of Leonardo da Vinci. Two-volume set for $19.90 o FRIEDRICH SCHILLER-A collection of plays and prose writings (includes Don Carlos; Naive and Sentimental Poetry and On the Sub lime; An Anthology for Our Time; The Bride of Messina, Wilhelm Tell and Demetrius; The Robbers and Wallenstein; Mary Stuart and The Maid of Orleans). Six volumes for $36.00 o GEORGE WASHINGTON-The Life of George Washington, by Washington Irving. $19.95 o HENRY CAREY-The Harmony of Interests. $22.50 o LYNDON LAROUCHE-A collection of writings (includes So, You Wish to Learn All About Economics; There Are No Limits to Growth; and LaRouche, Will This Man Become President?). Three volumes for $19.85 o FUSION ENERGY FOUNDATION-Beam Defense: An Alter native to Nuclear Destruction. $ 7.95 Special discount for EIR readers: take 10% off for orders of $25 or more. -
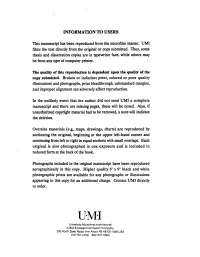
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Z eeb Road. Ann Arbor. Ml 48 1 0 6 -1 3 4 6 USA 313/761-4700 800/521-0600 Order Number 0201757 German writers and the Intermediate-range Nuclear Forces debate in the 1980s Stokes, Anne Marie, Ph.D. -

06 Hevop 111-131
g7.217,1(16D]ÔM - pV-HOHQNRUL(J\HWHPHV7|UWpQHWL7DQV]pNWXGRPiQ\RVN|]OHPpQ\HL1 o 2014/2. ELTE, BUDAPEST, 2017. +HYĞ3pWHU Å$KDOiOH[SRUWĞUHLµ (J\QpPHWIHJ\YHUERWUiQ\DPiVRGLNgE|O²KiERU~LGHMpQ Abstract A half year after the invasion of Kuwait, in the night of 18 January 1991 eight Iraqi Scud missiles hit the Israeli cities, Tel Aviv and Haifa. Although the caused damage was relatively limited, the attack had intense psycho- logical impact in Israel. Moreover Saddam Hussein made threats to use bi- nary chemical weapons against the Jewish state to provoke a military re- sponse, in order to unleash an Arab-Israeli conflict. The case launched a wave of indignation in the reunited Germany, because it turned out, that most of the missiles with poison-gas and biological warheads were made with the help of West ²German engineers and technology. Chemical weap- ons produced by German scientists against Israel? Due to this scandalous scenario *HUPDQSROLWLFLDQVKDGWRVHFXUH,VUDHO·VLQWHJULW\E\WUDQVSRUWLQJ for Tel Aviv material help. The Iraqi attack also affected the so-calle GÅRXW - of-DUHDµ -debate in Bonn, that means the discussion about German military handling of conflicts outside the North Atlantic area. Keywords: Germany, Bundeswehr, out-of-area, Israel, Iraq, Gulf war. el ²$YLYpV+DLIDODNyLMDQXiU -iQDNKDMQDOiQNLVHEE UREEDQiVRN]DMiUDpEUHGWHN$]D]RQQDOL KHO\V]tQHOpVVRUiQ T NLGHUOW KRJ\ QHP ERPEiN SXV]WtWRWWDN D] HPOtWHWW Yi rosokban, hanem nyolc iraki Scud- UDNpWD FVDSyGRWW EH A ÅFVRPDJµ fel DGyMD6]DGGiP+XVV]HLQ volt. A FtP]HWWHNN|]|WW nem csak Izrael -

Jan Hansen Abschied Vom Kalten Krieg? Schriftenreihe Der Vierteljahrshefte Für Zeitgeschichte Band 112
Jan Hansen Abschied vom Kalten Krieg? Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte Band 112 Im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München – Berlin herausgegeben von Helmut Altrichter Horst Möller Andreas Wirsching Redaktion: Johannes Hürter und Thomas Raithel Abschied vom Kalten Krieg? Die Sozialdemokraten und der Nachrüstungsstreit (1977–1987) Von Jan Hansen ISBN 978-3-11-044684-5 e-ISBN (PDF) 978-3-11-044930-3 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-044718-7 ISSN 0506-9408 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston Titelbild: Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt mit Friedensaktivisten am 20. Oktober 1984 in seinem Wohnort Unkel am Rhein anlässlich einer Großkundgebung im nahen Bonn; J. H. Darchinger/Fried- rich-Ebert-Stiftung Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen ♾ Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com V Inhalt Vorwort ..................................................... VII Einleitung: Wie wirkmächtig war der „Kalte Krieg“? ............. 1 I. Der Streit um die Atomraketen ............................. 13 1. Kontinuität oder Bruch? Chronologische Orientierungen .......... 13 2. Darf der Friede militärisch erzwungen werden? .................. 26 3. Die sozialdemokratische Krisenerzählung ...................... 31 4. Angst vor dem Atomtod ................................... 37 5. Die Beharrungskraft der Fortschrittsidee ....................... 45 II. Der Kalte Krieg auf dem Prüfstand .......................... 53 1. Gemeinsam überleben: Ost-West und Nord-Süd ................. 53 2. Wege aus der Blockkonfrontation ............................ 68 3. „Das Ost-West-Zeitalter ist zu Ende“ .........................