View/Open (3.9MB)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

France and the Dissolution of Yugoslavia Christopher David Jones, MA, BA (Hons.)
France and the Dissolution of Yugoslavia Christopher David Jones, MA, BA (Hons.) A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of East Anglia School of History August 2015 © “This copy of the thesis has been supplied on condition that anyone who consults it is understood to recognise that its copyright rests with the author and that use of any information derived there from must be in accordance with current UK Copyright Law. In addition, any quotation or extract must include full attribution.” Abstract This thesis examines French relations with Yugoslavia in the twentieth century and its response to the federal republic’s dissolution in the 1990s. In doing so it contributes to studies of post-Cold War international politics and international diplomacy during the Yugoslav Wars. It utilises a wide-range of source materials, including: archival documents, interviews, memoirs, newspaper articles and speeches. Many contemporary commentators on French policy towards Yugoslavia believed that the Mitterrand administration’s approach was anachronistic, based upon a fear of a resurgent and newly reunified Germany and an historical friendship with Serbia; this narrative has hitherto remained largely unchallenged. Whilst history did weigh heavily on Mitterrand’s perceptions of the conflicts in Yugoslavia, this thesis argues that France’s Yugoslav policy was more the logical outcome of longer-term trends in French and Mitterrandienne foreign policy. Furthermore, it reflected a determined effort by France to ensure that its long-established preferences for post-Cold War security were at the forefront of European and international politics; its strong position in all significant international multilateral institutions provided an important platform to do so. -

UID 1987 Nr. 12, Union in Deutschland
CDU-Informationsdienst Union in Deutschland Bonn, den 2. April 1987 12/87 Heiner Geißler: Brandts Rücktritt ist der Ausdruck einer Führung^ und Programmkrise der SPD % Brandts Rücktritt ist die logische Konse- silt1^ aus der Zerstrittenheit und Richtungslo- HEUTE AKTUELL . gkeit der deutschen Sozialdemokratie. Wegen I .res Anpassungskurses gegenüber den Grünen SBrandt und der SPD nicnt • Debatte zur Dnr - gelungen, eine Regierungserklärung j "tische Alternative in der Opposition aufzu- Unsere Argumente gegen falsche Behauptungen und ,erdlngs ist nicht damit zu rechnen, daß die deut- Tatsachenverdrehungen von s SPD und Grünen, 2u . Sozialdemokraten nach dem Rücktritt Brandts ab Seite 3 . einem Kurs der Konsolidierung finden und einen le Zur Regierungserklärung des dJ rparteilichen Klärungsprozeß herbeiführen wer- pro rarnmat sc Bundeskanzlers gibt es ein M h 8 i hen Aussagen des SPD- „CDU-extra" und eine Bro- Sch heitsflügels um 0skar Lafontaine, Gerhard schüre. undr0der' Erhard EpP'er und Hans-Ulrich Klose Seite 37 . d die personellen Weichenstellungen der letzten ^onate lassen nicht erwarten, daß die SPD den • Öffentlichkeitsarbeit e8 zurück zur Volkspartei des Godesberger Pro- Am 19. April 1967 starb Konrad Adenauer. Aus diesem Anlaß ems finden wird. möchten wir den CDU-Verbän- * Ende der Ära Brandt befindet sich die SPD in den einige Anregungen geben. j em Zustand der Zerrüttung und des Niedergangs. Seite 38/39 6reSSe einer funktionsfani en muR 8 Demokratie • Register '86 sichr 6 SPD Jetzt inre Kräfte darauf konzentrieren, Das Stichwortregister — ein un- tis h'11 der °PP°sition personell und programma- ZU re e entbehrlicher Helfer für alle z£ 8 nerieren. Dieser Prozeß braucht viel UiD-Leser. -

Continuity Within Change: the German-American Foreign and Security Relationship During President Clinton’S First Term”
“Continuity within Change: The German-American Foreign and Security Relationship during President Clinton’s First Term” Dissertation zur Erlangung des Grades Dr. phil. bei dem Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin vorgelegt von Thorsten Klaßen Berlin 2008 Erstgutachter: Prof. Dr. Eberhard Sandschneider Zweitgutachter: Priv.-Doz. Dr. Peter Rudolf Datum der Disputation: 10.12.2008 2 Table of Contents Abbreviations ............................................................................................................................. 6 Introduction ................................................................................................................................ 7 A Note on Sources .................................................................................................................... 12 I. The United States After the End of the Cold War ................................................................ 13 I.1. Looking for the Next Paradigm: Theoretical Considerations in the 1990s.................... 13 I.1.1 The End of History ................................................................................................... 13 I.1.2 The Clash of Civilizations ....................................................................................... 15 I.1.3 Bipolar, Multipolar, Unipolar? ................................................................................ 17 I.2. The U.S. Strategic Debate ............................................................................................. -

RG04 Interior.Qxd
Gernika y Alemania Historia de una reconciliación Michael Kasper RED gERnika bakeaz gernika gogoratuz Gernika y Alemania Historia de una reconciliación Esta investigación ha sido patrocinada por Gernika Gogoratuz en colaboración con el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y la Dirección General IA Derechos Humanos y Democratización de la Comisión Europea. COMISIÓN EUROPEA Dirección General IA Relaciones Exteriores: Europa y Nuevos Estados Independientes, Política Exterior y de Seguridad Común, Servicio Exterior Dirección A - Relaciones Multilaterales Derechos humanos y democratización Gernika y Alemania Historia de una reconciliación Michael Kasper Colección Red Gernika Director de la colección: Juan Gutiérrez © Michael Kasper, 1998 © Bakeaz, 1998 Avda. Zuberoa, 43-bajo • 48012 Bilbao Tel. 94 4213719 • Fax 94 4216502 E-mail: [email protected] © Gernika Gogoratuz, 1998 Artekale, 1 • 48300 Gernika-Lumo Tel. 94 6253558 • Fax 94 6256765 E-mail: [email protected] http: // www.sarenet.es /gernikag ISBN: 84-88949-27-8 Depósito legal: BI-719-98 Índice Presentación de Gernika Gogoratuz 9 Prólogo del Alcalde-Presidente de Gernika-Lumo 11 Introducción 13 I. Reconciliación 19 II. La restitución de los damnificados por los crímenes nazis 21 III. La superación del pasado alemán 27 IV. La Comisión Gernika 35 V. Petra Kelly y el Centro de Investigación por la Paz 45 VI. El ejército alemán y el ‘Guernica’ de Picasso 55 VII. El hermanamiento entre Gernika y Pforzheim 57 VIII. El Proyecto Gernika 65 IX. La Iniciativa Contra el Olvido 77 X. Gernika Gogoratuz y el mensaje del presidente alemán 81 XI. Conclusiones 87 Notas 91 Bibliografía básica 99 7 Presentación ernika Gogoratuz tiene la misión de hacer aportaciones al G símbolo de Gernika, para lo cual acordó con la catedrática de Historia Contemporánea Mª Jesús Cava Mesa que realizase un tra - bajo de investigación que se publicó en el año 1996 con el título Memoria colectiva del bombardeo de Gernika . -

Introduction: the Nuclear Crisis, NATO's Double-Track Decision
Introduction Th e Nuclear Crisis, NATO’s Double-Track Decision, and the Peace Movement of the 1980s Christoph Becker-Schaum, Philipp Gassert, Martin Klimke, Wilfried Mausbach, and Marianne Zepp In the fall of 1983 more than a million people all across West Germany gathered under the motto “No to Nuclear Armament” to protest the imple- mentation of NATO’s Double-Track Decision of 12 December 1979 and the resulting deployment of Pershing II and cruise missiles in West Germany and other European countries.1 Th e media overfl owed with photos of human chains, sit-in blockades, and enormous protest rallies. Th e impressive range of protest events included street theater performances, protest marches, and blockades of missile depots. During the fi nal days of the campaign there were huge mass protests with several hundred thousand participants, such as the “Fall Action Week 1983” in Bonn on 22 October and a human chain stretching about 108 km from Ulm to Stuttgart. It seemed as if “peace” was the dominant theme all over Germany.2 Despite these protests, the West German Bundestag approved the missile deployment with the votes of the governing conservative coalition, thereby concluding one of the longest debates in German parliamentary history.3 A few days later the fi rst of the so-called Euromissiles were installed in Mut- langen, near Stuttgart, and in Sigonella, on the island of Sicily.4 Th e peace movement had failed to attain its short-term political aim. However, after a brief period of refl ection, the movement continued to mobilize masses of people for its political peace agenda. -

La Négociation Collective En France
Nos 165-166 - JUILLET-AOUT 1978 - 12 F ecIC7- •La négociation collective en France •Comprendre la France actuelle •L'odinateur, maître ou serviteur? •Les Etats-Unis et l'Europe • De Nietzsche à Platon •Restaurer sans défigurer • Baudelaire; la femme et l'amour Gérard ADAM - Jean CHELINI - Denys BANSSILLON - Yves LALJLAN - Philippe SENART - Etienne BORNE - Yvan CHRIST - Françoise BARGUILLET - Jean- Marie DOMENACH - DOSSIERS ET ETUDES LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN FRANCE PAR GERARD ADAM ................................... p. 2 FRANCE COMPRENDRE LA FRANCE ACTUELLE PAR JEAN CHELINI ..................... ................ p. 7 LORDINATEUR, MAITRE OU SERVITEUR? PAR DENYS BANSSILLON .............................. p. 11 FORUM LES ETATS-UNIS ET LEUROPE PAR YVES LAULAN .................................... p. 18 COMITE DE DIRECTION FIDELITE A LA LANGUE FRANCAISE Etienne Borne, Henri Bourbon PAR JEAN-MARIE DOMENACH .........................p. 23 6, rue Paul-Louis-Courier - 75007 Paris ARTS ET IDEES 14.788-84 - TéJ. C.C.P. Paris 5447550 DE NIETZSCHE A PLATON Abonnement annuel ............50 F PAR ETIENNE BORNE ......... ................ ......... p. 25 Abonnement de soutien ..........80 F LA FEMME ET L'AMOUR CHEZ BAUDELAIRE PAR FRANCOISE BARGUILLET .........................p. 35 LA VIE LI1TERAIRE PAR PHILIPPE SENART .................................p. 45 RESTAURER SANS DEFIGURER PAR YVAN CHRIST ....................................p. 48 NOTES DE LECTURE DEMAIN LE CAPITALISME DHENRI LEPAGE Sommaire PAR JEAN GANIAGE ................................... p. 53 PROGRES OU DECLIN DE L'HOMME 165-166 DE PHILIPPE SAINT-MARC PAR ANNE-MARIE LAVAUDEN ......................... p. 54 UN ACTE DE FOI D'HENRI FREVILLE PAR HENRI BOURBON ................................. p. 55 LA IV ET LA V REPUBLIQUE DE PIERRE LIMAGNE PAR JEAN TEITOEN ..................................... p. 56 ETIENNE BORNE OU LA PASSION DE LA VERITE PAR ANDRE-A. DEVAUX ............................... p. 57 SIGNIFICATION DE L'ART MEDIEVAL PAR JEAN CHELINI ................................... -

The 'General Staff' for a Hot Autumn in Western Europe, and Who's
Click here for Full Issue of EIR Volume 10, Number 36, September 20, 1983 introduction. of Eastern values of this sort against the Judeo Christianrationalism of Schiller's and Humboldt's Germany. The Moscow clearance to order the shooting -down of the Korean airliner is a characteristic expression of a world outlook akin to the Nazis' Nietzschean philosophy of the Triumph of the Will, the anti-rationalist conception of Will associated with William of Ockham, Bernard of Clairvaux, and others. To deal with the West by display of a terrifying exertion of the Russian Will, is the essence of the airliner incident. The 'general staff' for a It was a Hitler-like expression in foreign-policy, a char acteristically brutal expression of a "Third Rome" state of mind. in Western Europe, and It is the same state of mind which prompts the Soviet command to deem a beast as morally and mentally depraved Jo Leinen, a leader of the German "peace movement" and as Khomeini to impose its "dark age" upon the people of Iran, speaker of the BB V environmentalist association, announced to unleash Qaddafi against the nations and peoples of Africa. last October that "the Federal Republic should be made un It is that same wicked state of mind which prompts the Soviet governable" if necessary to stop deployment of U.S. Persh leadership to adopt the cause of the forces of a new dark age ing II and cruise missiles. A year later, the peace movement in Germany, the Green Party, and which brings Soviet asset is efficiently organized to accomplish this goal. -
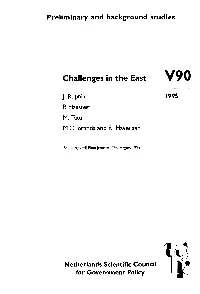
Challenges in the East V90
Preliminary and background studies Challenges in the East V90 1. Rupnik 1995 I?Hassner M. Tatu M.C. Brands and R. Havenaar Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, The Hague, 1995 Netherlands Scientific Council for Government Policy CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Challenges Challenges in the East 1 J. Rupnik, P. Hassner, M. Tatu, M.C. Brands and R. Havenaar. - The Hague : Sdu Uitgeverij Plantijnstraat. - (Preliminary and Background Studies I Netherlands Scientific Council for Government Policy, ISSN 0169-5688 ; V 90) ISBN 90-399-0899-0 Trefw.: vrede en veiligheid ; Europa. Preface One of the most daunting challenges of Europe in the immediate future is to overcome the consequences of the unnatural division of Western and Eastern Europe in separate geopolitical spheres, without relapsing into older, histori- cal patterns of division between East and West. In preparation of its report 'Stabiliteit en veiligheid in Europa' to the government on Dutch foreign policy in coming years, the Scientific Council has commissioned a number of studies and analyses on developments in Eastern and Central Europe that are inclu- ded in the present publication. A discussion on the future of Europe without due regard to developments in Russia is unthinkable. This aspect is covered by an analysis on future deve- lopments in Russia by Michel Tatu, a well-known expert in this field. Two studies deal with the situation and developments in Central Europe and the Balkans. Jacques Rupnik, author of 'The other Europe', provided us with a lucid analysis of the political situation in Central Europe and its implications for the European Union. Pierre Hassner contributed an analysis of the most complex region of Europe, the Balkans. -

Rechtsextremismus Und Antifaschismus Herausgegeben Von Klaus Kinner Und Rolf Richter
Rechtsextremismus und Antifaschismus herausgegeben von Klaus Kinner und Rolf Richter 1 Schriften 5 herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen e. V. und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e. V. 2 Rechtsextremismus und Antifaschismus Historische und aktuelle Dimensionen herausgegeben von Klaus Kinner und Rolf Richter Karl Dietz Verlag Berlin 3 Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Rechtsextremismus und Antifaschismus : historische und aktuelle Dimensionen / hrsg. von Klaus Kinner und Rolf Richter. – Berlin : Dietz, 2000 (Schriften / Rosa-Luxemburg-Stiftung ; Bd. 5) ISBN 3-320-02015-3 © Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2000 Umschlag: Egbert Neubauer, MediaService Fotos: Gabriele Senft, Berlin Typografie: Brigitte Bachmann Satz: MediaService, Berlin Druck und Bindearbeit: BärenDruck, Berlin Printed in Germany 4 INHALT Editorial 7 WERNER BRAMKE Antifaschistische Tradition und aktueller Antifaschismus 8 ROLF RICHTER Über Theoretisches und Praktisches im heutigen Antifaschismus 14 KLAUS KINNER Kommunistischer Antifaschismus – ein schwieriges Erbe 45 ANDRÉ HAHN Zum Umgang mit Rechtsextremen in den Parlamenten 52 NORBERT MADLOCH Rechtsextremismus in Deutschland nach dem Ende des Hitlerfaschismus 57 Vorbemerkung 58 Rechtsextremistische Tendenzen und Entwicklungen in der DDR, speziell in Sachsen, bis Oktober 1990 63 Hauptetappen der Entwicklung des Rechtsextremismus in den alten Bundesländern bis zur deutschen Vereinigung 1990 106 Zur Entwicklung des Rechtsextremismus im geeinten Deutschland 1990 bis 1990 – besonders in den neuen Bundesländern 146 Ursachen und Perspektiven des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik 206 ROLAND BACH Zur nationalen und sozialen Demagogie der extremen Rechten 215 5 Anhang 251 NORBERT MADLOCH Lexikalische Erläuterungen zu den im Rechtsextremismus-Teil verwandten Hauptbegriffen 252 Rechtsextremismus 253 Rechtsradikalismus = Grauzone 255 Rechtspopulismus 256 Faschismus/Nazismus – Neofaschismus/Neonazismus 257 Neue Rechte 261 Rassismus 264 Ausländer- bzw. -

Foreign Correspondents in Francoist Spain
Foreign correspondents in Francoist Spain (1945-1975) Tobias Reckling This thesis is submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the University of Portsmouth. March 2016 1 Abstract This thesis will examine the foreign press corps in Francoist Spain from 1945 until 1975. After the end of the Second World War, the Franco regime was internationally isolated as a result of its ties with Nazi Germany and Fascist Italy. However, the dictatorship returned to the international stage during the 1950s and managed to survive on the margins of the Cold War world order until the death of Franco in 1975. Throughout these 30 years and while never loosening its dictatorial control over Spain, the Franco regime continuously tried to improve its international position and image beyond mere toleration. Foreign correspondents were working at the centre of this balancing act. Against this backdrop, this thesis has two central aims. First, it will examine the regime’s policy towards the foreign press. The thesis will show that the Francoist authorities never fully accepted the foreign press corps’ work within Spain and tried to exercise control over the foreign press corps until the end of the regime. Throughout the regime’s internal and external development, however, the Francoist authorities adapted the means they employed. At the same time, conflicting interests and strategies within the Franco regime shaped its policy towards the foreign press. This thesis will further show that conflicts with correspondents partially had their roots in the importance of the foreign press, distributed within Spain, for the Spanish public in general and the political opposition in particular. -

Neuerscheinungen Herbst 2020
altertumswissenschaften Herbst 2020 geschichte philosophie berufspädagogik www.steiner-verlag.de Neuerscheinungen geographie [email protected] Herbst 2020 musikwissenschaft Birkenwaldstraße 44 germanistik D – 70191 Stuttgart romanistik Telefon: 0711–2582–0 linguistik Telefax: 0711–25 82–390 98 orientalistik Bestellinformationen Franz Steiner Verlag GmbH Birkenwaldstr. 44 D – 70191 Stuttgart Telefon: 0711 2582-0 Fax: 0711 2582-390 E-Mail: [email protected] Internet: www.steiner-verlag.de VN: 16180 UST-IdNr.: DE 811 207 273 Auslieferung Rhenus Medien Logistik GmbH & Co. KG Telefon: 0511 96781-074 Fax: 0951 6050-667 E-Mail: [email protected] Abonnieren Sie unseren Newsletter – passgenau zugeschnitten auf Ihre Interessengebiete www.steiner-verlag.de/newsletter Über die Produkte unserer Schwesterfirmen • Hirzel Verlag • Deutscher Apotheker Verlag • Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart • Berliner Wissenschafts-Verlag informieren Sie gesonderte Kataloge, die wir Ihnen gerne zusenden. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise inklusive MwSt. [D], sofern nicht anders angegeben. Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Lieferung ins Ausland zuzüglich Versandkosten- pauschale von € 7,95 pro Versandstück. E-Books sind als PDF online zum Download erhältlich unter elibrary. steiner-verlag.de. Wir sind berechtigt, Ihnen Informationen über Waren und Dienstleistungen, die den von Ihnen in Anspruch genommenen ähneln, zuzusenden. Dieser Verwendung können Sie jederzeit per E-Mail an [email protected] widersprechen, ohne dass Ihnen andere Kosten als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Widerrufsrecht: Als Verbraucher haben Sie das Recht, Ihren Vertrag ohne Angabe von Gründen binnen 14 Tagen ab Erhalt der Ware zu widerrufen. Die Kosten der Rücksendung trägt der Verlag. Ein Widerrufsrecht für elektronische Datenträger besteht nicht, wenn die Versiegelung der Verpackung entfernt wurde. -

Pour Mémoire N° 5
hiver 2008 comité d’histoire ... • revue du comité d’histoire du ministère • revue du comité d’histoire du ministère • ë ine o to N n la A e e d g l r e e r S a H s i u o L 2 Parc National de Porquerolles MEEDDAT Laurent Mignaux n°5 hiver 2008 l « pour mémoire » éditorial 3 près « l’histoire au fil de l’eau » que le n° 4 de « pour mémoire » vous a proposé, c’est aux sources même du ministère de l’Environnement que nous vous convions dans cette nouvelle édition de notre revue. Le Conseil général des Ponts et Chaussées est devenu le 9 juillet dernier, le Conseil géné- ral de l’ Environnement et du Développement durable, en fusionnant avec l’Inspection générale de l’Environnement et en adaptant sa structure aux missions nouvelles dont le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Amé- nagement du territoire est en charge et qui l’ont conduit dans le même temps, à une restructuration profonde de ses directions d’administration centrale, comme de ses services déconcentrés, tant au plan départemental que régional. « Pour mémoire » avait déjà publié un numéro spécial dédié au Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie, mais, à partir de ce numéro 5, notre revue consa- crera régulièrement une partie de ses rubriques à des sujets relatifs au développement durable et à l’énergie, ainsi qu’à l’aménagement du territoire. Pour initier cette évolution, il nous a paru intéressant d’évoquer la figure de Serge Antoine, pionnier de l’aménagement du territoire et acteur majeur de la prise de conscience et de l’organisation administrative des politiques de l’environnement.