Ganzseitiges Foto
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BP Schlei/Trave
Stand 22.12.2014 Entwurf Bewirtschaftungsplan für den 2. Bewirtschaftungszeitraum gemäß Art. 13 der Richtlinie 2000/60/EG (§ 83 WHG) für die Flussgebietseinheit Schlei/Trave Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern Entwurf des 2. Bewirtschaftungsplans für die FGE Schlei/Trave Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis IX Verzeichnis der Anhänge XIII Abkürzungsverzeichnis XVI Einführung 1 Teil A gemäß Anhang VII WRRL 7 1 Allgemeine Beschreibung der Merkmale der Flussgebietseinheit Schlei/Trave 7 1.1 Oberflächengewässer 13 1.1.1 Lage und Grenzen der Wasserkörper 13 1.1.2 Ökoregionen und Oberflächenwasserkörpertypen im Einzugsgebiet/Ermittlung von Bezugsbedingungen für die Oberflächenwasserkörpertypen 14 1.2 Grundwasser 17 2 Zusammenfassung der signifikanten Belastungen und an- thropogenen Auswirkungen auf den Zustand von Oberflächengewässern und Grundwasser 19 2.1 Oberflächengewässer 19 2.1.1 Kriterien für die Signifikanz von Belastungen 21 2.1.2 Punktuelle Schadstoffquellen (Anh. II 1.4) 25 2.1.3 Signifikante diffuse Stoffeinträge 26 2.1.4 Signifikante Wasserentnahmen/Wiedereinleitungen 31 2.1.5 Signifikante Abflussregulierungen/hydromorphologische Veränderungen 31 2.1.6 Wassermangel und Dürren 33 2.1.7 Einschätzung sonstiger signifikanter anthropogener Belastungen 33 2.1.8 Bestandsaufnahme prioritäre Stoffe 34 2.2 Grundwasser 34 2.2.1 Diffuse Quellen 36 2.2.2 Punktquellen 36 2.2.3 Grundwasserentnahmen 38 2.2.4 Intrusionen 39 2.2.5 Unbekannte Belastungen 39 3 Ermittlung und Kartierung der Schutzgebiete (gemäß Artikel 6 und Anhang IV 1 WRRL) 41 3.1 Gebiete zur Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Anh. IV 1 i) 41 - I - Entwurf des 2. Bewirtschaftungsplans für die FGE Schlei/Trave 3.2 Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten (Anh. -

2015-08 MPSB 053 August
mein plönerseeblick Das kostenlose Monatsmagazin rund um den größten See in Schleswig-Holstein Ehemaliger Kuhstall wird zum Bistro und Café Castrum-Plune am Limes Saxoniae Hochwertige, edle Tropfen für Kenner und Genießer Unterm grünen Dach Plöner Abendhimmel im August Veranstaltungen im August 2015 rund um die Plöner Seen Schlechtes Wetter gibt es nicht!… JAHRGANG 5 AUSGABE 8 AUGUST 2015 EDITORIAL LIEBE LESERINNEN UND LESER Lange Straße 13 · 24306 Plön Zimmermann Telefon 04522 74 93 97 der August verheißt die schönste Zeit des Jahres Neues aus der Geschäftswelt sowie einen weite- Unsere Hauptstraße 2 a · 23715 Hutzfeld – Ferienzeit! In der Kindheit schienen die großen ren Ausflugstipp für Sie aufgetan: Die Perdoeler Ferien unendlich und der Sommer war ein gro- Mühle. Sie wurde 1720 beim Ausbau des Gutes S o m m e r -We i n Telefon 0 45 27 / 2 17 ßes Versprechen. Es gab jede Menge Eis und Zeit Perdoel kurzerhand stromaufwärts an den Be- Empfehlung für die schönsten Dinge. Viele zieht es im Sommer lauer See verlegt, macht Lust auf das Landleben in die Ferne. Doch warum in die Ferne schweifen, und verwöhnt Ausflügler mit hausgemachten CERASUOLO ROSÉ wenn das Gute liegt so nah? Der Große Plöner Kuchen nach traditioneller Art. Und Gewinner gekeltert aus 100 % See mit seinen kleinen, geheimen und den gro- gibt es in dieser Ausgabe auch noch. Über „Das Montepulciano d’ Abruzzo ßen Badestellen wie in Bosau sowie die umlie- Kochbuch Ostholstein“ von Kai Schmidt, das wir 0,75 l Fl. € 4,95 genden Seen etwa der Schöhsee bieten herrliche, in der letzten Ausgabe verlost haben, dürfen sich flach ins Wasser führende Sandstrände und die Bärbel Ziech aus Bosau, Monika Brinkop aus WEISSBURGUNDER- Möglichkeit, sich in den kühlen Wogen zu erfri- Preetz und Lilo Lommer aus Plön freuen. -

Kanus, Kajaks, Kilometer
Wasserwege in Schleswig-Holstein Kanus, Kajaks, Kilometer 1 1 2 2 Liebe Kanuwanderinnen, liebe Kanuten Sport und Naturschutz haben ein ge- Wer mit dem Boot ein Gewässer meinsames Anliegen: die Natur, ihre befährt, ist ganz dicht dran an der Schönheiten und ihren Erholungs- Natur. Tipps und Hinweise in der wert zu erhalten. neuen Broschüre helfen daher, die Natur vom Wasser aus zu entde- Der Wassersport ist in Schleswig- cken, ihre Schönheit zu genießen Holstein fester Bestandteil der und sie gleichzeitig zu schonen. Be- naturnahen Erholung. Das Land lohnt wird man dann eventuell auch zwischen den Meeren wird auch im durch den Anblick eines Eisvogels, Landesinneren immer wieder vom einer Prachtlibelle oder einer selte- Wasser geprägt. Flüsse und Seen nen Pflanze am Schilfrand. reagieren als wertvolle biologische Lebensräume jedoch auch empfind- Ich wünsche in diesem Sinne allen lich auf Störungen. Die Ansprüche Kanuwanderinnen und Kanuten im- von Natur und Landschaft und die mer genügend Wasser unter dem Erholung in der freien Natur oder auf Boot und viele beeindruckende dem Wasser müssen daher mitein- Naturerlebnisse auf unseren schö- ander in Einklang gebracht werden. nen Gewässern im „Wasserland“ Schleswig-Holstein. Bereits seit dem Jahr 2001 arbeiten die Kanusportverbände und mein Ministerium intensiv zusammen. Vereinbart wurde damals eine umweltverträgliche Nutzung der befahrbaren Gewässer in Schleswig- Holstein. Darauf folgte im Jahr 2008 eine Rahmenvereinbarung über „Na- tura 2000 und Sport in Schleswig- Holstein“. Dr. Juliane Rumpf Ministerin für Landwirtschaft, Um- Auch die Neuauflage dieser viel ge- welt fragten Broschüre ist wieder durch und ländliche Räume Kooperation des Ministeriums für des Landes Schleswig - Holstein Landwirtschaft, Umwelt und ländli- che Räume mit allen interessierten Sportverbänden entstanden. -
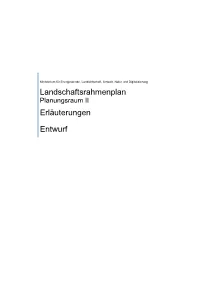
LRP PR II Band 2
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Landschaftsrahmenplan Planungsraum II Erläuterungen Entwurf Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Mercatorstraße 3 24106 Kiel Stand Juli 2018 2 Inhaltsverzeichnis 1. Natur und Landschaft 1.1 Lebensräume 1.1.1 marine Lebensräume und Ästuarien 1.1.2 Küstenlebensräume 1.1.3 Binnengewässer 1.1.4 Wälder 1.1.5 Hochmoore 1.1.6 Niedermoore 1.1.7 Heiden, Dünen, Trockenrasen 1.1.8 Grünland 1.1.9 Agrarlandschaften 1.1.10 Siedlungslebensräume 1.2 Natura 2000 1.3 Naturschutzgebiete 1.4 Landschaftsschutzgebiete 1.5 Naturdenkmäler 1.6 Geschützte Landschaftsbestandteile, Baumschutzsatzungen 1.7 Naturwälder 1.8 Naturerlebnisräume 1.9 Schutzstreifen an Gewässern II. Ordnung 1.10 Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem 1.11 Kulturlandschaften 1.11.1 Geschichtlicher Abriss 1.11.2 Methodik zur Ermittlung der Historischen Kulturlandschaften 1.11.3. Methodik zur Ermittlung der Strukturreichen Agrarlandschaften 1.11.4 Kulturlandschaftausschnitte und Kulturlandschaftselemente 2. Böden und Bodenfunktionen 2.1 Böden 2.2 Bodenfunktionen 2.3 Geotope 2.4 Archivböden 3. Landschaft und Erholung 4. Klimawandel 3 5. Landschaftswandel 6. Monitoring 4 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Natura 2000 Tabelle 2: Naturschutzgebiete - Bestand Tabelle 3: Gebiete, die die Voraussetzung für eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet erfüllen Tabelle 4: Landschaftsschutzgebiete: Bestand und einstweilig sichergestellte Gebiete Tabelle 5: Gebiete, die die Voraussetzungen -

Theodoxus Montfort, 1810 in Deutschland
> Mollusca 26 (1) 2008 13 13 – 72 © Museum für Tierkunde Dresden, ISSN 1864-5127, 15.04.2008 Zur Taxonomie und Verbreitung der Gattung Theodoxus Montfort, 1810 in Deutschland. Darstellung historischer und rezenter Daten einschließlich einer Bibliografie MICHAEL L. ZETTLER Leibniz Institut für Ostseeforschung Warnemünde, D-18119 Rostock, Seestrasse 15, Germany [email protected] Received on October 9, 2007, accepted on February 11, 2008. Published online at www.mollusca-journal.de > Abstract Taxonomy and distribution of the genus Theodoxus Montfort, 1810 in Germany. Presentation of historical and recent data including a bibliography. – The present study comprises an extensive investigation on taxonomy and distribution of the genus Theodoxus Montfort, 1810 in Germany. About 763 literature sources were analysed and the locations were refer- enced geographically and digitised. Furthermore several collections of museums and private persons were checked. Alto- gether more than 3800 records could be integrated within a data base. The following species could be observed in Germany recently: T. fl uviatilis (Linnaeus, 1758), T. danubialis (C. Pfeiffer, 1828) and T. transversalis (C. Pfeiffer, 1828). T. serrati- liniformis (Geyer, 1914), a species of the Pleistocene, will understand as a synonym of T. danubialis. Furthermore, the study demonstrates the futility of separating of the subspecies T. fl uviatilis littoralis. Following an introductory overview each spe- cies will be discussed with regard to the federal states and a bibliography will given. All known waterbodies with historical and recent records will be listed. For each state the distribution is pictured in a map in relation to the time of observation. > Kurzfassung Die vorliegende Studie beinhaltet eine ausführliche Recherche zur Taxonomie und Verbreitung der Gattung Theodoxus Montfort, 1810 in Deutschland. -

Verteilung, Wachstum Und Nahrungsökologie Der Larven Und Jungfische Im Belauer See, Schleswig-Holstein
Verteilung, Wachstum und Nahrungsökologie der Larven und Jungfische im Belauer See, Schleswig-Holstein DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Biologie der Universität Hamburg vorgelegt von Christine Bertram aus Hamburg Hamburg 2002 Verteilung, Wachstum und Nahrungsökologie der Larven und Jungfische im Belauer See, Schleswig-Holstein DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs Biologie der Universität Hamburg vorgelegt von Christine Bertram aus Hamburg Hamburg 2002 Danksagung Sehr herzlich bedanken möchte ich mich vor allem bei Herrn Prof. Dr. W. Nellen für die Betreuung dieser Arbeit. Besonders hervorzuheben sind seine stete Gesprächsbereitschaft und Unterstützung, das entgegengebrachte Vertrauen, die kritische Durchsicht des Manuskripts sowie die viele Geduld. Herrn Prof. Dr. H. Kausch danke ich für den “Gastschreibtisch” im Zeiseweg. Der gesamten limnologischen Arbeitsgruppe, insbesondere aber Susanne Barkmann, Dr. Walter Fleckner, Dr. Bernhard Landmesser, Gaby Maaser, Dr. Ute Müller, Dr. Heike Zimmermann und meinen Zimmerkolleginnen Gabi Konstantin, Dr. Alexandra Makulla und Marion Ziemer bin ich dankbar für die gute Zusammenarbeit, die anregenden Diskussionen und die nette Arbeitsat- mosphäre. Zu Dank verpflichtet für die Überlassung unveröffentlichter Daten zu Zooplankton, Zooben- thos und adulten Fischen im Belauer See bin ich: Dr. Walter Fleckner, Gabi Konstantin, Dr. Boris Löhlein, Dr. Ute Müller, Dr. Werner Pfeiffer und Dr. Rainer Pöpperl. Herr Peter Öhlrich unterstützte mich tatkräftig beim Bau und der Erprobung neuer Fanggeräte; von Dr. Hans-Herrmann Arzbach und Dr. Ralf Thiel erhielt ich viele hilfreiche Tipps und Anregungen. Meine “Hiwis am See” Karin Leithäuser, Irma Ebbers und Esmail Valamanesh halfen mir zuverlässig und gut gelaunt bei jedem Wetter - dank ihnen bleiben mir die “Fangtage” in bester Erinnerung. -

Entwicklungskonzeptes Für Eine Umweltverträgliche Attraktivierung Und Nachhaltige Qualitätssicherung Des Wasserwanderweges Schwentine
Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für eine umweltverträgliche Attraktivierung und nachhaltige Qualitätssicherung des Wasserwanderweges Schwentine Bericht - Stand 31.03.2020 © Lebensraum Zukunft, BTE Gefördert durch: Büro Lebensraum Zukunft UG (haftungsbeschränkt) | BTE Tourismus- und Regionalberatung www.lebensraumzukunft.de | www.bte-tourismus.de Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für eine umweltverträgliche Attraktivierung und nachhaltige Qualitätssicherung des Wasserwanderwegs Schwentine Bericht – Stand 31.03.2020 Im Auftrag von: Kreisverwaltung Plön Hamburger Str. 17/18 24306 Plön Stadt Schwentinental Theodor-Storm-Platz 1 24223 Schwentinental Bearbeitet von: Büro Lebensraum Zukunft B T E Tourismus- und Regionalberatung UG (haftungsbeschränkt) Stiftstr. 12 Beselerallee 40a D-30159 Hannover D-24105 Kiel Tel. +49 (0)511 - 70 13 2 – 0 Tel. +49 (0)431 – 128 490 93 Fax +49 (0)511 - 70 13 2 – 99 Fax. +49 (0)431 – 128 508 74 [email protected] [email protected] www.bte-tourismus.de www.lebensraumzukunft.de Kiel und Hannover, März 2020 Inhalt ENTWICKLUNGSKONZEPT WASSERWANDERWEG SCHWENTINE Inhalt Einleitung .................................................................................................................. 1 1 Methodische Vorgehensweise und Umsetzung ................................................ 2 1.1 Der Planungsraum – Beschreibung, Abgrenzung, Beteiligte .............................. 4 1.1.1 Beschreibung der Schwentine ......................................................................... 4 1.1.2 -

Freiräumliches Leitbild Kiel Und Umland?
Interkommunale Freiräumliches Leitbild Arbeitsgemeinschaft Kiel und Umland Kiel und Umland Herausgeberin : Landeshauptstadt Kiel, Grünflächenamt Inhaltliche Bearbeitung : Interkommunale Arbeitsgemeinschaft Kiel und Umland Redaktion und Gestaltung : Landeshauptstadt Kiel, Grünflächenamt Karten : Landeshauptstadt Kiel, Grünflächenamt Stand : Januar 2007 Inhalt Einleitung.......................................................................................5 Warum ein Freiräumliches Leitbild Kiel und Umland? ... 5 I: Konzept ......................................................................................7 Ziel.................................................................................7 Begründung...................................................................7 Die Grundpfeiler: Ökologie und Erholung......................8 Beschreibung des Leitbildes..........................................8 II: Biotopverbund ......................................................................... 13 Zielsetzung .................................................................. 13 Systematik................................................................... 13 Anwendung ................................................................. 14 Beschreibung der Haupt- und Neben- Biotopverbundstrukturen ............................................. 17 III: Erholung ................................................................................. 43 Zielsetzung .................................................................. 43 Systematik.................................................................. -

Landschaftsrahmenplan Für Den Planungsraum III
Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön, kreisfreie Städte Kiel und Neumünster ¢¡¤£ ¥§¦¤¨ © ¡¤ ¡ £ ¨ ¡¤£ ¦£ ¡¤! " #¥ ¦£¢¦§$&%§'£ ¨ ¡ $ ¡§¨)(§¥ $ ¡§¨ *,+¤- ! ¡§¨./ © 0 ' ! ¨ ¡ + )¡¤£ ¥¤£ '£ ¨£ ¥ 1¤¡2 3 45.687&9 ¡ ! :8 ¡¤! ! $, ¡ ¥¤£ ¡ ¦ ©8 * + #¥ ; '¤¥ ! <¤¥ £ = ¡ £ > ¡¤" - *?+ - : ¡§¨ ¦! @."?:BA ¤ © :8 ¡¤! ' 'B (.¥¤§$ ¡ ¨.¥ C £#¥. ¦£¢¦ $ *,+¤- ¡ ! $ ¡§¨/(.¥ $ ¡§¨ ! ¡§¨ 0 ) © 0 '! ¨ ¡¤ ¢¡¤£ ¨ ¡¤! ! ¦§©8 - 9 +¤- DCE FGE?H ! ¡ £ ¨§" ¡ ! I J,£ ' ¨ £ ¡¤¤K *,+¤- 9 9 ) $¤ML ! ¥ ¦ ©" ¡ ! 9 I ¥ £ ¡ ¤K 3 6,6,6 N¤¦ *?* 6BP 4B7?P,R O # 2BQ 0 +¤- S ¡ ¨ ¡TJ,£ '¤¨ £ ¡ ¦£ $ ¡/¥ ¦¤¨ +.V + U¡ ! ©<¤¥¤<¤ ¡¤£ - ¡¤£ ©¤¡ ¨ ¡ ! ! WE + + - S ¡ ¨ ¡XS£ ¦ = ¨ £ Y) £ $& - +¤- U,¥ ¡¤$¤¡ £¢Z ¡¤§! 0 +¤- = ¡ ¨.¥ £ §¡ $ ¡¤£8¨ ! ¡§¨./ © 0 - +¤- ' ! ¨ ¡ ¨ ¡¤T(§¥ $ ¡§¨§£ ¡§©, ¡ 0 - £ ¦ © ¡¤£ ¥§¦¤¨ © ¡§© ¡ §¡ ?E * ¡)$¥¤£ Y ¡§$ ¡¤£8> 'T[¤¥ £ ¡ ¡ +¤- - ¤' > ' X[§¡ £ ¨.' ¡¤ "B$, ¡)\]¥ ! 0 - - ¡ £ ¤¦ ©X'¤$ ¡¤£B\]¥ ! ! ¡ - ¡.;£ ¡ ¡¤ "¢ \]¥ ! =.¥¤ <§ + - @ ¦ _^, ¡ = ¡/$ ¡¤£B\]¥ ! ¡ £ 0 ¤¦ ©T>¤¡¤£ ¡¤ $ ¡.Y ¡¤£ $¤¡ ?E + - - + - DM¦ ' ¡/@¡¤ ;! ¡¤XJ ¡§@ ¦¤© - @ ¦¡¤ §¡ £ ¡§> ' £ ¨ ¡ ¡¤ $ ¡¤ - + + - \]¥ ! $¥ £ $ ¡XS£ ¦ = ¨ £ + - M /¡¤ §¡ £B\`¡¤ ¨ ¡)>¤¡¤£ ¡¤ 0 $ ¡.Y ¡¤£ $¤¡ "?$, ¡/¥¤! ¨/[ ¥¤£ ¡¤ 0 - ¤¥ C¡/$ ¡¤£(§¥ $ ¡§¨§£ ¡§©, ¡ £ ¦ © @ ¦ ©¦ ¨ ¡ /¡¤ @a¡ ! ¡¤£¢bG£ ¦< < ¡¤ > ¡ £ ¨¥ $ ¡¤T¡ £ $ ¡¤X=.A . ¡,E S8¡¤X[ ¥¤£ ¡¤ ¡¤T ¨¡§¨ ©¤¡ ¨ ¥. ¡.;" + +¤- +¤- $, ¡XS£ ¦ = ¨ £ @ ¦£§ ¡ £ £ 0 - ¦ ©c £ ¡¤£8¡ © ¡¤ -

Die Alte Schwentine Von Bornhöved Nach Preetz – Eine Kulturhistorische Landschaftsbetrachtung
GERD DRESSLER UND THERESIA KÜNSTLER Die Alte Schwentine von Bornhöved nach Preetz – eine kulturhistorische Landschaftsbetrachtung Name für Bornhöved, wo 798 die mit den Geschichtsträchtiger Fluss mit folgen- Franken verbündeten Abodriten die trans- schwerer Verwechslung elbischen Sachsen schlugen. In den Wiesen In den amtlichen topografischen Karten ist am Grimmelsberg bei Tarbek nahe Born - dem Namen Alte Schwentine in Klammern höved liegt die Quelle des heiligen Flusses die Bezeichnung Kührener Au beigefügt, (Sventine), der nach dem heiligen Feld (Sven - unter dem sie in ihrem Unterlauf allgemein tana) der siegreichen Schlacht benannt wur - bekannt ist. de. Der Husumer Bürgermeister und Univer - In den Auseinandersetzungen zwischen salwissenschaftler Caspar Danckwerth ver - Sachsen und Wenden um die Vorherrschaft zeichnete 1652 in der „Neuen Landesbe - in Wagrien wurde in karolingischer Zeit der schreibung der zwei Herzogtümer Schleswig Sachsenwall geschaffen, der an den Ost - und Holstein“ die Quelle der Schwentine am grenzen Holsteins und Stormans in seinem Bungsberg, wohl in der Vorstellung, der äl - nördlichen Bereich der Alten Schwentine testgenannte Fluss in den Herzogtümern von Bornhöved bis Preetz als natürlicher Schleswig und Holstein müsse auch am Grenze folgte. Allerdings war der Limes Sa - höchsten Berg des Landes entspringen. Der xoniae mehr eine Demarkationslinie als ein heutzutage vorherrschenden Auffassung zu - durchgehender Verteidigungswall, deren folge ist jedoch aufgrund frühgeschichtlicher Schutzfunktion in schwer durchdringbaren Überlieferungen Sventana der wendische Gewässern und Sumpf- und Feuchtgebieten Abb. 1: Quellstein bei Tarbek (Bornhöved) 65 Pohnsdorfer Klostermühle Stauung e se Preetz t s o P Lanker Postfeld Kührener Kühren See Kührenerbrücke Mühle e n i t n K 19 e Löptin w h c S e t l A L 67 Gut Depenau B 404 Depenauer Mühle e e S r Stolpe e p l o t Gut Perdoel S Wanken- Perdoeler Mühle dorf K 42 e e S Alte Koppel r e u a l e B Ruhwinkel Vier Schm alensee Bornhöveder See Bornhöved Abb. -

Informationen Zum Limes Saxoniae Im Kreis Stormarn
Informationen zum Limes Saxoniae im Kreis Stormarn 1. Aus wikipedia.de Der Limes Saxoniae, auch Sachsenwall genannt, ist ein um 810 n. Chr. errichteter Grenzstreifen der Sachsen zum Schutz vor den slawischen Abodriten im östlichen Schleswig-Holstein. Vermutlich wurde die Befestigung des Grenzbereiches von Karl dem Großen 810/11 bei seinem letzten Aufenthalt in Norddeutschland vereinbart, als auch die Eider als nördliche Reichsgrenze festgeschrieben wurde. Mit dieser Grenzbefestigung wurde ein Teil des 804 an die Abotriten übergebenen Gebiets wieder dem fränkischen Reich einverleibt, das nun auf einem schmalen Streifen zwischen der Levensau und der Schwentine an die Ostsee stieß. Die Grenzbefestigung wurde auch noch unter Ludwig den Frommen weiter ausgebaut, konnte aber keinen nachhaltigen Schutz vor Überfällen und Eroberungen durch die Abodriten bieten, die bis Hamburg vordringen konnten und die Stadt 1066 und 1072 zerstörten. Erst mit der Unterwerfung und Christianisierung der Abodriten und der Eroberung Ostholsteins durch die Grafen von Holstein endeten die Überfälle. Der Verlauf folgt im wesentlichen natürlichen Hindernissen, Flüssen, Sümpfen sowie unwegsamen Wäldern und ist keineswegs so scharf umrissen oder gar befestigt wie der römische Limes. Adam von Bremen beschrieb 1075 in seiner Chronik (2.Buch, Ziffer 18) den Grenzverlauf wie folgt: Vom Ostufer der Elbe bis zu dem Flüßchen, das die Slawen Mescenreiza nenne. Oben trennt sich der Limes von ihm und verläuft im Delvenauwalde bis an die Delvenau. Von ihr kommt man an den Hornbeker Mühlenbach und an die Billequelle. Von da geht man weiter zum Liudwinestein, an die Weisebirken und die Barnitz. Dann läuft sie auf die Sumpfbeste bis zum Travewald und aufwärts durch diesen zur Blunkerbach-Niederung. -
1 Problemstellung Und Zielsetzung
Diana Teubner Vom Fachbereich VI (Geographie/Geowissenschaften) der Universität Trier zur Verleihung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) genehmigte Dissertation Aufbau eines nationalen Referenzsystems für das Biomonitoring aus den Daten der Umweltprobenbank des Bundes Betreuender: Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Paul Müller Berichterstattende: Prof. Dr. Martin Paulus Prof. Dr. Reinhard Hendler Datum der Disputation: 01.07.2010 Trier, November 2010 Meinem Doktorvater Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Paul Müller (11.10.1940 - 30.05.2010) Vorwort Die Dissertation wurde von mir im Rahmen des Graduiertenkollegs "Verbesserung von Normsetzung und Normanwendung im integrierten Umweltschutz durch rechts- und natur- wissenschaftliche Kooperation" der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) als Eigenfinanzierung der Biogeographie angefertigt. Für die Möglichkeit zur Teilnahme an dem interdisziplinären Graduiertenkolleg und die finanzielle Unterstützung zur Durchführung der Arbeit bedanke ich mich bei allen beteiligten Wissenschaftlern, besonders bei dem ehemaligen Fachvertreter der Biogeographie, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul Müller, und dem heutigen Fachvertreter, Herrn Prof. Dr. Michael Veith. Mein Dank gilt Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul Müller darüber hinaus für die Freiräume, die er mir als mein Doktorvater für die selbstständige Gestaltung und Ausarbeitung meiner Arbeit einräumte und seine stetige Bereitschaft, mir mit Ratschlägen und Anregungen zur Seite zu stehen. Sein plötzlicher Tod hat mich tief betroffen gemacht. Es hat mich mit großem Bedauern erfüllt, dass er an meiner Disputation nicht mehr teilnehmen konnte und ich den letzten Schritt ohne ihn ging. Dafür, dass die Begutachtung der Dissertation und die wissenschaftliche Aussprache trotz dieser traurigen Umstände so zügig und reibungslos abliefen, danke ich allen Beteiligten, insbesondere meinen Gutachtern Herrn Prof.