Hierochloe Odorata in Der Fuhneniederung Bei Radegast
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wanderkarte-2017.Pdf
befindet sich der Elbauenpark mit dem Jahrtausendturm, einem interaktiven Museum über über Museum interaktiven einem Jahrtausendturm, dem mit Elbauenpark der sich befindet Ansprechpartner: Ansprechpartner: Ansprechpartner: Ansprechpartner: und landwirtschaftlichen Wegen nahe der der nahe Wegen landwirtschaftlichen und 6 6 ca. 18 km. 18 ca. kreuz im Norden der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt. An der ca. 15 km langen Strecke Strecke langen km 15 ca. der An Landeshauptstadt. sachsen-anhaltischen der Norden im kreuz und über straßenbegleitende Radwege an Landes- und Bundesstraßen. Bundesstraßen. und Landes- an Radwege straßenbegleitende über und Strecke überwiegend auf Deichverteidigungs- Deichverteidigungs- auf überwiegend Strecke auf dem Mittellandkanal (Alternativradweg) zurück Richtung Wasserstraßenkreuz. Die Route beträgt beträgt Route Die Wasserstraßenkreuz. Richtung zurück (Alternativradweg) Mittellandkanal dem auf - Wasserstraßen zum direkt aus Magdeburg von Elberadweg der führt Elbe der Band Blauen Am Die Routen führen größtenteils über gut ausgebaute ländliche Wege, über sichere Ortsstraßen Ortsstraßen sichere über Wege, ländliche ausgebaute gut über größtenteils führen Routen Die besteht in der direkten Flussnähe, da die die da Flussnähe, direkten der in besteht Region. Nach einem Abstecher zur „Elbeuer Wassermühle“ fahren Sie in Höhe des Bootshauses Elbeu Elbeu Bootshauses des Höhe in Sie fahren Wassermühle“ „Elbeuer zur Abstecher einem Nach Region. dorf und Groß Santersleben (29,2 km). (29,2 Santersleben Groß und dorf „Auerbachs -

Zörbiger Bote
PA sämtl. HH sämtl. PA ZÖRBIGER BOTE Mitteilungsblatt der Stadt Zörbig mit den Ortsteilen Cösitz, Göttnitz, Großzöberitz, Löberitz, Löbersdorf, Mößlitz, Priesdorf, Prussendorf, Quetzdölsdorf, Rieda, Salzfurtkapelle, Schrenz, Schortewitz, Spören, Stumsdorf, Wadendorf, Werben und Zörbig Jahrgang 30 | Nummer 12 | Nächster Redaktionsschluss: | Nächster Erscheinungstermin: Freitag, den 4. Dezember 2020 Dienstag, der 15. Dezember 2020 Freitag, der 8. Januar 2021 Anzeige(n) „Stadt Zörbig | Zörbiger Bote“ - 2 - Nr. 12/2020 Volkstrauertag 2020 müssen wir auch in unserer heutigen städten ihre Wohnung verloren hatten. Situation das über die Trauer hinaus- Als endlich im April 1945 das Ende des greifende, das Füreinander da sein, mit Krieges absehbar war, erschütterte der diesem Tag verknüpfen. Todesmarsch von KZ-Häftlingen durch 2020 ist das Jahr, in dem vor 75 Jahren, die Stadt die Bevölkerung doch sehr. am 8. Mai 1945, der Zweite Weltkrieg So waren sie mit den Schrecken des endete. Vielleicht sollten wir uns aus Nationalsozialismus wohl noch nie kon- diesem Anlass noch einmal an diese Zeit frontiert worden. Zwei Frauen waren erinnern, die auch an Zörbig nicht spur- es, beide hießen Müller, die beherzt los vorübergegangen ist. genug waren, selbst unter Todesgefahr, Dazu lade ich jeden ein, die eindrucks- entkräftete Häftlinge, mit Wasser und voll geschilderten Geschichten in der etwas Essbarem zu versorgen. Posthum Zörbiger Festschrift zur 1050-Jahr-Feier wurden sie geehrt. zu lesen, die uns Einblick in diese Zeit Die Amerikanische Armee kam täglich geben können. näher. Tiefflieger beschossen die Stadt, Gravierende Schäden hatte unsere ein Junge wurde dabei getötet. Kurz In diesem Jahr, in dem sich das Ende des Stadt nicht zu beklagen, aber auch Zör- vor Mößlitz sollten die Amerikaner von Zweiten Weltkrieges zum 75. -

(IGEK) Der Stadt Zörbig
2019 - 2035 Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK) der Stadt Zörbig Stadtratsbeschluss 2019-BV-055 22.05.2019 IGEK Stadt Zörbig 2019 Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK) der Stadt Zörbig Stadt Zörbig Markt 12 06780 Zörbig Tel.: 034956-60101 Fax: 034956-60111 [email protected] Bearbeiter: Rolf Sonnenberger Bürgermeister Nico Hofert Fachbereichsleiter Andreas Voss Fachbereichsleiter Ina Schammer Sachbearbeiterin Stadt Zörbig Mit Bildung und Kommunikation zur Integration. Markt 12 bürgernah - aktivieren - gestalten 06780 Zörbig 034956 / 60-0 034956 / 60-111 [email protected] www.stadt-zoerbig.de Seite 2 von 126 IGEK Stadt Zörbig 2019 Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK) der Stadt Zörbig 1 Stadtratsbeschluss 2019-BV-055 (22.05.2019) ................................... 7 2 Vorwort / Einführung zum IGEK Stadt Zörbig ..................................... 11 3 Bestandsanalyse der Stadt Zörbig ..................................................... 12 3.1 Einheitsgemeinde Stadt Zörbig .................................................................... 12 3.1.1 Räumliche Einordnung der Stadt Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld .... 12 3.1.2 Geschichtlicher Hintergrund der Stadt Zörbig ........................................... 13 3.1.3 Entwicklung der Verwaltungsgemeinschaft Zörbig seit 1990 .................... 14 3.1.4 Entwicklung der Einheitsgemeinde ab 2004 ............................................. 14 3.2 Gemeinde und Bürgerschaft ....................................................................... -

Amtsblatt Nr.8
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt PA sämtl. HH sämtl. PA SÜDLICHES ANHALT Jahrgang 11 · Nummer 8 Donnerstag, den 13. August 2020 www.suedliches-anhalt.de Benefizschwimmen im Freibad Glauzig Am Samstag, dem 1. August, führte der Kultur- und Freibad- Friends“ sowie die Vereinigung „Wir sind Glauzig“ mit dem verein Glauzig e. V. im Auftrag der E3 Windenergie mit dem Ortschaftsrat Glauzig, „Ollitron“, KRS GmbH, KSD GmbH Windpark wpd Windmanager GmbH & Co. KG ein Benefiz- und die Siebdruckerei Zipf, die als ein wichtiger Bestandteil schwimmen für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung, des Freibadvereins wirken. Die Veranstaltung konnte trotz die Kinderkrebshilfe Halle/S. und den Tierpark Köthen durch. der strengen Corona-Auflagen gut gemeistert werden. Eine Trotz der durch die Corona-Situation kurzen Vorbereitungs- gute Zusammenarbeit mit der Stadt Südliches Anhalt sowie zeit kamen ca. 90 Schwimmer in das Freibad, um eine mög- dem Gesundheitsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld war lichst hohe Spendensumme zu erzielen. Das Ergebnis konn- ausschlaggebend für den Erfolg der Aktion. Erschwommen te sich sehen lassen. Geschwommen wurden 180375 m im wurde eine Summe von 5000 €. Hinzu kamen zahlreiche Ein- Becken des Freibades und 20 km in anderen Becken, da zelspenden. Die Gesamtsumme wurde aufgrund des ausge- die Teilnehmer für den Termin verhindert waren. Der Kapitän glichenen Ergebnisses auf alle drei Institutionen gleichmäßig der MEC 04 Saale Bulls, Kai Schmitz, und der Publikums- aufgeteilt. liebling Stürmer Sergej Stas sowie die Profi-Boxer Tom und Dirk Dzemski, Robert Stieglitz, Elvis Hetemi, Jurgen Uldedaj Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die die Veranstal- vom SES gaben Autogramme und schwammen für die gute tung unterstützt haben. -
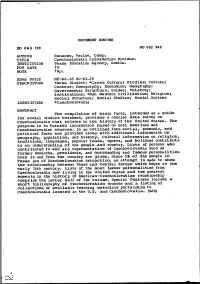
For Social Etudies Teachers, Provides a Concise Data Survey On
DOCUMENT RES'JME ED 063 199 SO 002 948 AUTHOR Hunacek, Vac lav, Comp. TITLE Czechoslovakia Inf ormation Minimum. INSTITUTION Texas Education Agency, Austin. PUB DATE 70 NOTE 78p. EDRS PRICE MF-$0.65 HC-$3.29 DESCRIPTORS *Area Studies; *Cross Cultural Studies;Cultural Context; Demography; Economics; Geography; Governmental Structure; Guides; *History; Institutions; *Non Western Civilization;Religion; Social Structure; Social Studies; Social Systems IDENT IF IERS *Czechoslovakia ABSTRACT The compilation of basic facts, intended as aguide for social Etudies teachers, provides aconcise data survey on Czechoslovakia that relates to the history of theUnited States. The purpose is to furnish informationbased on both American and Czechoslovakian sources. In an outlined form social,economic, and political facts are provided along with additionalinformation on geography, copulation, and history. Culturalinformation on religion, traditions, languages, popular foods, sports, andholidays contribute to an understanding of the people and country.Lists of persons who contributed to and are representative ofCzechoslovakia such as former monarchs, presidents, and outstanding andfamous personalities born in and from the country are given. Since 5%of the people in Texas are of Czechoslovakian extraction, anattempt is made to show the relationship between Texas and Central Europewhich began in the early 16th century. Lists of the most famouspersonalities from Czechoslovakia now living in the United States and tengreatest moments in the history of American-Czechoslovakianrelationship comprise the latter half of the volume. Specialfeatures include a short bibliography of Czechoslovakian sources and alisting of collections of available teaching materialspertaining to Czechoslovakia located in the U.S. and Czechoslovakia. (SJM) rt, .: 4 - 1 !'\.t 1 5. -

Amtsblatt 7 2021.Pdf
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt PA sämtl. HH sämtl. PA SÜDLICHES ANHALT Jahrgang 12 · Nummer 7 Donnerstag, den 8. Juli 2021 www.suedliches-anhalt.de Schlüsselübergabe für die neue Rettungswache in Radegast: v. l. n. r.: Thomas Schneider (Bürgermeister Stadt Südliches Anhalt), Jeanette Wecke (DRK Köthen), Daniel Fleißner (DRK Bitterfeld), Matthias Martz (Rettungsdienstleiter), Rick Pötzsch (Wachenleiter), Dennis Thiele (stellvertretender Wachenleiter), Uwe Schulze (Landrat Anhalt-Bitterfeld) Nach einer Bauzeit von knapp neun Monaten wurde die Ret- sichert den Tagesbetrieb für 12 Stunden ab. Die Sanitäter tungswache in Radegast am 31. Mai 2021 vom Bürgermeis- können sich, solange sie nicht im Einsatz sind, in dem zur Ret- ter Thomas Schneider offiziell an den Landrat Uwe Schulze tungswache umgebauten Gebäude aufhalten. Ein Blick hinter übergeben. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mietet das Objekt die Fassade bringt geschlechtergetrennte Ruheräume, Um- für die Dauer der nächsten 10 Jahre von der Stadt Südliches kleidebereiche und Sanitärbereiche hervor. Aber auch hinter Anhalt. dem Gebäude der Rettungswache lassen sich Veränderun- Mit Beginn des Monat Juli ist die Rettungswache in Rade- gen wahrnehmen. Durch die Bereitstellung von Fördermitteln gast dann durch das Deutsche Rote Kreuz besetzt. Hierfür ist es der Stadt Südliches Anhalt gelungen, die Außenanlage hat der Landkreis als Träger des Rettungsdienstes das Deut- am Gebäude der Falschmünzerei neu zu gestalten. Auch hier sche Rote Kreuz beauftragt. In einer aufwändigen Sanierung, können die Besucher künftig trockenen und sauberen Fußes unter Nutzung einer innerstädtischen Baulücke, wird fortan die Einrichtung erreichen. Insgesamt betrachtet, erhält die nicht nur ein Stück Stadtkern wiederbelebt, sondern vielmehr Stadt Südliches Anhalt mit der Umsetzung dieser Baumaß- im Rahmen der Daseinsfürsorge ein tolles Projekt umgesetzt. -

Rechtsarchäologisches Aus Dem Kreis Köthen
Rechtsarchäologisches aus dem Kreis Köthen Von Wernfried Fieber und Reinhard Schmitt, Halle Seit beinahe zehn Jahren beschäftigen sich die Verfasser folgender kleiner Studie mit der systematischen Bestandsdokumentation von Rechtsdenkmalen im Land Sachsen- Anhalt, den ehemaligen Bezirken Halle und Magdeburg. Erste Ergebnisse dieser Un- tersuchungen liegen bereits vor.! Rechtsdenkmale repräsentieren eine Gruppe von hi- storischen Sachzeugen, die Einblicke in die Rechtsgewohnheiten des späten Mittelalters und der Neuzeit gewähren. Die Forschungsdisziplin, die sich mittels hi- storischer und juristischer Fragestellungen mit dieser Denkmalkategorie beschäftigt, wird „Rechtsarchäologie“ genannt.“ Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR hat diese Forschungsrichtung bis auf Rolande und Steinkreuze wenig Beachtung gefunden. Diese Vernachlässigung hat indes forschungsgeschichtliche Ursachen und hängt insbesondere mit Verzerrungen und Verfälschungen des rechtsarchäologischen Gegenstandes in der Zeit des National- Sozialismus zusammen. Dies führte wiederum dazu, daß Rechtsdenkmale vielfach, wenn nicht gar weitgehend, aus dem öffentlichen Bewußtsein verdrängt, aus Unkennt- nis zweckentfremdet und zerstört wurden. Dafür nur drei Beispiele: Vernichtung des Bauernsteines in Fienstedt (Saalkreis), Zweckentfremdung des Bauernsteines in Groß- Paschleben, Beseitigung des anhaltischen und preußischen Wappens an der ehemali- gen Grenzbrücke über die Fuhne zwischen Glauzig und Werderthau. Diese Auf- zählung könnte ohne weiteres fortgesetzt werden.” Es ist nunmehr -
Zur Entwicklung Der Schweinezucht in Sachsen-Anhalt
1 Zur Entwicklung der Schweinezucht in Sachsen-Anhalt von Tierzuchtleiter Hartmut Boettcher, 99423 Weimar (Stand 2010) 2 Zur Entwicklung der Schweinezucht in Sachsen-Anhalt Die Regionen der ehemaligen Provinz Sachsen und des Fürstentums Anhalt hatten schon immer eine intensive Landwirtschaft mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Dabei spielte die Tierzucht und –haltung auch eine bedeutende Rolle. Beim Zusammentragen des Materials zur Entwicklung der Schweinezucht in Sachsen-Anhalt haben einige Personen wesentlich beigetragen. Stellvertretend seien Siegfried Wiedecke (Stendal), Willi Plescher (Haldensleben), Ernst Rühe (Fischbeck) und Werner Thiele (Apollensdorf) genannt. Der Autor ist aber auch vielen Züchtern bzw. ihren Familien zu Dank verpflichtet, die in teils langen fernmündlichen Gesprächen Details zur Schweinezucht in ihren Orten und Regionen beigetragen haben. 1. Zur Entwicklung der Verwaltung in Sachsen-Anhalt Das heutige Bundesland Sachsen-Anhalt entstand aus der früheren Provinz Sachsen und dem Fürstentum / Freistaat / Land Anhalt. 1.1 Provinz Sachsen Die preußische Provinz Sachsen entstand nach dem Jahre 1800. Eine Voraussetzung war die Enteignung von Fürstbistümern in der Folge des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 (auch als Säkularisierung bekannt). Das betraf das kurmainzische Gebiet von Erfurt, dem Eichsfeld und Nordhausen. Im Ergebnis der Befreiungs- kriege und dem Wiener Kongress wurden bisherige Gebiete der Provinz Brandenburg (Altmark, Herzogtümer aus den früheren Bistümern Halberstadt und Magdeburg) und ein -

Amtsblatt Nr.11
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt SÜDLICHES ANHALT Jahrgang 8 · Nummer 11 Donnerstag, den 9. November 2017 www.suedliches-anhalt.de „Ihr Blätter, wollt ihr tanzen?“ So rief im Herbst der Wind. „Ja, ja, wir wollen tanzen, ja, ja, wir wollen tanzen, komm, hol uns nur geschwind!“ Da fuhr er durch die Äste und pflückte Blatt um Blatt. „Nun ziehen wir zum Feste, nun ziehen wir zum Feste, nun tanzen wir uns satt.“ G. Lang Die nächste Ausgabe Annahmeschluss für redaktionelle erscheint am: Beiträge und Anzeigen: Donnerstag, dem 14. Dezember 2017 Mittwoch, der 29. November 2017 MeldenHerbstlied Sie sich unter: 034978 265-10, per E-Mail: [email protected] P1 Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt Seite 2, Nr. 11/2017 Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Südliches Anhalt Sprechzeiten in den Verwaltungsstellen der Stadt Südliches Anhalt Verwaltungsstellen Weißandt-Gölzau Gröbzig Quellendorf Hauptstraße 31 Markplatz 1 Gartenstraße 1 06369 Südliches Anhalt 06388 Südliches Anhalt 06386 Südliches Anhalt Tel.: 034978 265-0 Tel.: 034976 242-0 Tel.: 034977 403-0 Fax: 034978 265-55 Fax: 034976 242-19 E-Mail: [email protected] Sprechzeiten Weißandt-Gölzau und Gröbzig Quellendorf Montag: - nicht besetzt Dienstag 09:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr nicht besetzt Mittwoch: - 1. + 3. Mittwoch im Monat 09:00 - 12:00 Uhr 2. + 4. Mittwoch im Monat 15:00 - 17:00 Uhr Donnerstag: 09:00 - 12:00 und 13:00 - 15:30 Uhr nicht besetzt Freitag: - nicht besetzt Wichtige Termine außerhalb der Sprechzeiten können mit dem/der zuständigen Mitarbeiter/in -

Amtsblatt Nr.11
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt PA sämtl. HH sämtl. PA SÜDLICHES ANHALT Jahrgang 10 · Nummer 11 Donnerstag, den 14. November 2019 www.suedliches-anhalt.de Blühwiesen – damit es wieder summt und brummt Blühwiesen machen nicht nur das Stadtbild bunter, sie bieten Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten Heimat und Nahrungsquelle. Die kleinen Tierchen spielen eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem, zum Beispiel als Bestäuber der Pflanzen, aber auch als Teil der Nahrungskette. Das eifrige Summen der Bienen und Zwitschern der Vögel ist vielerorts verstummt. In ge- meinsamer Absprache mit den jeweiligen Ortschaftsräten haben wir in acht Ortsteilen (Görzig, Lennewitz, Meilendorf, Pfaffen- dorf, Quellendorf, Radegast, Scheuder und Wörbzig) bereits einige Flächen ausgewählt und mit kleinen Tafeln die Blühwiesen markiert. Wir setzen auf eine Blühsamenmischung aus heimischen Wildblumen und -kräutern, um die regionale Artenvielfalt zu fördern. Wir bitten auch um Ihr Verständnis, denn am Anfang werden Sie sich fragen „Wie sieht es denn hier aus?“. Es braucht Zeit und vor allem Geduld, damit die Blühwiesen ihre Pracht in ganzem Ausmaß zeigen können. Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger für dieses wichtige Thema sensibilisieren und motivieren, selbst aktiv zu werden. Denn nur gemeinsam schaffen wir es, dass unsere Stadt Südliches Anhalt aufblüht. Die Blühsamenmischung besteht aus ca. 60 Wildpflanzenarten, die überwiegend mehrjährig sind und bei richtiger Pflege sehr viele Jahre Lebensraum für viele Tierarten bieten. Fortsetzung auf Seite 17. Die nächste Ausgabe Annahmeschluss für redaktionelle erscheint am: Beiträge und Anzeigen: Donnerstag, dem 12. Dezember 2019 Montag, der 25. November 2019 Melden Sie sich unter: 034978 265-10, per E-Mail: [email protected] P1 Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt Seite 2, Nr. -

Amts- Und Mitteilungsblatt Der Stadt
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt PA sämtl. HH sämtl. PA SÜDLICHES ANHALT Jahrgang 12 · Nummer 5 Mittwoch, den 12. Mai 2021 www.suedliches-anhalt.de Neugestaltung der Freifläche vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Görzig In den vergangenen Wochen wurde die Fläche vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Görzig umgestaltet. Die Arbeiten erfolgten in Zusammenarbeit zwischen dem Ortschaftsrat Görzig und dem Bauhof der Stadt Südliches Anhalt. Für den Rückbau der Fläche organisierte der Ortsbürgermeister Swen Meyer einen Arbeitseinsatz. Das schlechte Wetter an diesem Tag konnte die freiwilligen Helfer nicht davon abbringen, mit guter Laune und viel Tatkraft ans Werk zu gehen. Ob Jung oder Alt, ob Einheimischer oder Kunde des kleinen Edeka - das Fazit für alle steht fest: das neue Erscheinungsbild der Fläche ist ein voller Erfolg! Die nächste Ausgabe Annahmeschluss für redaktionelle erscheint am: Beiträge und Anzeigen: Donnerstag, dem 10. Juni 2021 Dienstag, der 25. Mai 2021 Melden Sie sich unter: 034978 265-10, per E-Mail: [email protected] Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Südliches Anhalt Seite 2, Nr. 5/2021 Amtliche Mitteilungen Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Südliches Anhalt Sprechzeiten in den Verwaltungsstellen der Stadt Südliches Anhalt Verwaltungsstellen Weißandt-Gölzau Gröbzig Quellendorf Hauptstraße 31 Markplatz 1 Gartenstraße 1 06369 Südliches Anhalt 06388 Südliches Anhalt 06386 Südliches Anhalt Tel.: 034978 265-0 Tel.: 034978 265-0 Fax: 034978 265-55 Fax: 034978 265-19 E-Mail: [email protected] Die Verwaltungsgebäude der Stadt Südliches Anhalt bleiben vorerst weiterhin für den Besucherverkehr geschlossen. Wie lange diese Regelung noch gilt, stand zum Zeitpunkt des Druckes des Amts- und Mitteilungsblattes der Stadt Südliches Anhalt noch nicht fest. -

Amtsblatt Nr.5
Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt SÜDLICHES ANHALT Jahrgang 9 · Nummer 5 Freitag, den 11. Mai 2018 www.suedliches-anhalt.de Einladung zur Ausstellungseröffnung im Foyer des Sport- und Kulturzentrums der Stadt Südliches Anhalt in Weißandt-Gölzau Am Donnerstag, dem 24.05.2018, um 18.00 Uhr, wird im Foyer des Sport- und Kulturzentrums der Stadt Südliches Anhalt die erste Ausstellung von Künstlern des Malzirkels des Mehrgenera- tionenhauses Görzig unter Leitung von Herrn Hartmut Schmiegel eröffnet. Zu sehen sind Arbei- ten, die in den Jahren 2014 bis 2018 entstanden sind. Gezeigt werden unter anderem Stillleben in Lasurtechnik und Landschaften in Öl- und Monotypietechnik. Die Mitglieder des Malzirkels treffen sich seit über 9 Jahren regelmäßig. Sie malen miteinander, lernen voneinander und bilden sich künstlerisch fort. Seit 2014 wird der Malkurs im Mehrgenerationenhaus Görzig von Herrn Hartmut Schmiegel geleitet. Es werden verschiedene Maltechniken und Materialien ausprobiert. Die Leidenschaft für das Malen ver- bindet. Im Moment besuchen 12 Erwachsene und Kinder den Kurs. Die jüngste Teilnehmerin ist 11 Jahre und die älteste Teilnehmerin ist 81 Jahre. Treffpunkt ist immer dienstags aller 14 Tage im Atelier des Mehrgenerationenhauses Görzig, Radegaster Straße 11a. Interessierte und Gleichgesinnte sind jederzeit willkommen. Die Ausstellung im Foyer des Sport- und Kulturzen- trums in Weißandt-Gölzau kann bis Ende August immer dienstags von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr besichtigt wer- den. Andere Termine und/ oder Gruppenbesuche kön- nen unter der Rufnummer 034978 26529 vereinbart werden. Die Mitglieder des Malzir- kels des Mehrgenerationen- hauses Görzig und die Stadt Südliches Anhalt laden alle Interessierten recht herzlich „Minna-Anna“ - Öl gespachtelt von Marlies Moritz ein.