Auf Dem Weg Zur Friedlichen Revolution?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Aspen Institute Germany ANNUAL REPORT 2007 2008 the Aspen Institute 2 ANNUAL REPORT 2007 2008 the Aspen Institute ANNUAL REPORT 2007 3 2008
The Aspen Institute Germany ANNUAL REPORT 2007 2008 The Aspen Institute 2 ANNUAL REPORT 2007 2008 The Aspen Institute ANNUAL REPORT 2007 3 2008 Dear Friend of the Aspen Institute In the following pages you will find a report on the Aspen Institute Germany’s activities for the years 2007 and 2008. As you may know, the Aspen Institute Germany is a non-partisan, privately supported organization dedicated to values-based leadership in addressing the toughest policy challenges of the day. As you will see from the reports on the Aspen European Strategy Forum, Iran, Syria, Lebanon and the Balkans that follow, a significant part of Aspen’s current work is devoted to promoting dialogue between key stakeholders on the most important strategic issues and to building lasting ties and constructive exchanges between leaders in North America, Europe and the Near East. The reports on the various events that Aspen convened in 2007 and 2008 show how Aspen achieves this: by bringing together interdisciplinary groups of decision makers and experts from business, academia, politics and the arts that might otherwise not meet. These groups are convened in small-scale conferences, seminars and discussion groups to consider complex issues in depth, in the spirit of neutrality and open mindedness needed for a genuine search for common ground and viable solutions. The Aspen Institute organizes a program on leadership development. In the course of 2007 and 2008, this program brought leaders from Germany, Lebanon, the Balkans and the United States of America together to explore the importance of values-based leadership together with one another. -

DER SPIEGEL Jahrgang 1999 Heft 46
Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 15. November 1999 Betr.: Korrespondenten, Scharping, Belgrad er SPIEGEL als auf- Dlagenstärkstes Nach- richten-Magazin Europas hat auch eine stattliche Zahl von Berichterstat- tern in aller Welt: Zu ei- nem Korrespondenten- treffen reisten vergangene Woche 26 Kollegen aus 22 Auslandsbüros nach Ham- burg. Einige waren etwas länger unterwegs – sie ka- men aus Peking, Rio de Ja- neiro, Johannesburg und Tokio. Die Korresponden- M. ZUCHT / DER SPIEGEL ten kennen sich aus in SPIEGEL-Auslandskorrespondenten Kulturen, Eigenarten und Dialekten ihrer Gastländer. Neben den gängigen Weltsprachen parlieren sie auf Chi- nesisch, Japanisch, Persisch oder Türkisch, auf Hindi, Tamil und in vielen slawischen Sprachen. Sie recherchieren im indischen Andra Pradesch, wo die Menschen Telu- gu sprechen, und führen Interviews auf Hocharabisch – bei Bedarf auch im ägyp- tischen Nildialekt. er Mann, mit dem SPIEGEL-Redakteur DHajo Schumacher, 35, vor vier Jahren im Saal des Mannheimer Kongresszentrums sprach, hatte gerade seine bitterste Niederla- ge erlitten: Eben war Rudolf Scharping noch SPD-Vorsitzender gewesen, nun hatte der Parteitag überraschend Oskar Lafontaine ge- wählt. Ein Debakel. „Über meine Gefühlsla- ge bin ich mir im Unklaren“, vertraute Schar- ping dem SPIEGEL-Mann an. Sieger Lafon- M. DARCHINGER taine hat sich inzwischen geräuschvoll von Schumacher, Scharping (1995) der politischen Bühne verabschiedet, Verlie- rer Scharping aber sieht sich stärker denn je. „In Umfragen bin ich als einziger kaum gefallen“, sagte der Verteidigungsminister vergangene Woche, als Schumacher ihn im Reichstag traf, und: „Mannheim habe ich verarbeitet.“ Tatsächlich? Schumacher hegt Zweifel: „Die Verletzung ging damals viel zu tief“ (Seite 26). elgrad liegt nur eine Flugstunde von Frankfurt entfernt, aber die Reise dorthin Bdauert fast einen Tag. -

MHS Girls Bow to Staples State of Siege Is Declared;
Turmoil Turnovers Wunderbar N.Y. Times reporter MHS fumbles away its shot East Germans enjoy talks about China/3 at beating South Windsor/9 crumbling of wall/5 Jlattrlfpatpr Hrralfi Monday, Nov. 13,1989 Manchester, Conn. — A City of Village Charm Newsstand Price: 35 Cents iBaurliPSlrr Hrralft Bird pumps in 50 Battle rages V as the Celtics win SPORTS see page 45 for control of El Salvador MHS girls bow to Staples State of siege is declared; By Jim Tierney at least 139 reported killed Manchester Herald group called out when they saw By Candice Hughes journalists approaching suburban NORTH HAVEN — Justice seemed to elicit a bitter The Associated Press taste in the aftermath of the Manchester High girls’ soc Metropolis. “All the northern zone (of the cer team’s 1-0 loss to Staples High in a Class L state SAN SALVADOR, El Salvador tournament quarterfinal match Friday afternoon at city) is classified as critical,” said — Government forces fought today Pedro Varela of the Red Cross. He Sachem Field. for control of the capital after leftist One fluke goal 3:58 into the match was the deciding also said such eastern areas as rebels, in their biggest offensive Soyapango, San Bartolo and Ciudad factor between the previously unbeaten second-seeded since 1981, seized parts of San Sal Delgado “are very dangerous.” Indians and the lOth-seeded Wreckers. vador and attacked military posts in A church lay worker speaking on Manchester finishes its fine season at 16-1-1. Staples, the provinces. which will meet Simsbury (a 5-0 winner over condition of anonymity said he had At least 139 people were killed, seen government helicopters bomb Newington) -in the L semifinals, improves its record to including an American teacher, and 12-4. -

Wandel Öffentlich-Rechtlicher Institutionen Im Kontext Historisch
D -369- V. Von der Wiedervereinigung bis zur Gegenwart 5.1 Maueröffnung und Programmleistung des SFB Noch am 29. Dezember 1988 antworteten bei einer Passantenumfrage der Abendschau die meisten Befragten, daß sie trotz Gorbatschows Glasnost- Politik nicht erwarten würden, daß die Mauer in absehbarer Zeit fallen würde. Dennoch war ein weiteres Zeichen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des DDR-Systems die Abschaffung des Zwangsumtauschs Ende Januar 1989 und die damit verbundene Forderung nach einer Änderung des Wechselkurses für die Ost-Mark. In der Westberliner Parteienlandschaft gab es eine Annäherung: am 12. Januar berichtete die Abendschau über ein Koalitionsangebot der Alternativen Liste an die SPD. Als Gemeinsamkeiten stellte die AL die Einführung der Umweltkarte, Tempo 30 in der Innenstadt und den Flächennutzungsplan heraus. Der Regierende Bürgermeister Walter Momper wiegelte jedoch gegenüber SFB-Reporterin Colmar ab; man habe das Ziel, ein Wahlergebnis zu erreichen, das der SPD ein alleiniges Mandat zum Regieren gebe. De facto hatte er schon die Möglichkeit einer Großen Koalition ins Auge gefaßt, war aber innerhalb seiner Partei nicht auf Gegenliebe für diese Option gestoßen. Aus der Wahl am 29.Januar ging die SPD als deutliche Siegerin hervor. Die CDU wurde für den Skandal um den Charlottenburger Baustadtrat Antes abgestraft und erlitt schwere Verluste. Die SPD konnte allerdings nicht allein regieren und war auf die Bildung einer Koalition angewiesen. Am 17. Februar nahm Harald Wolf (Alternative Liste) auf einer Pressekonferenz der Essential-Kommission Stellung zu einer möglichen Koalition. Nachdem die Kommission das staatliche Gewaltmonopol und die Übernahme der Bundesgesetze akzeptiert hatte, erklärte Wolf eine D -370- “praktikable Übereinstimmung” mit der SPD. -

Dem Berliner Ehrenbürger Richard Von Weizsäcker Zum Hundertsten
Dem Berliner Ehrenbürger Richard von Weizsäcker zum Hundertsten Entgegen der Einbahnstraße – von Bonn nach Berlin Einen Pastor hatte Berlin mit Heinrich Albertz bereits als Regierenden Bürgermeister erlebt, wenn auch für die SPD und nur von Dezember 1966 bis September 1967. Der Überraschungsgast, der auf Einladung von Peter Lorenz und mit Empfehlungen von Helmut Kohl im September 1978 nach Berlin kommt, um sich für die CDU um dieses Amt zu bewerben, ist zum Bleiben entschlossen. Richard von Weizsäcker, 1964 Präsident des Evangelischen Kirchentages, Mitverfasser der Denkschrift der Evangelischen Kirche „Zur Lage der Vertriebenen und dem Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“, seit 1969 Mitglied des Bundestages, Anfang der siebziger Jahre Vorsitzender der Grundsatzprogramm-Kommission der CDU, Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 1974 Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten - dieser als Denker und Redner bundesweit bekannte Politiker ohne jede tatsächliche Macht will sich als Handelnder, als Entscheider, als Regierender bewähren – „statt immer nur herumzudenken“, wie er in einem Interview selbstironisch bekennt. Und entgegen dem Trend, Berlin Richtung Westen zu verlassen, zieht es ihn hierher. Der 58-Jährige beim Start zu einer neuen Karriere greift nach dem Stuhl von Ernst Reuter und Willy Brandt. Dabei hat er eine eigenwillige Vorstellung von der Bedeutung dieser Aufgabe. „Bei allem Respekt vor dem höchsten Amt im Staate, dem des Bundespräsidenten – das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin schätze ich höher ein.“ Berlin, Herbst 1978. Die Stadt ist – seit 1961 endgültig? – geteilt. Seit sechs Jahren gibt es dauerhaft 30 Tage jährlich Besuchsmöglichkeiten von West nach Ost, seit 14 Jahren für Rentner von Ost nach West jährlich bis zu vier Wochen. -

Volker Beck (Köln) BÜNDNIS 90/DIE Tagesordnungspunkt 14: GRÜNEN
Plenarprotokoll 14/50 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 50. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 1. Juli 1999 I n h a l t : Festlegung der Zahl und Zusammensetzung Zusatztagesordnungspunkt 5: der zur Mitwirkung an den Sitzungen des Erste Beratung des vom Bundesrat einge- Ausschusses für die Angelegenheiten der Eu- brachten Entwurfs eines Dreiunddreißig- ropäischen Union berechtigten Mitglieder des sten Gesetzes zur Änderung des La- Europäischen Parlaments................................. 4321 A stenausgleichsgesetzes Erweiterung der Tagesordnung........................ 4321 B (Drucksache 14/866).................................. 4322 C Begrüßung der Oberbürgermeisterin von Bonn, Frau Bärbel Dieckmann, sowie des Altbundes- Tagesordnungspunkt 12: präsidenten Richard von Weizsäcker, der ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bun- Vereinbarte Debatte destages Annemarie Renger und Richard „50 Jahre Demokratie – Dank an Bonn“ Stücklen, der ehemaligen Vizepräsidenten des Wolfgang Thierse SPD.................................... 4322 D Deutschen Bundestages Helmuth Becker, Dieter-Julius Cronenberg, Lieselotte Funcke Dr. Helmut Kohl CDU/CSU............................ 4325 B und Dr. Burkhard Hirsch, des früheren polni- Dr. Antje Vollmer BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- schen Außenministers ProfessorWladyslaw NEN................................................................. 4332 A Bartuszewski, des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Bischof Professor Dr. Karl Dr. Wolfgang Gerhardt F.D.P.......................... 4334 C Lehmann, des Metropoliten -

Dodis.Ch/52958 Netherlands Telegram1 from the Dutch
dodis.ch/52958 77 15 dodis.ch/52958 Netherlands Telegram1 from the Dutch Ambassador in Bonn, Jan van der Tas2, to the Dutch Minister of Foreign Affairs, Hans van den Broek3 Berlin 9 November 1989 – the Wall Loses its Relevance Extract Confidential Bonn, 14 November 1989 […]4 Report “Ab sofort” was the answer of the SED Politburo member responsible for in- formation, Schabowski5, after the meeting of the Central Committee on the 9th on the question when the arrangement for travel to the Federal Republic and West Berlin that he had just made public would enter into force. A directive that he pre- sumed was already known to the assembled press, but which he himself clearly did not know intimately. The border guards were also unprepared, but confront- ed by the inflowing masses they threw open the gates at the Borholmer Strasse crossing, stepped back and let the flow of people pass by. Shortly afterwards the other border crossings followed including Checkpoint Charlie. The Wall had – in the words of governing mayor Momper6 – lost its relevance. On 9 November 1989, this inhuman and monstrous edifice that was founded on 13 August 1961 fell. The cornered leadership of the collapsing “First State of Workers and Farmers on German Soil”7 had risked the desperate flight forward to stem the bloodlet- ting of “Republikflucht”8 and regain the trust of the population. In Berlin (West) this “Day of Re-Encounter”9 (Momper) led to an emotionally charged cheerfully chaotic exuberant weekend in which nearly two million peo- ple from the Eastern Sector and all parts of the GDR flowed into the city. -

Der Kleine Diktator Und Sein Gesindel
Der kleine Diktator und sein Gesindel „Apropos, wusstest du, dass das verlogene SED-Regime die Gerüchte über den Mauerbau im Jahre 1961 komplett verneinte?“ „Jan, ich sagte dir doch schon, dass die Geschichte der ehemaligen DDR mir nur semimäßig bekannt ist. Von deinen Insiderstorys habe ich keinen blassen Schimmer.“ „Na, dann hör mal zu, mein lieber Ronny. Unser Genosse Walter Ulbricht, unser einstiger, bis zum 3. Mai 1971, „Erster Sekretär“ des ZK der SED, stellte sich am 15. Juni 1961 auf einer Pressekonferenz den Journalisten. Auf dieser dementierte er Fragen zum Mauerbau wie folgt: ‘Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass eine solche Absicht besteht, da sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.‘ Tja mein Lieber, so frech dementierte seinerzeit der DDR-Staatsratsvorsitzende, unser Spitzbart, Walter Ulbricht, auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin. Stell dir das Mal vor. Damals hatte das Regime meiner Meinung nach bereits den Plan gefasst, den Ostsektor Deutschlands hermetisch von dem restlichen Deutschland, ach, was sage ich, gar von dem gesamten Westen, abzuriegeln. Bereits am 13. August 1961, nur rund zwei Monate später, vor nunmehr rund dreiundfünfzig Jahren, begannen die Arbeiten am Mauerbau. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 gab Walter Ulbricht, der DDR-Staatsratsvorsitzende, der SED- Parteiführer und Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, den Befehl zur Abriegelung der Sektorengrenze in Berlin. -

Global Iconic Events
Global Iconic Events: How News Stories Travel Through Time, Space and Media Julia Sonnevend Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy under the Executive Committee of the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2013 © 2013 Julia Sonnevend All Rights Reserved ABSTRACT Global Iconic Events: How News Stories Travel Through Time, Space and Media Julia Sonnevend This dissertation examines how a news event may become a global social myth. In order to track this voyage from the particular to the universal, I developed a theoretical concept of “global iconic events.” I define global iconic events as news events that are covered extensively and remembered ritually by international media. I suggest five narrative aspects to consider in connection with them: (1) their narrative prerequisites; (2) their elevated and interpretative story; (3) their condensation into a simple phrase, a short narrative, and a recognizable visual scene; (4) their competing stories; and (5) their ability to travel across multiple media platforms and changing social and political contexts. I perform textual analysis on media representations from four distinct national contexts (West German, East German, Hungarian, and American) to examine two case studies. With the help of the central case study, the “fall of the Berlin Wall,” I exhibit the successful social construction of a global iconic event. The second case study, the 1956 Hungarian revolution, illuminates some factors, in particular local counter-narration, incoherent and contextual international representation, forgetting, and marginality of the event’s location, as instrumental in the failure of an event to become a global iconic event. -

Unaufgefordert Nr. 76
unAu f gef ef'd/rt Die Studentenzeitung der Humboldt-Universität I 8. Jahrgang f CD 00 Os 00 t dien II« DEUTSCHE BUNDESBANK gebühren Kein ob lern mehr „,-.* HUNDERT DEUTSCHE MARK Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft I und Kultur 3 DM TESTANGEBOT coi i'o\ AI ss<:n\r.ii)K\ IADSCIIICKKN A.Y Niunr. \ iit'iiiiUli" Sinil.v1. \r. 20080 llamluii ••{ oder per lax: 040/.S7 O.'l 56 57 l'I.Z. Woliiion I 1 I I I I Iclclon/I' a\ j schicken Sie mir 3 Ausgaben der Wochenpost hlf /ahluiigswcisi- (liinc aiiknu/iii) kostenlos zum Kennenlernen. |{('(|iicni und bargeldlos durch liankiihliucluiiii; lianklciizahl I I 1 I I I I I I Koni,,Ar l-'till» ich die WOCI IKM'OST diiiiiii'li rrjjHiiiiilAi,ü beziehen will, brauche i< -11 niilil> weher zu um. Ich erhalle dann dir WOCI II'.M'OST wöflii-iiilii-li |»r l'(»l (ic^t'll Iftchlltllli: (Kille li'M liiiinii: aliwarli'ii) hei I liiiiN l'iii' nur DM 12.70 pro AIIMJÜIIM1 (>iiiil DM :!.()(( im l'.inzclvcikimr). Dalnin. l itlcix liii11 , Kim1 Küiiilifrinif; i.-i jcdn'zcii möirliih. Sullii' irli iiiicli ili'ii l'iiilx'lii'rii'ii .in wi'iii'ii'ii Aii>Lr<il>i'ii Mir isi In-kiiMMl. flfil.^ irli <li<>si- \«>|-4*iitl>iirini<r iiinrrliiilh M>II 7 Tiiir*'!! lirim WtM'.lll'lM'OS'r-MHiim i-ii-SiTiii-f. -JIMIIliltlilinlHir^. srliriniii'-h niili-rriili-n knllii. Ilicill iulci'i'ssiril M-in. Icilc ich die- dein \Y()( '.\ II'.M'OST- Die l'risl lii-.L'iMiil ciilrn 'l"siir IÜH-II \l>M>n<liilii.r (lii>ri- Iti'sIrlluilL' (INisIsIrmpcl). -
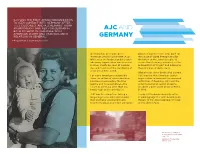
Timeline: AJC and Germany
“AJC WAS THE FIRST JEWISH ORGANIZATION TO SEEK CONTACT WITH GERMANY AFTER THE HOLOCAUST, AND AJC REMAINS TODAY AN IMPORTANT PARTNER FOR GERMANY— AJC AND BOTH IN TERMS OF DIALOGUE WITH AMERICAN JEWRY AND TRANSATLANTIC RELATIONS IN GENERAL.” GERMANY —Angela Merkel, German Chancellor Germany has been part of the power. It was therefore vital, both for American Jewish Committee (AJC) the cause of world freedom and for DNA since the leading global Jewish the future of the Jewish people, to advocacy organization was founded ensure that Germany would reject the in 1906, chiefly by Jews of German antisemitism of its past and adhere to descent, to protect the well-being of the principles of democracy. Jews around the world. With the fall of the Berlin Wall in 1989, For many Americans—especially AJC was the first American Jewish Jews, six million of whose brethren organization to embrace the renewed had been murdered by the Nazi unification of Germany. AJC was the regime and its accomplices—the only international Jewish group to future of Germany after 1945 was establish a permanent office in Berlin, hardly high on the priority list. in 1998. AJC was the exception. Taking a Today, AJC remains uniquely active long-range view, AJC understood in working together with Germany on that Germany would eventually threats to the Jewish people, to Israel, resume its place as a major European and to democracy. Far left: Woman holding her infant daughter at Bamberg DP camp, 1947 Left: Ruins of the Reichstag in Berlin, 1945 IN 1944, AJC AND NBC RADIO BROADCAST LIVE THE FIRST JEWISH SERVICE HELD ON LIBERATED NAZI SOIL. -

Berlin: the New Capital in the East a Transatlantic Appraisal
Harry & Helen Gray Humanities Program Series Volume 7 BERLIN: THE NEW CAPITAL IN THE EAST A TRANSATLANTIC APPRAISAL Edited by Frank Trommler University of Pennsylvania American Institute for Contemporary German Studies The Johns Hopkins University Harry & Helen Gray Humanities Program Series Volume 7 BERLIN: THE NEW CAPITAL IN THE EAST A TRANSATLANTIC APPRAISAL Edited by Frank Trommler University of Pennsylvania The American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) is a center for advanced research, study and discussion on the politics, culture and society of the Federal Republic of Germany. Established in 1983 and affiliated with The Johns Hopkins University but governed by its own Board of Trustees, AICGS is a privately incorporated institute dedicated to independent, critical and comprehensive analysis and assessment of current German issues. Its goals are to help develop a new generation of American scholars with a thorough understanding of contemporary Germany, deepen American knowledge and understanding of current German developments, contribute to American policy analysis of problems relating to Germany, and promote interdisciplinary and comparative research on Germany. Executive Director: Jackson Janes Research Director: Carl Lankowski Development Director: Laura Rheintgen Board of Trustees, Cochair: Steven Muller Board of Trustees, Cochair: Harry J. Gray The views expressed in this publication are those of the author(s) alone. They do not necessarily reflect the views of the American Institute for Contemporary German Studies. ©2000 by the American Institute for Contemporary German Studies ISBN 0-941441-50-4 This Humanities Program Volume is made possible by the Harry & Helen Gray Humanities Program. Additional copies are available for $5.00 to cover postage and handling from the American Institute for Contemporary German Studies, Suite 420, 1400 16th Street, N.W., Washington, D.C.