Stabilität Und Niedergang
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Aspen Institute Germany ANNUAL REPORT 2007 2008 the Aspen Institute 2 ANNUAL REPORT 2007 2008 the Aspen Institute ANNUAL REPORT 2007 3 2008
The Aspen Institute Germany ANNUAL REPORT 2007 2008 The Aspen Institute 2 ANNUAL REPORT 2007 2008 The Aspen Institute ANNUAL REPORT 2007 3 2008 Dear Friend of the Aspen Institute In the following pages you will find a report on the Aspen Institute Germany’s activities for the years 2007 and 2008. As you may know, the Aspen Institute Germany is a non-partisan, privately supported organization dedicated to values-based leadership in addressing the toughest policy challenges of the day. As you will see from the reports on the Aspen European Strategy Forum, Iran, Syria, Lebanon and the Balkans that follow, a significant part of Aspen’s current work is devoted to promoting dialogue between key stakeholders on the most important strategic issues and to building lasting ties and constructive exchanges between leaders in North America, Europe and the Near East. The reports on the various events that Aspen convened in 2007 and 2008 show how Aspen achieves this: by bringing together interdisciplinary groups of decision makers and experts from business, academia, politics and the arts that might otherwise not meet. These groups are convened in small-scale conferences, seminars and discussion groups to consider complex issues in depth, in the spirit of neutrality and open mindedness needed for a genuine search for common ground and viable solutions. The Aspen Institute organizes a program on leadership development. In the course of 2007 and 2008, this program brought leaders from Germany, Lebanon, the Balkans and the United States of America together to explore the importance of values-based leadership together with one another. -

DER SPIEGEL Jahrgang 1999 Heft 46
Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 15. November 1999 Betr.: Korrespondenten, Scharping, Belgrad er SPIEGEL als auf- Dlagenstärkstes Nach- richten-Magazin Europas hat auch eine stattliche Zahl von Berichterstat- tern in aller Welt: Zu ei- nem Korrespondenten- treffen reisten vergangene Woche 26 Kollegen aus 22 Auslandsbüros nach Ham- burg. Einige waren etwas länger unterwegs – sie ka- men aus Peking, Rio de Ja- neiro, Johannesburg und Tokio. Die Korresponden- M. ZUCHT / DER SPIEGEL ten kennen sich aus in SPIEGEL-Auslandskorrespondenten Kulturen, Eigenarten und Dialekten ihrer Gastländer. Neben den gängigen Weltsprachen parlieren sie auf Chi- nesisch, Japanisch, Persisch oder Türkisch, auf Hindi, Tamil und in vielen slawischen Sprachen. Sie recherchieren im indischen Andra Pradesch, wo die Menschen Telu- gu sprechen, und führen Interviews auf Hocharabisch – bei Bedarf auch im ägyp- tischen Nildialekt. er Mann, mit dem SPIEGEL-Redakteur DHajo Schumacher, 35, vor vier Jahren im Saal des Mannheimer Kongresszentrums sprach, hatte gerade seine bitterste Niederla- ge erlitten: Eben war Rudolf Scharping noch SPD-Vorsitzender gewesen, nun hatte der Parteitag überraschend Oskar Lafontaine ge- wählt. Ein Debakel. „Über meine Gefühlsla- ge bin ich mir im Unklaren“, vertraute Schar- ping dem SPIEGEL-Mann an. Sieger Lafon- M. DARCHINGER taine hat sich inzwischen geräuschvoll von Schumacher, Scharping (1995) der politischen Bühne verabschiedet, Verlie- rer Scharping aber sieht sich stärker denn je. „In Umfragen bin ich als einziger kaum gefallen“, sagte der Verteidigungsminister vergangene Woche, als Schumacher ihn im Reichstag traf, und: „Mannheim habe ich verarbeitet.“ Tatsächlich? Schumacher hegt Zweifel: „Die Verletzung ging damals viel zu tief“ (Seite 26). elgrad liegt nur eine Flugstunde von Frankfurt entfernt, aber die Reise dorthin Bdauert fast einen Tag. -

Wandel Öffentlich-Rechtlicher Institutionen Im Kontext Historisch
D -369- V. Von der Wiedervereinigung bis zur Gegenwart 5.1 Maueröffnung und Programmleistung des SFB Noch am 29. Dezember 1988 antworteten bei einer Passantenumfrage der Abendschau die meisten Befragten, daß sie trotz Gorbatschows Glasnost- Politik nicht erwarten würden, daß die Mauer in absehbarer Zeit fallen würde. Dennoch war ein weiteres Zeichen für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des DDR-Systems die Abschaffung des Zwangsumtauschs Ende Januar 1989 und die damit verbundene Forderung nach einer Änderung des Wechselkurses für die Ost-Mark. In der Westberliner Parteienlandschaft gab es eine Annäherung: am 12. Januar berichtete die Abendschau über ein Koalitionsangebot der Alternativen Liste an die SPD. Als Gemeinsamkeiten stellte die AL die Einführung der Umweltkarte, Tempo 30 in der Innenstadt und den Flächennutzungsplan heraus. Der Regierende Bürgermeister Walter Momper wiegelte jedoch gegenüber SFB-Reporterin Colmar ab; man habe das Ziel, ein Wahlergebnis zu erreichen, das der SPD ein alleiniges Mandat zum Regieren gebe. De facto hatte er schon die Möglichkeit einer Großen Koalition ins Auge gefaßt, war aber innerhalb seiner Partei nicht auf Gegenliebe für diese Option gestoßen. Aus der Wahl am 29.Januar ging die SPD als deutliche Siegerin hervor. Die CDU wurde für den Skandal um den Charlottenburger Baustadtrat Antes abgestraft und erlitt schwere Verluste. Die SPD konnte allerdings nicht allein regieren und war auf die Bildung einer Koalition angewiesen. Am 17. Februar nahm Harald Wolf (Alternative Liste) auf einer Pressekonferenz der Essential-Kommission Stellung zu einer möglichen Koalition. Nachdem die Kommission das staatliche Gewaltmonopol und die Übernahme der Bundesgesetze akzeptiert hatte, erklärte Wolf eine D -370- “praktikable Übereinstimmung” mit der SPD. -

Volker Beck (Köln) BÜNDNIS 90/DIE Tagesordnungspunkt 14: GRÜNEN
Plenarprotokoll 14/50 Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 50. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 1. Juli 1999 I n h a l t : Festlegung der Zahl und Zusammensetzung Zusatztagesordnungspunkt 5: der zur Mitwirkung an den Sitzungen des Erste Beratung des vom Bundesrat einge- Ausschusses für die Angelegenheiten der Eu- brachten Entwurfs eines Dreiunddreißig- ropäischen Union berechtigten Mitglieder des sten Gesetzes zur Änderung des La- Europäischen Parlaments................................. 4321 A stenausgleichsgesetzes Erweiterung der Tagesordnung........................ 4321 B (Drucksache 14/866).................................. 4322 C Begrüßung der Oberbürgermeisterin von Bonn, Frau Bärbel Dieckmann, sowie des Altbundes- Tagesordnungspunkt 12: präsidenten Richard von Weizsäcker, der ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bun- Vereinbarte Debatte destages Annemarie Renger und Richard „50 Jahre Demokratie – Dank an Bonn“ Stücklen, der ehemaligen Vizepräsidenten des Wolfgang Thierse SPD.................................... 4322 D Deutschen Bundestages Helmuth Becker, Dieter-Julius Cronenberg, Lieselotte Funcke Dr. Helmut Kohl CDU/CSU............................ 4325 B und Dr. Burkhard Hirsch, des früheren polni- Dr. Antje Vollmer BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- schen Außenministers ProfessorWladyslaw NEN................................................................. 4332 A Bartuszewski, des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Bischof Professor Dr. Karl Dr. Wolfgang Gerhardt F.D.P.......................... 4334 C Lehmann, des Metropoliten -

Dodis.Ch/52958 Netherlands Telegram1 from the Dutch
dodis.ch/52958 77 15 dodis.ch/52958 Netherlands Telegram1 from the Dutch Ambassador in Bonn, Jan van der Tas2, to the Dutch Minister of Foreign Affairs, Hans van den Broek3 Berlin 9 November 1989 – the Wall Loses its Relevance Extract Confidential Bonn, 14 November 1989 […]4 Report “Ab sofort” was the answer of the SED Politburo member responsible for in- formation, Schabowski5, after the meeting of the Central Committee on the 9th on the question when the arrangement for travel to the Federal Republic and West Berlin that he had just made public would enter into force. A directive that he pre- sumed was already known to the assembled press, but which he himself clearly did not know intimately. The border guards were also unprepared, but confront- ed by the inflowing masses they threw open the gates at the Borholmer Strasse crossing, stepped back and let the flow of people pass by. Shortly afterwards the other border crossings followed including Checkpoint Charlie. The Wall had – in the words of governing mayor Momper6 – lost its relevance. On 9 November 1989, this inhuman and monstrous edifice that was founded on 13 August 1961 fell. The cornered leadership of the collapsing “First State of Workers and Farmers on German Soil”7 had risked the desperate flight forward to stem the bloodlet- ting of “Republikflucht”8 and regain the trust of the population. In Berlin (West) this “Day of Re-Encounter”9 (Momper) led to an emotionally charged cheerfully chaotic exuberant weekend in which nearly two million peo- ple from the Eastern Sector and all parts of the GDR flowed into the city. -

Auf Dem Weg Zur Friedlichen Revolution?
Martin Gutzeit (Hg.) Auf dem Weg zur Friedlichen Revolution? Ost-Berlin in den Jahren 1987/88 Berlin 2011 4. Auflage Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR Band 26 Copyright 2008 beim Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staats- sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 4., unveränderte Auflage, 2011 Alle Rechte vorbehalten, insbesondere der Übersetzung, der Vervielfältigung jeder Art, des Nachdrucks, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektroni- schen Systemen sowie in Funk- und Fernsehsendungen, auch bei auszugsweiser Verwendung. Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Berliner Landesbeauf- tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR dar. Für die inhaltlichen Aussagen trägt der Autor die Verantwortung. ISBN: 978-3-934085-28-2 Umschlagfoto: Mitglieder von Friedensgruppen und der Kirche von Unten (KvU) auf dem offiziellen Kirchentag in Ost-Berlin, 28.06.1987 Quelle: Archiv Stiftung Aufarbeitung, Bestand Klaus Mehner, Nr. 87_0628_ARDtv_EvKT_07 Der Berliner Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Scharrenstraße 17, 10178 Berlin Telefon: (030) 24 07 92 - 0; Fax: (030) 24 07 92 - 99 Internet: www.berlin.de/stasi-landesbeauftragter Inhalt Vorwort .............................................................................................. 4 Ilko-Sascha Kowalczuk Berlin 1987 – auf dem Weg zur Friedlichen Revolution? Inszenierung, Wahrnehmung, Realität .............................................. -

Unaufgefordert Nr. 76
unAu f gef ef'd/rt Die Studentenzeitung der Humboldt-Universität I 8. Jahrgang f CD 00 Os 00 t dien II« DEUTSCHE BUNDESBANK gebühren Kein ob lern mehr „,-.* HUNDERT DEUTSCHE MARK Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft I und Kultur 3 DM TESTANGEBOT coi i'o\ AI ss<:n\r.ii)K\ IADSCIIICKKN A.Y Niunr. \ iit'iiiiUli" Sinil.v1. \r. 20080 llamluii ••{ oder per lax: 040/.S7 O.'l 56 57 l'I.Z. Woliiion I 1 I I I I Iclclon/I' a\ j schicken Sie mir 3 Ausgaben der Wochenpost hlf /ahluiigswcisi- (liinc aiiknu/iii) kostenlos zum Kennenlernen. |{('(|iicni und bargeldlos durch liankiihliucluiiii; lianklciizahl I I 1 I I I I I I Koni,,Ar l-'till» ich die WOCI IKM'OST diiiiiii'li rrjjHiiiiilAi,ü beziehen will, brauche i< -11 niilil> weher zu um. Ich erhalle dann dir WOCI II'.M'OST wöflii-iiilii-li |»r l'(»l (ic^t'll Iftchlltllli: (Kille li'M liiiinii: aliwarli'ii) hei I liiiiN l'iii' nur DM 12.70 pro AIIMJÜIIM1 (>iiiil DM :!.()(( im l'.inzclvcikimr). Dalnin. l itlcix liii11 , Kim1 Küiiilifrinif; i.-i jcdn'zcii möirliih. Sullii' irli iiiicli ili'ii l'iiilx'lii'rii'ii .in wi'iii'ii'ii Aii>Lr<il>i'ii Mir isi In-kiiMMl. flfil.^ irli <li<>si- \«>|-4*iitl>iirini<r iiinrrliiilh M>II 7 Tiiir*'!! lirim WtM'.lll'lM'OS'r-MHiim i-ii-SiTiii-f. -JIMIIliltlilinlHir^. srliriniii'-h niili-rriili-n knllii. Ilicill iulci'i'ssiril M-in. Icilc ich die- dein \Y()( '.\ II'.M'OST- Die l'risl lii-.L'iMiil ciilrn 'l"siir IÜH-II \l>M>n<liilii.r (lii>ri- Iti'sIrlluilL' (INisIsIrmpcl). -
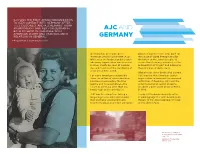
Timeline: AJC and Germany
“AJC WAS THE FIRST JEWISH ORGANIZATION TO SEEK CONTACT WITH GERMANY AFTER THE HOLOCAUST, AND AJC REMAINS TODAY AN IMPORTANT PARTNER FOR GERMANY— AJC AND BOTH IN TERMS OF DIALOGUE WITH AMERICAN JEWRY AND TRANSATLANTIC RELATIONS IN GENERAL.” GERMANY —Angela Merkel, German Chancellor Germany has been part of the power. It was therefore vital, both for American Jewish Committee (AJC) the cause of world freedom and for DNA since the leading global Jewish the future of the Jewish people, to advocacy organization was founded ensure that Germany would reject the in 1906, chiefly by Jews of German antisemitism of its past and adhere to descent, to protect the well-being of the principles of democracy. Jews around the world. With the fall of the Berlin Wall in 1989, For many Americans—especially AJC was the first American Jewish Jews, six million of whose brethren organization to embrace the renewed had been murdered by the Nazi unification of Germany. AJC was the regime and its accomplices—the only international Jewish group to future of Germany after 1945 was establish a permanent office in Berlin, hardly high on the priority list. in 1998. AJC was the exception. Taking a Today, AJC remains uniquely active long-range view, AJC understood in working together with Germany on that Germany would eventually threats to the Jewish people, to Israel, resume its place as a major European and to democracy. Far left: Woman holding her infant daughter at Bamberg DP camp, 1947 Left: Ruins of the Reichstag in Berlin, 1945 IN 1944, AJC AND NBC RADIO BROADCAST LIVE THE FIRST JEWISH SERVICE HELD ON LIBERATED NAZI SOIL. -

Berlin: the New Capital in the East a Transatlantic Appraisal
Harry & Helen Gray Humanities Program Series Volume 7 BERLIN: THE NEW CAPITAL IN THE EAST A TRANSATLANTIC APPRAISAL Edited by Frank Trommler University of Pennsylvania American Institute for Contemporary German Studies The Johns Hopkins University Harry & Helen Gray Humanities Program Series Volume 7 BERLIN: THE NEW CAPITAL IN THE EAST A TRANSATLANTIC APPRAISAL Edited by Frank Trommler University of Pennsylvania The American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) is a center for advanced research, study and discussion on the politics, culture and society of the Federal Republic of Germany. Established in 1983 and affiliated with The Johns Hopkins University but governed by its own Board of Trustees, AICGS is a privately incorporated institute dedicated to independent, critical and comprehensive analysis and assessment of current German issues. Its goals are to help develop a new generation of American scholars with a thorough understanding of contemporary Germany, deepen American knowledge and understanding of current German developments, contribute to American policy analysis of problems relating to Germany, and promote interdisciplinary and comparative research on Germany. Executive Director: Jackson Janes Research Director: Carl Lankowski Development Director: Laura Rheintgen Board of Trustees, Cochair: Steven Muller Board of Trustees, Cochair: Harry J. Gray The views expressed in this publication are those of the author(s) alone. They do not necessarily reflect the views of the American Institute for Contemporary German Studies. ©2000 by the American Institute for Contemporary German Studies ISBN 0-941441-50-4 This Humanities Program Volume is made possible by the Harry & Helen Gray Humanities Program. Additional copies are available for $5.00 to cover postage and handling from the American Institute for Contemporary German Studies, Suite 420, 1400 16th Street, N.W., Washington, D.C. -
Mitteimngefi^ DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS GEGRÜNDET 1865
Berliner " ibiiotheK "^,•41015 F Pflichtexemplar MITTEimNGEfi^ DES VEREINS FÜR DIE GESCHICHTE BERLINS GEGRÜNDET 1865 92. Jahrgang Heftl Januar 1996 „Sophia Carolina Regina Prussiae." Bildnis der Königin, Johann Georg Wolfgang nach Gedeon Romandon. Die preußische Königskrönung Von Gerhild H. M. Komander Mit der Eröffnung des kleinen Kronkabinetts im Schloß Charlottenburg am 18. Januar 1995, in dem die Überreste der brandenburgisch-preußischen Kroninsignien gezeigt werden, ist auch der „Krönungszug" der Öffentlichkeit wieder zugänglich: „Der Königlich-Preußischen Crö- nung Hochfeyerliche Solemnitäten auf Allergnädigsten Befehl Seiner Königl. Majestät in Preußen. In zwantzig Kupffer-Platten vorgestellet. Durch Johann Georg Wolffgang. S. Königl. Maj. in Preussen Hoff-Kupfferstecher und Mitglied der Academie der Künsten. Berlin Anno 1712. Cum Privilegio Regis." Das Stichwerk, aus Anlaß der Krönung des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. zum König in Preußen am 18. Januar 1701 in Auftrag gegeben, wurde von Johann Georg Wolfgang nach Zeichnungen Johann Friedrich Wenzels auf 28 Kupferplat ten angefertigt.1 Das überragende Ereignis der preußischen Königskrönung hatte nach „ereig nislosen" und deshalb um so friedlicheren Jahren den Anstoß gegeben, Geschichte mit dem Grabstichel festzuhalten. Friedrich I. selbst gab den Auftrag und teilte seinem anläßlich der Krönung zum Oberzeremonienmeister ernannten Zeremonienmeister Johann von Besser (1654—1729) die Aufgabe zu, den Text zu dem geplanten Werk zu verfassen.2 Besser hatte bereits unter Friedrich Wilhelm gedient und in dieser Zeit — seit 1687 — das Amt des Regierungsrates im Herzogtum Magdeburg bekleidet. Friedrich I. übernahm ihn in seine Dienste, übertrug ihm anläßlich der Erbhuldigung des Herzogtums Preußen 1690 das Amt des Zeremonienmeisters und adelte ihn. Unter den zahlreichen Lob-, Leichen- und Trostschriften Bessers bleibt die Geschichte der preußischen Königskrönung die für die Nachwelt wichtigste und kann zugleich als die getreueste Erzählung des Verlaufs dieser Begebenheit gewertet wer den. -
KAS Annual Report 2008, Perspectives 2009
08 09 ANNU A L R E P O R T 2 0 0 8 P E R SPECTIVES 2009 3 | FOREWORD 5 | HIGHLIGHTS 11 | PERSPECTIVES 2008 | 2009 No Reason for Discouragement – Europe in an Election Year: Taking Stock ........ 12 Banks on the Brink – the Financial Crisis through the Lens of the Social Market Economy ................. 15 Continuity and Change – Options for a Resilient Foreign and Security Policy in Times of Crisis .................... 18 China’s Involvement in Africa: Caught between Competition and Partnership with the Old Donor Countries ........ 21 India Wants to Cross the Threshold. The KAS has been Committed to the Subcontinent for Forty Years ......................... 23 Two Foundings of State: In 1949 the Course was Set for Success and Failure of the Two Germanies .................. 24 1989 – Before the Fall of the Wall .................. 27 Anniversaries of Unification and Freedom: Setting the Stage for the Future .................... 30 33 | FOUNDATION About Us .................................................... 34 We would Like to Thank our Donors, Supporters and Sponsors .............................. 35 International Cooperation ............................. 36 Politics and Consulting ................................. 43 Civic Education ............................................ 46 Scholarships and Culture .............................. 49 Reference and Research Services/ Archives of Christian-Democratic Policy .......... 53 Konrad Adenauer‘s Villa la Collina – Culture and Politics on Lake Como .................. 56 57 | -

UID 1983 Nr. 39, Union in Deutschland
Z 8398 C nf°miationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands Union in Deutschlandm Bonn, den 8. Dezember 1983 • HAUSHALT '84 >Hjghr Regierung 4 Milliarden weniger Schulden — weiter Sparsamkeit und Solidität ^glmut Kohl Seite 3 • BÜROKRATIE Gesetze und Verordnungen wer- Es geht wieder den entrümpelt Seite 6 • VORRUHESTAND aufwärts Erfolgversprechende Maßnahmen iih*h der Debatte Im Deutschen Bundestag gegen die Arbeitslosigkeit Seite 9 ,e aür? Nachrüstung Ist die Entscheidung zu- • STIFTUNG Cien der Redens- und Sicherheitspolitik Bu Die Geburt eines Kindes darf d ' ndesregierung, und damit zugunsten nicht am Geld scheitern Seite 10 it,,» Etlichen Allianz und der Freundschaft Cu USA gefallen. Jetzt treten die Fragen • PARTEIEN- C? der Wiederbelebung und der Zukunft der FINANZIERUNG hen tfoiu Wirtschaft in den Vordergrund, Neuordnung-sichert Parteien- He,ner C!S Geißler vor der Presse in Bonn freiheit und Chancengleichheit I *M5. Dezember). Deshalb wird sich die CDU Seite 11 Arhi ,ten "alben Jahr in ihrer politischen tu?*** darauf konzentrieren, wie die Zukunft • CDU BERLIN Und Ihn, esrepublik Deutschland als führende Eberhard Diepgen wurde neuer «strlenation gesichert werden kann. Vorsitzender Seite 15 Gene t|0I ralsekretär hat in einem Brief an alle Funk- • CDU SCHLESWIG- I •*- und Mandatsträger der Partei eine Leistungsbi- d J l*T Regierung Helmut Kohl vorgelegt (Wortlaut HOLSTEIN Gru lefes im grünen Teil). Diese Bilanz ist die Gerhard Stoltenberg am Steuer s laQe für die im nördlichsten Bundesland o*N weiterführende wirtschafts- und Seite 17 ö. '«Politische Diskussion in der CDU. **r fS.skusslon beginnt mit dem Bundesausschuß • DOKUMENTATION U am 12 nen B - Dezember in Bonn. Auf diesem „Klei- Wortlaut des Briefes von parteitag" werden neben dem Vorsitzenden der Generalsekretär Heiner Geißler (Fortsetzung auf Seite 2) an die Partei grüner Teil UiD 39 • 8.