Festvortrag Zum 75.Geburtstag Der Aumühler Kirche
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verteilerstellen Lauenburg
Verteilerstellen Lauenburg Bäckerei Dittmer Lauenburger Landstr. 18 21039 Börnsen Amt Hohe Elbgeest Börnsener Str. 21 21039 Börnsen Budnikowsky - Filiale 191 Hermann-Wöhlke-Weg 2 21039 Börnsen Frischemarkt Börnsen Lauenburger Landstr. 32 21039 Börnsen Bäckerei Dittmer Stubbenberg 8 21039 Escheburg Gemeindeverwaltung Hofweg 6 21039 Escheburg EDEKA Am Casinopark 14 21465 Wentorf Budnikowski Echardusstieg 6 21465 Wentorf Edeka Markt Sniyders Hauptstr. 2-4 21465 Wentorf Gemeindeverwaltung Hauptstr. 16 21465 Wentorf MiniMal Rewe Hamburger Landstr. 38 21465 Wentorf Recyclinghof Wentorf Auf dem Ralande 11 21465 Wentorf Schuh-Engel Südring 38 21465 Wentorf Edeka Markt Böcker Büchener Weg 5 -7 21481 Lauenburg Rossmann Berliner Str. 16 21481 Lauenburg Famila Mecklenburger Str. 1 21481 Lauenburg Amt Lauenburg Amtsplatz 6 21481 Lauenburg Recyclinghof Lauenbu Juliusburger Landstr. 12 21481 Lauenburg Rewe Markt Reeperbahn 39 21481 Lauenburg Sven Wöhl Twiete 7 21481 Schnakenbek Gemeinde Schnakenbek Krüzener Weg 1 21481 Schnakenbek Gemeindeverwaltung Gülzow Hauptstr. 21 21483 Gülzow Nordoel Tankstelle Bundesstr. 39 21493 Elmenhorst Lehmann Finkenweg 13 21493 Elmenhorst Hrzgt.Lbg. Gemeindeverwaltung Eikhof 23 21493 Fuhlenhagen Gemeinde Grabau Grover Weg 8 21493 Grabau Recyclinghof Lanken Kesselflicker Str. 14 21493 Lanken AWSH Abfallwirtschaft Leineweberring 13 21493 Lanken Budnikowski Compestr. 1 21493 Schwarzenbek Rossmann Hans Koch Ring 6 21493 Schwarzenbek Neukauf Hans Koch Ring 6 21493 Schwarzenbek Rossmann Lauenburger Str. 10 21493 Schwarzenbek Rewe Markt Hamburger Str. 101 21493 Schwarzenbek Rathaus Ritter-Wulf-Platz 1 21493 Schwarzenbek Amt Schwarzenbek Land Gülzower Str. 1 21493 Schwarzenbek Gemeinde Talkau Friedhofstr. 1 a 21493 Talkau Famila Spandauer Str. 31 21502 Geesthacht Budnikowski Bergedorfer Str. 48 21502 Geesthacht Drogerie Wulkow Bergedorfer Str. 35 21502 Geesthacht Sky Norderstr. -

Br214 Sept2019
September 2019, Nr.214 BÖRNSENER RUNDSCHAU ● 60 Jahre Heimatfest Börnsen ● Sportstätten – Finanzierung immer ungewisser ● Günstiger Wohnraum ist gefragt ● Leute - Heute, -die Schulsekretärinnen ● Aus den Vereinen Besuchen Sie unsere Ausstellung Mo. bis Fr. 8 - 18 Uhr Zwischen den Kreiseln 8, Samstag 10 - 13 Uhr 21039 Börnsen www.autohaus-am-sachsenwald.de ● Tel. 040 / 720 080 89 börnsener börnsener rundschau rundschau Börn Börnsson abdruck passen. Oder endlich mal hinten schieben. Schwieriger wird es, Liebe Börnsenerinnen den Schuppen aufräumen. Die alten den SUV zu verstecken. Vielleicht und Börnsener, handbetriebenen Geräte hervorho- mehr so beim Nachbarn vor die Tür len, schön sauber machen und dafür stellen? Oder zwei Straßen weiter? wir kennen alle den Ausspruch: „Wer den bösen Aufsitzmäher ganz nach zu spät kommt, den bestraft das Leb- en.“ Leider ist die Frist für die Bewer- bung als SPD-Vorsitzende verstri- liegt alschen PDF und aus vor Börnsen hat sich wieder niemand gemeldet. Es ist schon be- schämend, dass unser schönes Dorf immer nur von Auswärtigen vertreten werden soll. Aber immerhin, Nina Scheer und Ralf Stegner sind dabei, leider nicht als Team. Schade eigent- lich. Dann vielleicht beim nächsten Mal. War aber auch ein schlechtes Besuchen Sie unsere Ausstellung Timing, so mitten in der Urlaubszeit. Da haben wir schließlich was anderes zu tun. Z.B.: Verreisen, natürlich zu Mo. bis Fr. 8 - 18 Uhr Zwischen den Kreiseln 8, 21039 Börnsen Fuß mit zweimal zu großen Schuhen, Samstag 10 - 13 Uhr damit wir in den ökologischen Fuß- www.autohausamsachsenwald.de ● Tel. 040 / 720 080 89 liegt als PDF vor Inhalt Glücklich ist, wer noch hinterm Haus Börn Börnsson ........................................................... -

Fare Zone Plan USAR
Neumünster Groß Schmalensee Kummerfeld Bornhöved Schlamersdorf A 1 Trappenkamp Tarifplan Zeichenerklärung / Key to signs Boostedt 903 Rickling 913 Fare Zone Plan Brokenlande 904 RB 82 Großenaspe Warder Bezeichnung der Tarifringe 823 Wahlstedt Klein Rönnau C Description of fare rings 803 Wiemersdorf Eekholt Strenglin Fahrenkrug 804 Mönkhagen Neumünster/ Nr. der Tarifzone Kiel/Flensburg Bad Bramstedt Wittenborn Bad Segeberg Weede Goldenbek 204 Armstedt 813 Number of the fare zone Bad Bramstedt Hartenholm Mözen Zarpen Kurhaus 914 Strukdorf Mönkloh Lentföhrden Todesfelde 0 Lübeck Tarifzonengrenzen Altengörs RE 8 703 714 E 8 Dauenhof R Fare zone boundaries Nützen Struvenhütten Leezen 805 724 RB Hamberge 702 dodenhof Wakendorf I 82 Reinfeld Groß Seth Grönau Tarifzonengrenze und Grenze Holstentherme Sülfeld (Holst) 614 Fresenburg von Hamburg AB 71 Lutzhorn Kaltenkirchen A 2 Kisdorf 704 B 614/703 Sievershütten R Kaltenkirchen Süd 915 Fare zone boundary and 70 Wesenberg RE Grabau Kronsforde 7 Itzstedt 705 Hamburg AB boundary Horst E Langeln Henstedt-Ulzburg 81 Bad Oldesloe (Holst) R Bargfeld- B 825 Barmstedt 604 Wakendorf II Stegen R Barnitz Itzehoe/ Alveslohe Ulzburg Süd Nahe 80 Westerland Sparrieshoop Barmstedt A 3 RE 8 R Schnellbahnverkehr (Sylt) Brunnenstraße 605 E E Meeschensee R 8 R 3 Rapid Transit (USA-Bahn) E 6 613 Haslohfurth Wilstedt Kayhude Elmenhorst Lasbek RB Hemdingen Kupfermühle } 61 Langenmoor Voßloch Tanneneck Quickborner Str. 815 RB 504 725 71 Bokholt Friedrichsgabe Tangstedt Berkenthin Mustin Regionalverkehr Ellerau 503 Bargteheide -

Marianne & Hans-Georg Hundt
www.dersachsenwalder.de Juli 2019 Land, Leben & Leute am Sachsenwald An alle erreichbaren Haushalte in Aumühle, Wohltorf, Dassendorf, Krabbenkamp Marianne & Hans-Georg Hundt Augenweide. Pflanzenfreunde.Insektenweide Mitteilungen, Nachrichten, Termine und Bürgermeisterbriefe + Amt Hohe Elbgeest + Gemeinde Aumühle + Gemeinde Wohltorf + Gemeinde Dassendorf + (Sport-)Vereine + Serviceclubs + + Ev.-Luth. Kirchengemeinde Aumühle + Heilig-Geist-Kirche Wohltorf + WAS IST LOS BEI UNS: INHALT IM JULI 2019 07 AMT HOHE ELBGEEST 06.07. 08.07. GEMEINDE AUMÜHLE 20 Uhr 17 Uhr 08 Bürgermeisterbrief Knut Suhk IMPROFEUER AUF FONTANES 09 WILLKOMMEN GRILLSAISON! Polizeibericht Aumühle Improvisionstheater SPUREN Lassen Sie sich von unseren EXPERTEN 10 Freiwillige Feuerwehr Aumühle Diavortrag an der FLEISCHTHEKE kompetent 16 DRK Aumühle Tonteichbad Wohltorf Theater Augustinum beraten: Wir halten eine große Auswahl 18 ZONTA Club Aumühle-Sachsenwald e.V. an Grillspezialitäten für Sie bereit. Unser FEINSCHMECKER-TIPP: Dry Aged 20 Grundschule Aumühle Unser Juli-Titel: US-Beef aus dem Reifeschrank – 22 TuS Aumühle-Wohltorf 13.07. 15.07. Seit 1983 wohnhaft in Wohltorf, war Marianne Hundt schon ein echter Fleischgenuss. 20 Uhr 19 Uhr immer interessiert an Pflanzen und Gartengestaltung. 1998 rief 30 KuBA e.V. sie in Wohltorf die "Offene Gartenpforte" ins Leben, gleichzei- Alle weiteren Köstlichkeiten rund um Ihr perfektes COUNTRY COMFORT ZYPERN tig arbeitete sie nach einer entsprechenden Ausbildung bei einer BBQ müssen Sie sich nur noch zusammenstellen. KIRCHENGEMEINDE AUMÜHLE Konzert Multivisionsvortrag Gartenarchitektin als freie Gartengestalterin. Gemeindebrief Beatrix Jenckel, Vors. KGR Am Casinopark 14 28 Jetzt im Ruhestand findet sie seit drei Jahren, auch mit der tatkräf- 21465 Wentorf 26–30 Nachrichten der ev.-luth. Kirchengemeinde/-musik Tonteichbad Wohltorf Theater Augustinum tigen Unterstützung ihres Mannes Hans-Georg, viel Freude bei der Gestaltung und Pflege eines Straßenbeetes am Eingang 040 / 720 19 98 GEMEINDE WOHLTORF von Wohltorf (Ecke Billtal/Billgrund). -

St. Petri Und Pauli-Kirche Zu Bergedorf
St. Petri und Pauli-Kirche zu Bergedorf von Gerd Hoffmann, 1994/2006 © BBV-2006-07 Im historischen Zentrum Bergedorfs steht die St. Petri und Pauli- Kirche. Die geschichtliche Entwicklung des Städtchens Bergedorf und seiner Kirche sind seit über 825 Jahren eng miteinander verbunden. Vermutlich hat Bergedorf schon im 9. Jh. als Hauptort des Gaues Sadelbande (südliches Lauenburg) bestanden und auch ein Gotteshaus erhalten. So werden im Jahre 1162 durch den Hamburger Erzbischof Hartwig bei der Grenzfestlegung zwischen dem Hamburger Erzbistum und dem Ratzeburger Bistum der Ort Bergerdorp und weitere Siedlungen zwischen Elbe und Bille sowie ein Priester zu Bergedorf erwähnt. In einer weiteren Urkunde von 1178 bestätigt der Ratzeburger Bischof Isfried die Grenzen des Kirchspiels Bergedorf; man spricht hier sogar schon von einem ,,alten Kirchspiel". Dazu gehörten damals auch die besiedelten Gebiete der Vierlande sowie Wentorf, Wohltorf und Teile von Billwerder. Wie das damalige Kirchengebäude genau aussah, ist nicht überliefert. Es ist nur bekannt, daß um 1120 einer der ersten Bergedorfer Priester Siegel der Urkunde von 1162 Arnold hieß und die Kirche später als St. Peter erwähnt wird. Von 1374 bis etwa l580 befand sich vor dem eigentlichen Städtchen Bergedorf, an der Schulenbrooksbeek-Furt, die sog. Heiligkreuz- kapelle für die lauenburgischen Dörfer Wentorf, Wohltorf, Börnsen und Escheburg. Sie gehörte nicht zur Bergedorfer Kirche und ist auf der Frese-Karte von 1593 schon als Ruine dargestellt (als Standort kann der Brink-Bereich abgeleitet werden). Der Neubau der Kirche 1501 1499 erlaubte der Ratzeburger Bischof den beiden Städten Hamburg und Lübeck: ,,dat se de kerke to Bergerdorpe mögen verenderen, nederbre- ken unde wo ene dat best gefallet und behaget van nye wedder upbuwen". -

Niederschrift
1 Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Escheburg am Mittwoch, dem 09.02.2011, 19.30 Uhr, in Escheburg (Gemeindezentrum, Hofweg 2) - Nr. 1/2011, wi Anwesend: Bürgermeister Gunther Schrock 1. stellv. Bürgermeister Dr. Erich Fuhrt (bis 21.45 Uhr, TOP 23) Gemeindevertreterin Gisela Bolzendahl Gemeindevertreter Uwe Bolzendahl Gemeindevertreter Rainer Bork Gemeindevertreter Martin Böttcher Gemeindevertreter Wilfried Ehlert Gemeindevertreter Hans-Martin Knies Gemeindevertreter Hans Georg Oehr Gemeindevertreter Hans Jürgen Pfeiffer, jun. Gemeindevertreter Hans-Jürgen Pfeiffer Gemeindevertreter Dr. Ulrich Riederer Gemeindevertreter Wolf-Dieter Schultz Gemeindevertreterin Ursula Ullrich Gemeindevertreterin Heike Unterberg Gemeindevertreter Franz Wohltorf Gemeindevertreterin Helga Wohltorf Es fehlt: Gemeindevertreterin Anke Tandetzki-Runge (e) Außerdem: Herr Jacob vom Amt Hohe Elbgeest, zugleich als Protokollführer Zu TOP 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit Bürgermeister Schrock eröffnet die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung um 19.30 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass a) die Mitglieder der Gemeindevertretung durch schriftliche Einladung vom 27. Jan. 2011 ordnungsgemäß eingeladen worden sind, b) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung öffentlich durch Aushang bekannt gemacht worden sind, c) die Gemeindevertretung beschlussfähig ist, da mehr als die Hälfte der gesetzlichen Anzahl der Gemeindevertreter anwesend ist. 2 Zu TOP 2. Genehmigung der Tagesordnung für den öffentlichen Teil Bürgermeister Schrock bittet darum, nach TOP 10 die Punkte x Bestätigung der Wahl des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Escheburg x Bestätigung der Wahl des stellvertretenden Wehrführers der Freiwillgen Feuerwehr Escheburg x Ernennung und Vereidigung des Wehrführers der Gemeinde Escheburg x Ernennung und Vereidigung des stellvertretenden Wehrführers der Gemeinde Escheburg mit in die Tagesordnung aufzunehmen. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte würden sich dann entsprechend verschieben. -

HVV Plan Tarifplan USAR
Richtung Neumünster Schmalensee Groß Bornhöved Tarifplan Zeichenerklärung / Key to signs Kummerfeld Fare Zone Plan 903 913 Richtung Klein- kummerfeld Trappenkamp Bezeichnung der Tarifringe Neumünster Schlamersdorf C Description of fare rings A 1 Boostedt Rickling Brokenlande 904 Nr. der Tarifzone RB 82 Warder 204 Großenaspe Wahlstedt Klein Rönnau Number of the fare zone 823 Mönkhagen 803 Wiemersdorf Eekholt Strenglin Fahrenkrug 804 Richtung Tarifzonengrenzen Bad Bramstedt Bad Segeberg 914 Neumünster/ 813 Wittenborn Weede Goldenbek Kiel Armstedt Zarpen Fare zone boundaries Bad Bramstedt Hartenholm Mözen Kurhaus Strukdorf Richtung Tarifzonengrenze und Grenze Mönkloh Lentföhrden Todesfelde 0 Altengörs RE 8 Lübeck 703 714 E 8 von Hamburg AB Dauenhof R Nützen Struvenhütten Leezen Fare zone boundary and 724 Wakendorf Hamberge 805 Groß 702 dodenhof Seth Reinfeld Hamburg AB boundary Holstentherme Grönau 614 Sülfeld Fresenburg 71 Lutzhorn Kaltenkirchen A 2 Kisdorf 704 B 614/703 Sievershütten RB R Kaltenkirchen Süd 82 915 70 Wesenberg Schnellbahnverkehr RE Grabau Kronsforde 7 Itzstedt 705 1 Bad Oldesloe E Langeln 8 R Henstedt-Ulzburg Rapid Transit (USA-Bahn) Bargfeld- RB 825 Barmstedt 604 Wakendorf II Stegen 0 Barnitz } Horst Alveslohe Ulzburg Süd Nahe 8 Sparrieshoop Barmstedt A 3 RE 8 R Brunnenstraße 605 E E Regionalverkehr Meeschensee R 8 R 3 Richtung E 6 613 Haslohfurth Wilstedt Kayhude Elmenhorst Lasbek Regional Rail RB Hemdingen Kupfermühle Itzehoe/ 61 Langenmoor Voßloch Tanneneck Quickborner Str. 815 Husum RB 504 725 71 Bokholt Friedrichsgabe -

Kreis Herzogtum Lauenburg
Kreis Herzogtum Lauenburg Informationsbroschüre Deutsches DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg Rotes Akademisches Lehrkrankenhaus UK-SH, Campus Lübeck Kreuz Fachbereiche: Leistungsangebot: • Allgemein- u.Viszeralchirurgie / • Herzkatheteruntersuchungen Gefäßchirurgie inkl. Stentversorgung • Orthopädie / Unfallchirurgie /Sportmedizin • Interdisziplinäre Intensivstation • Innere Medizin / Gastroenterologie / • Mammachirurgie im Brustzentrum Kardiologie / Nephrologie • Interdisziplinäres Tumorzentrum • Gynäkologie und Geburtshilfe • Interdisziplinäres Gefäßzentrum • Handchirurgie und Plastische Chirurgie • Interdisziplinäres Bauchzentrum • Urologie • Individuelle Endoprothetik • Radiologisches Zentrum (Hüfte, Knie, Schulter) • Ambulantes OP- und Hernienzentrum • Zentrum für Alterstraumatologie • 24-Stunden-CT • Geriatrie und ambulante Pflege DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg | Röpersberg 2 · 23909 Ratzeburg | Telefon 04541 – 884 0 www.drk-krankenhaus.de Grußwort Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste, in unregelmäßigen Abständen gibt der Kreis Herzogtum Lau- enburg eine Bürgerinformationsbroschüre heraus. Obwohl im Zeitalter des Internets viele Informationen über unseren Kreis unter www.kreis-rz.de zu finden sind, ist die gedruckte Information immer noch unverzichtbar. Die vorliegende Broschüre richtet sich ebenso an langjährige Bürgerinnen und Bürger unseres schönen Kreises wie an Gäste aus nah und fern, die das Herzogtum einfach nur kennenler- nen wollen. Sie verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über den Kreis Herzogtum Lauenburg -

Gesonderte Fachärztliche Versorgung Für Folgende Arztgruppen
List Gesondert fachärztliche Versorgung KV-Bezirk Kampen Wenningstedt-Braderup Sy lt Ellhöf t Rodenäs Av entof t Klanxbüll Süderlügum Westre Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog Neukirchen Humptrup Böxlund Bramstedtlund Uphusum Weesby Braderup Ladelund Lexgaard Glücksburg Holm Jardelund Munkbrarup Emmelsbüll-Horsbüll Bosbüll Karlum Medelby Wees Langballig Klixbüll Ringsberg Westerholz Niebüll Tinningstedt Holt Harrislee Achtrup Osterby Dollerup Maasbüll Nieby Wallsbüll Galmsbüll Flensburg Grundhof Schaf f lund Steinbergkirche Husby Hörnum Sprakebüll Tastrup Steinberg Pommerby Hürup Leck Handewitt Gelting Risum-Lindholm Mey n Kronsgaard Niesgrau Oldsum Oev enum Dunsum Midlum Nordhackstedt Hörup Stedesand Stadum Stangheck Enge-Sande Ausacker Sörup Sterup Süderende Freienwill Rabenholz Wrixum Hasselberg Borgsum Alkersum Lindewitt Oev ersee Utersum Großenwiehe Ahneby Esgrus Dagebüll Bargum Großsolt Maasholm Witsum Stoltebüll Rabel Wy k Rügge Nieblum Wanderup Langenhorn Scheggerott Lütjenholm Oersberg Goldelund Goldebek Mittelangeln Mohrkirch Norddorf Saustrup Ockholm Tarp Wagersrott Kappeln Jerrishoe Hav etof t Nebel Norderbrarup Rabenkirchen-Faulück Högel Joldelund Schnarup-Thumby Böel Bordelum Siev erstedt Dollrottf eld Grödersby Brodersby Gröde Sönnebüll Janneby Langeneß Ülsby Brebel Süderbrarup Arnis Vollstedt Löwenstedt Eggebek Kolkerheide Karby Wittdün Klappholz Struxdorf Nottf eld Bredstedt Winnemark Jörl Twedt Boren Reußenköge Breklum Langstedt Böklund Drelsdorf Loit Dörphof Haselund Stolk Steinf eld Norstedt Sollwitt Thumby Süderf ahrenstedt -

Statistikamt Nord Sachgebiet 142 Jahresrechungsstatistik 2016
Statistikamt Nord 21.07.2017 Sachgebiet 142 Jahresrechungsstatistik 2016 Verzeichnis der Gemeinde- / Berichtsstellenkennungen Gemeinden / Gemeindeverbände sortiert nach Kreisen, amtsfreien Gemeinden und Ämtern (mit Ihren amtsangehörigen Gemeinden); Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge am Ende der Liste. Suchfunktion über BEARBEITEN und SUCHEN Gemeinde- / Berichtsstellen- Name der Berichtsstelle kennung Kreisfreie Städte 0100100000 Flensburg, Stadt 0100200000 Kiel, Landeshauptstadt 0100300000 Lübeck, Hansestadt 0100400000 Neumünster, Stadt Kreis Dithmarschen 0105100100 Kreisverwaltung Dithmarschen 0105101106 Brunsbüttel, Stadt 0105104421 Heide, Stadt 0105199963 Amtsverwaltung Burg-St. Michaelisdonn 0105100363 Averlak 0105101063 Brickeln 0105101263 Buchholz 0105101663 Burg (Dithmarschen) 0105102263 Dingen 0105102463 Eddelak 0105102663 Eggstedt 0105103263 Frestedt 0105103763 Großenrade 0105105163 Hochdonn 0105106463 Kuden 0105108963 Quickborn 0105109763 Sankt Michaelisdonn 0105111063 Süderhastedt 0105199966 Amtsverwaltung Marne-Nordsee 0105102166 Diekhusen-Fahrstedt 0105103466 Friedrichskoog 0105104666 Helse 0105105766 Kaiser-Wilhelm-Koog 0105106266 Kronprinzenkoog 0105107266 Marne, Stadt 0105107366 Marnerdeich 0105107666 Neufeld 0105107766 Neufelderkoog 0105109066 Ramhusen 0105110366 Schmedeswurth 0105111866 Trennewurth 0105111966 Volsemenhusen 0105199969 Amtsverwaltung KLG Eider 0105100569 Barkenholm 0105100869 Bergewöhrden 0105101969 Dellstedt Seite 1 von 30 Statistikamt Nord 21.07.2017 Sachgebiet 142 Jahresrechungsstatistik -
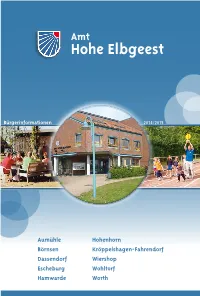
Amt Hohe Elbgeest
Amt Hohe Elbgeest Bürgerinformationen 2014 / 2015 Aumühle Hohenhorn Börnsen Kröppelshagen-Fahrendorf Dassendorf Wiershop Escheburg Wohltorf Hamwarde Worth 400.184 RZ_Image 162x240+3mmAnschn:Layout 1 26.07.2013 14:06 Uhr Seite 1 Kompetenz & Fortschritt Fürsorge & Vertrauen Jährlich schenken uns 17.000 Patienten ihr Vertrauen. In unserem modernen Krankenhaus ver- Durch die ganzheitliche Betreuung und die binden wir höchste Ansprüche an die persönliche Atmosphäre unseres Hauses medizinische Versorgung mit christlicher sorgen wir für Ihr Wohlbefinden und för- Nächstenliebe bei der Pflege und Behand- dern damit Ihre rasche Genesung. Denn: lung der uns anvertrauten Patienten. Wir möchten, dass es Ihnen gut geht! KRANKENHAUS REINBEK ST. ADOLF-STIFT Hamburger Straße 41 21465 Reinbek Telefon 040 / 72 80 - 0 E-Mail [email protected] www.krankenhaus-reinbek.de BE/SPECIAL Willkommen im Amt Hohe Elbgeest Liebe Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen im Amt Hohe Elbgeest. Mit dieser Bro- Diese Broschüre führt alphabe- schüre möchten wir Ihnen das Amt und die Gemeinden des tisch für Sie die wichtigsten Verwal- Amtes vorstellen und Sie bei der Suche nach wichtigen Ad- tungsaufgaben auf und nennt Ihnen ressen und Ansprechpartnerinnen /Ansprechpartnern in dafür die zuständigen Sachbearbeiter/innen. unserem Amtsgebiet unterstützen. Eine stets aktualisierte Auflistung finden Sie im Internet auf Die Gemeinden Aumühle, Börnsen, Dassendorf, Escheburg, der Homepage des Amtes (www.amt-hohe-elbgeest.de) Hamwarde, Hohenhorn, Kröppelshagen-Fahrendorf, Wiers- unter der Rubrik „Was erledige ich wo?“ Hier ist auch der hop, Wohltorf und Worth sowie der Forstgutsbezirk Sach - „Zuständigkeitsfinder“ des Landes Schleswig-Holstein ver- senwald werden nach den Bestimmungen der Gemeinde- öffentlicht, der Ihnen den Weg weist zu Aufgaben, die von ordnung für Schleswig-Holstein durch Bürgermeister/innen anderen Behörden in Schleswig-Holstein wahrgenommen und Gemeindevertretung ehrenamtlich geleitet. -

Kreisjugendring Ferienpass Alleine 2019.Indd
50. Aktion Ferienpass Herzogtum Lauenburg e.V. gefördert von der 2019 INHALTSVERZEICHNIS 50. Aktion Ferienpass Herzogtum Lauenburg e.V. ALLGEMEINE INFORMATIONEN SEITE 3 Ferienpass, Ermäßigungen und Gewinnspiel KREISWEITE VERANSTALTUNGEN SEITE 12 VERGÜNSTIGUNGEN SEITE 18 ANGEBOTE REGION NORD SEITE 19 Albsfelde, Bäk, Behlendorf, Berkenthin, Bliestorf, Buchholz, Düchelsdorf, Duvensee, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Göldenitz, Grinau, Groß Boden, Groß Disnack, Groß Grönau, Groß Sarau, Groß Schenkenberg, Harmsdorf, Kastorf, Kittlitz, Klempau, Klinkrade, Krummesse, Kulpin, La- benz, Mechow, Mustin, Niendorf bei Berkenthin, Pogeez, Ratzeburg, Ron- deshagen, Römnitz, Sandesneben, Schiphorst, Schönberg, Schürensöh- len, Siebenbäumen, Sierksrade, Steinhorst, Stubben, Wentorf AS, Ziethen ANGEBOTE REGION MITTE (WEST) SEITE 22 Alt-Mölln, Bälau, Basthorst, Bergrade, Borstorf, Breitenfelde, Dahmker, Fuhlenhagen, Hamfelde, Kasseburg, Koberg, Köthel, Kuddewörde, Küh- sen, Lankau, Linau, Lüchow, Möhnsen, Mühlenrade, Niendorf an der Stecknitz, Nusse, Panten, Poggensee, Ritzerau, Schretstaken, Sirksfelde, Talkau, Tramm, Walksfelde, Woltersdorf ANGEBOTE REGION MITTE (OST) SEITE 23 Brunsmark, Göttin, Grambek, Gudow, Güster, Hollenbek, Hornbek, Horst, Klein Zecher, Lehmrade, Mölln, Salem, Schmilau, Seedorf, Sterley ANGEBOTE REGION SÜD (WEST) SEITE 26 Aumühle, Börnsen, Brunstorf, Dassendorf, Elmenhorst, Escheburg, Geest- hacht, Grabau, Grove, Gülzow, Hamwarde, Havekost, Hohenhorn, Kollow, Kröppelshagen-Fahrendorf, Sahms, Schwarzenbek, Wentorf bei Hamburg, Wiershop,