St. Petri Und Pauli-Kirche Zu Bergedorf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verteilerstellen Lauenburg
Verteilerstellen Lauenburg Bäckerei Dittmer Lauenburger Landstr. 18 21039 Börnsen Amt Hohe Elbgeest Börnsener Str. 21 21039 Börnsen Budnikowsky - Filiale 191 Hermann-Wöhlke-Weg 2 21039 Börnsen Frischemarkt Börnsen Lauenburger Landstr. 32 21039 Börnsen Bäckerei Dittmer Stubbenberg 8 21039 Escheburg Gemeindeverwaltung Hofweg 6 21039 Escheburg EDEKA Am Casinopark 14 21465 Wentorf Budnikowski Echardusstieg 6 21465 Wentorf Edeka Markt Sniyders Hauptstr. 2-4 21465 Wentorf Gemeindeverwaltung Hauptstr. 16 21465 Wentorf MiniMal Rewe Hamburger Landstr. 38 21465 Wentorf Recyclinghof Wentorf Auf dem Ralande 11 21465 Wentorf Schuh-Engel Südring 38 21465 Wentorf Edeka Markt Böcker Büchener Weg 5 -7 21481 Lauenburg Rossmann Berliner Str. 16 21481 Lauenburg Famila Mecklenburger Str. 1 21481 Lauenburg Amt Lauenburg Amtsplatz 6 21481 Lauenburg Recyclinghof Lauenbu Juliusburger Landstr. 12 21481 Lauenburg Rewe Markt Reeperbahn 39 21481 Lauenburg Sven Wöhl Twiete 7 21481 Schnakenbek Gemeinde Schnakenbek Krüzener Weg 1 21481 Schnakenbek Gemeindeverwaltung Gülzow Hauptstr. 21 21483 Gülzow Nordoel Tankstelle Bundesstr. 39 21493 Elmenhorst Lehmann Finkenweg 13 21493 Elmenhorst Hrzgt.Lbg. Gemeindeverwaltung Eikhof 23 21493 Fuhlenhagen Gemeinde Grabau Grover Weg 8 21493 Grabau Recyclinghof Lanken Kesselflicker Str. 14 21493 Lanken AWSH Abfallwirtschaft Leineweberring 13 21493 Lanken Budnikowski Compestr. 1 21493 Schwarzenbek Rossmann Hans Koch Ring 6 21493 Schwarzenbek Neukauf Hans Koch Ring 6 21493 Schwarzenbek Rossmann Lauenburger Str. 10 21493 Schwarzenbek Rewe Markt Hamburger Str. 101 21493 Schwarzenbek Rathaus Ritter-Wulf-Platz 1 21493 Schwarzenbek Amt Schwarzenbek Land Gülzower Str. 1 21493 Schwarzenbek Gemeinde Talkau Friedhofstr. 1 a 21493 Talkau Famila Spandauer Str. 31 21502 Geesthacht Budnikowski Bergedorfer Str. 48 21502 Geesthacht Drogerie Wulkow Bergedorfer Str. 35 21502 Geesthacht Sky Norderstr. -

Information Contact Details Hamburg District Offices - Departments for Foreigners
Information Contact Details Hamburg District Offices - Departments for Foreigners Which Foreigners Department is responsible for me? You can easily identify the District Office in charge of your application for a residence permit (or its extension) online while using the Hamburg Administration Guide („Behördenfinder der Stadt Hamburg“). (1) Call up the Hamburg Administration Guide: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11253817/ (2) Enter your registered address (street name and house number) in Hamburg. (3) Press the red button („Weiter“). Now the Hamburg Administration Guide will show you the relevant department’s contact details and opening hours. Qualified professionals and managers, students and their families can also contact the Hamburg Welcome Center. Information Contact Details Hamburg District Offices - Departments for Foreigners District Office (= „Bezirksamt“) Hamburg-Mitte Customer Service Center (= „Kundenzentrum“) Hamburg-Mitte Department for Foreigners Affairs (= „Fachbereich Ausländerangelegenheiten“) Klosterwall 2 (Block A), 20095 Hamburg Phone: 040 / 428 54 – 1903 E-Mail: [email protected] District Office Hamburg-Mitte Customer Service Center Billstedt Department for Foreigners Affairs Öjendorfer Weg 9, 22111 Hamburg Phone: 040 / 428 54 – 7455 oder 040 / 428 54 – 7461 E-Mail: [email protected] District Office Hamburg-Mitte Hamburg Welcome Center Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg Phone: 040 / 428 54 – 5001 E-Mail: [email protected] -
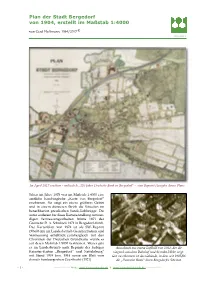
Plan Der Stadt Bergedorf Von 1904, Erstellt Im Maßstab 1:4000
Plan der Stadt Bergedorf von 1904, erstellt im Maßstab 1:4000 von Gerd Hoffmann, 1984/2017 © ALU-2017 Im April 2017 erschien - anlässlich „120 Jahre Deutsche Bank in Bergedorf“ - eine Reprint-Ausgabe dieses Plans Schon im Jahre 1875 war im Maßstab 1:4000 eine amtliche hamburgische „Karte von Bergedorf“ erschienen. Sie zeigt ein etwas größeres Gebiet und in einem dünneren Strich die Situation im benachbarten preußischen Sande-Lohbrügge. Die unter anderem für diese Kartenerstellung notwen - digen Vermessungsarbeiten führte 1871 der Geometer D. A. Schuback 1871 in Bergedorf durch. Das Kartenblatt von 1874 ist als SW-.Reprint (90x60 cm) im Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung erhältlich; zumVergleich mit den Chroniken der Deutschen Grundkarte wurde es auf deren Maßstab 1:5000 verkleinert. Weiter gibt es im Landesbetrieb auch Reprints der farbigen Ausschnitt aus einem Luftbild von 1922, der die Kataster-Karten „Bergedorf“ und Nettelnburg“ Gegend zwischen Bahnhof und Serrahn-Wehr zeigt. mit Stand 1919 bzw. 1918 sowie ein Blatt vom Gut zu erkennen ist das Gebäude, in dem seit 1905/06 damals hamburgischen Geesthacht (1921) die „Deutsche Bank“ ihren Bergedorfer Sitz hat. - 1- --------------- Hrsg.: www.bergedorfarchiv.de & www.bergedorf-chronik.de --------------- Nr. 1= Bahnhof Kampstraße (Lage an heutiger Straße: Am Bahnhof); Diese 2. Bergedorfer Bahnhofsan- lage war von 1846 - 1937 in Betrieb. 1934 wurden die Gleise auf einen Damm gelegt und 1936/37 der 3. Bahnhofsbau weiter westlich errich - tet; stand bis 2009. Blick von Holstenstraße zum Bahnhof, links das „Bahnhofshotel“, um 1910 Nr. 2 = Post-, Telegraphen-, und Fernsprechamt Kampstraße 6 (Weidenbaumsweg 6). Das Postgebäude stand von 1892 bis 1976. Der Neubau auf dieser Fläche beim Bahnhof trägt zur Erinnerung den Namen „Alte Post“ Das „Kaiserliche Postamt“, um 1910 Nr. -

Fare Zone Plan USAR
Neumünster Groß Schmalensee Kummerfeld Bornhöved Schlamersdorf A 1 Trappenkamp Tarifplan Zeichenerklärung / Key to signs Boostedt 903 Rickling 913 Fare Zone Plan Brokenlande 904 RB 82 Großenaspe Warder Bezeichnung der Tarifringe 823 Wahlstedt Klein Rönnau C Description of fare rings 803 Wiemersdorf Eekholt Strenglin Fahrenkrug 804 Mönkhagen Neumünster/ Nr. der Tarifzone Kiel/Flensburg Bad Bramstedt Wittenborn Bad Segeberg Weede Goldenbek 204 Armstedt 813 Number of the fare zone Bad Bramstedt Hartenholm Mözen Zarpen Kurhaus 914 Strukdorf Mönkloh Lentföhrden Todesfelde 0 Lübeck Tarifzonengrenzen Altengörs RE 8 703 714 E 8 Dauenhof R Fare zone boundaries Nützen Struvenhütten Leezen 805 724 RB Hamberge 702 dodenhof Wakendorf I 82 Reinfeld Groß Seth Grönau Tarifzonengrenze und Grenze Holstentherme Sülfeld (Holst) 614 Fresenburg von Hamburg AB 71 Lutzhorn Kaltenkirchen A 2 Kisdorf 704 B 614/703 Sievershütten R Kaltenkirchen Süd 915 Fare zone boundary and 70 Wesenberg RE Grabau Kronsforde 7 Itzstedt 705 Hamburg AB boundary Horst E Langeln Henstedt-Ulzburg 81 Bad Oldesloe (Holst) R Bargfeld- B 825 Barmstedt 604 Wakendorf II Stegen R Barnitz Itzehoe/ Alveslohe Ulzburg Süd Nahe 80 Westerland Sparrieshoop Barmstedt A 3 RE 8 R Schnellbahnverkehr (Sylt) Brunnenstraße 605 E E Meeschensee R 8 R 3 Rapid Transit (USA-Bahn) E 6 613 Haslohfurth Wilstedt Kayhude Elmenhorst Lasbek RB Hemdingen Kupfermühle } 61 Langenmoor Voßloch Tanneneck Quickborner Str. 815 RB 504 725 71 Bokholt Friedrichsgabe Tangstedt Berkenthin Mustin Regionalverkehr Ellerau 503 Bargteheide -

Marianne & Hans-Georg Hundt
www.dersachsenwalder.de Juli 2019 Land, Leben & Leute am Sachsenwald An alle erreichbaren Haushalte in Aumühle, Wohltorf, Dassendorf, Krabbenkamp Marianne & Hans-Georg Hundt Augenweide. Pflanzenfreunde.Insektenweide Mitteilungen, Nachrichten, Termine und Bürgermeisterbriefe + Amt Hohe Elbgeest + Gemeinde Aumühle + Gemeinde Wohltorf + Gemeinde Dassendorf + (Sport-)Vereine + Serviceclubs + + Ev.-Luth. Kirchengemeinde Aumühle + Heilig-Geist-Kirche Wohltorf + WAS IST LOS BEI UNS: INHALT IM JULI 2019 07 AMT HOHE ELBGEEST 06.07. 08.07. GEMEINDE AUMÜHLE 20 Uhr 17 Uhr 08 Bürgermeisterbrief Knut Suhk IMPROFEUER AUF FONTANES 09 WILLKOMMEN GRILLSAISON! Polizeibericht Aumühle Improvisionstheater SPUREN Lassen Sie sich von unseren EXPERTEN 10 Freiwillige Feuerwehr Aumühle Diavortrag an der FLEISCHTHEKE kompetent 16 DRK Aumühle Tonteichbad Wohltorf Theater Augustinum beraten: Wir halten eine große Auswahl 18 ZONTA Club Aumühle-Sachsenwald e.V. an Grillspezialitäten für Sie bereit. Unser FEINSCHMECKER-TIPP: Dry Aged 20 Grundschule Aumühle Unser Juli-Titel: US-Beef aus dem Reifeschrank – 22 TuS Aumühle-Wohltorf 13.07. 15.07. Seit 1983 wohnhaft in Wohltorf, war Marianne Hundt schon ein echter Fleischgenuss. 20 Uhr 19 Uhr immer interessiert an Pflanzen und Gartengestaltung. 1998 rief 30 KuBA e.V. sie in Wohltorf die "Offene Gartenpforte" ins Leben, gleichzei- Alle weiteren Köstlichkeiten rund um Ihr perfektes COUNTRY COMFORT ZYPERN tig arbeitete sie nach einer entsprechenden Ausbildung bei einer BBQ müssen Sie sich nur noch zusammenstellen. KIRCHENGEMEINDE AUMÜHLE Konzert Multivisionsvortrag Gartenarchitektin als freie Gartengestalterin. Gemeindebrief Beatrix Jenckel, Vors. KGR Am Casinopark 14 28 Jetzt im Ruhestand findet sie seit drei Jahren, auch mit der tatkräf- 21465 Wentorf 26–30 Nachrichten der ev.-luth. Kirchengemeinde/-musik Tonteichbad Wohltorf Theater Augustinum tigen Unterstützung ihres Mannes Hans-Georg, viel Freude bei der Gestaltung und Pflege eines Straßenbeetes am Eingang 040 / 720 19 98 GEMEINDE WOHLTORF von Wohltorf (Ecke Billtal/Billgrund). -

Introduction
introDUCTION During Carl Philipp Emanuel Bach’s tenure almost 40 pastors were elected and installed in their new positions in Hamburg. This large number results from two historic facts: the five Hamburg main churches—St. Petri, St. Nicolai, St. Catharinen, St. Jacobi, and St. Michaelis—employed not only a main pastor, but up to four deacons; and the Ministerium, the highest board of the Ham- burg clergy, was responsible for a large number of additional congregations in and outside the walls of the city.1 These included the churches of St. Johannis, St. Maria Magdalena, Heilig-Geist (Holy Spirit), Heilige Dreieinigkeitskirche (Holy Trinity), St. Pauli auf dem Hamburgerberge; the churches associated with St. Hiob Hospital, the Waisenhaus (orphanage), the Zuchthaus (correc- tional institute), the Pesthof, the Spinnhaus-Kirche; and, as a relic of the Han- seatic League, the guard ship on the Elbe River. Furthermore the churches in Eppendorf, Hamm und Horn, Billwerder an der Bille, Moorfleet, Allermöhe, Ochsenwerder, Moorburg, Ritzebüttel, Groden, Döse, and Altenwalde were in Hamburg territory (though up to 80 miles away from the city), whereas the churches in Bergedorf, Altengamme, Neuengamme, Kirchwerder, Curslack, and Geesthacht were overseen jointly by the Hamburg and Lübeck clergy.2 Fi- nally, some German congregations abroad recruited pastors from Hamburg, most notably London and Arkhangelsk (on the Russian coast of the White Sea).3 1. The single most important source is Janssen. See also Jensen, Bruhn, and Enßlin/Wolf 2007. 2. The following congregations were supervised by the HamburgMinisterium , although no new pastors were installed there between 1768 and 1788: Maria Magdalena (within the city walls), Eppendorf, Hamm und Horn, Bergedorf, and Neuengamme. -

USAR Network Plan
Neumünster/Kiel/Flensburg Neumünster RE7 / RE 70 / RB71 Schnellbahn-/Regionalverkehr Boostedt Großenaspe Rapid Transit/Regional Rail Dauenhof Wiemersdorf Bad Bramstedt Bad Bramstedt Kurhaus Lentföhrden Nützen Neumünster dodenhof hvv.de RB82 Holstentherme Rickling 1 Information • Fahrpläne | Timetables • Service 7 Kaltenkirchen B Wahlstedt R Horst (Holst) Kaltenkirchen Süd / Fahrenkrug RB 0 040/19 449 Lübeck 7 Alveslohe Henstedt-Ulzburg 82 E Bad Segeberg RE8 / RE 80 R / Ulzburg Süd Altengörs 7 E Reinfeld (Holst) R Langeln Meeschensee Wakendorf Lübeck Tanneneck Haslohfurth Fresenburg RE 83 Barmstedt Quickborner Straße Ellerau Bad Oldesloe Friedrichsgabe Kupfermühle RB81/ RB 82 Ratzeburg Barmstedt Moorbekhalle Ohlstedt Bargteheide Brunnenstraße Quickborn (Schulzentrum Nord) Poppenbüttel Norderstedt Mitte Hoisbüttel Gartenholz f eck Voßloch Quickborn Süd Richtweg Ahrensburg g Wellingsbüttel Buckhorn Garstedt ensbur ut Bokholt Hasloh hr iek roßhansdor Ochsenzoll A SchmalenK b G Kiwittsmoor Volksdorf Ost Sparrieshoop Hoheneichen Langenhorn Nord Bönningstedt Niendorf Nord Meiendorfer Weg amp Langenmoor Langenhorn Markt est W g Fuhlsbüttel Nord Berne 81 Schippelsweg Kornweg uchenk B B RE6 / RB61 / RB 71 Burgwedel Fuhlsbüttel (Klein Borstel) Elmshorn Oldenfelde ensbur Itzehoe/Westerland (Sylt) Klein Borstel hr Joachim-Mähl-Straße Hamburg A 80 / R Farmsen E Tornesch Schnelsen Airport Ohlsdorf Mölln (Lauenb) (Flughafen) Niendorf Markt 8 / R Rahlstedt Rübenkamp Trabrennbahn E Prisdorf Sengelmannstraße (City Nord) R Hörgensweg Hagendeel (City Nord) -

Local Action Plan of the Free and Hanseatic City of Hamburg
SUITE Local Action Plan of the Free and Hanseatic City of Hamburg Img_4326.jpg 2 LAP of the Free and Hanseatic City of Hamburg By the Johann Daniel Lawaetz Foundation on behalf of the Ministry for Social and Family Affairs, Health and Consumer Protection with the collaboration of the ULSG members › sufficient to generate an increase in the supply of Socially Compatible social housing. The market pressure on low-income Refurbishment (SCoRe) tenants (e.g. single parents and students) will therefore continue to grow, especially in the neighbourhoods which are attractive for members of Background / Problem the “creative class” (according to R. Florida´s classification). When looking at the current situation on the housing market in Hamburg, the following main problems • Energy saving reconstruction requirements for can be identified: a large percentage of rental flats • Acute lack of affordable rental housing, par- Both the Federal Government of Germany and the ticularly social housing for tenants with a low Senate of Hamburg have ambitious climate income protection targets. By 2020 the Federal Government plans to have reduced the heating needs of all The actions of the City of Hamburg to build new buildings by 20%. The housing stock in Germany is social housing are not sufficient to increase the even supposed to have a carbon-neutral energy stock. At the same time the social housing rent balance by 2050. control ends for many flats during the next two decades. Planned regulatory measures of the According to information from the Hamburg City Senate of Hamburg to keep up the rent control for Development Authority there are 875.529 dwellings the housing stock of the municipal housing company in 237.101 residential buildings, among them SAGA-GWG will stabilize the amount of social 132.779 detached houses, 26.590 semi-detached housing only at the present stage, but are not houses and 77.732 apartment buildings (data of 2008). -

Hamburg Altona
CITY OF HAMBURG ALTONA © Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht prachtvoll.de 08.10.2020 | Hamburg - City of Hamburg Altona Seite 1 DISTRICT OFFICE OF ALTONA © Mediaserver Hamburg / Timo Sommer & Lee Maas City of Hamburg Altona Seite 2 HAMBURG ALTONA Population Age structure 275.264 0-17: 18% 18-24: 6,9% Surface area Wandsbek 25-29: 6,7% Eimsbüttel Hamburg- Nord 7.790,67 ha 30-49: 30,3% Altona 50-64: 20,2% Hamburg- Population growth Mitte 65+: 17,9% 436 (natural increase) Harburg 1.434 (net migration) Bergedorf Rate of poverty 0-65: 1,3% 65+: 7,29% www.mediaserver.hamburg.de / Michael Zapf City of Hamburg Altona Seite 3 HISTORY OF ALTONA „al to nah“ (too closely) With the end of the The competition Altona is one of the most Altona is founded as a German-Danish War, between Hamburg liberal cities (freedom of village of fishermen and Altona becomes a and Altona is still religion, influx, trade). craftsmen in Holstein- Prussian provincial extensive. Pinneberg. town. 1535 1640 1664 1710 1866 1889 1914 1937 Altona became part of the Altona is the second Altona develops to an Altona turns into a Duchy of Holstein, which largest town of Denmark. independent city and the district of Hamburg. belongs to Denmark. number of inhabitants continuously grows. Source: https://www.ndr.de/geschichte/Die-Geschichte-Altonas,altona350.html (05.10.2020) www.mediaserver.hamburg.de / Maxim Schulz WORKERS` WELFARE LAND ASSOCIATION HAMBURG E.V. The AWO is engaged in developing an open, human and democratic society independent of religion, sex, colour and so on since 100 years . -

Office Market Profile
Office Market Profile Hamburg | 1st quarter 2020 Published in April 2020 Hamburg Development of Main Indicators Absence of major deals on the letting market Around 98,000 sqm of space was let or secured by owner- occupiers in the Hamburg off ice letting market in the fi rst quarter, 30% and 20% below the fi ve- and ten-year averag- es, respectively. A higher take-up result was not possible due to the absence of major contracts: the two largest contracts were each concluded for units with less than 6,000 sqm. The City Centre and Port Fringe submarkets recorded the highest take-up, accounting for over 40% of the total re- however, more subleased space is expected to come onto sult. In terms of industrial sectors, business-related service the market in the near future as a result of the current coro- providers (19,000 sqm) assumed fi rst place in the rankings navirus crisis. Coupled with a weakening in demand, this as usual, followed by three sectors (construction and real will lead to a narrowing of the gap between supply and estate, education, health and social services, and manu- demand in tenants’ favour. Just 15% of the around 190,000 facturing), all of which accounted for around 10,000 sqm of sqm of off ice space to be completed in 2020 is still available take-up. Flexible off ice space providers rented around to the market and even less space will be completed next 7,000 sqm in three locations, including IWG at Jungfern- year, but an increase in the supply pipeline is expected in stieg for the Signature brand. -

Statistisches Amt Für Hamburg Und Schleswig-Holstein Statistik Informiert
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Statistik informiert ... 10. August 2010 V/2010 Bevölkerung mit Migrationshintergrund in den Hamburger Stadtteilen Zum ersten Mal hat das Statistikamt Nord eine Sonderauswertung aus dem Melderegister zur Bevölkerung mit Migrationserfahrung oder Migrationshin- tergrund nach Stadtteilen durchgeführt. In Hamburg lebten demnach Ende 2009 insgesamt rund 487 000 Menschen mit Migrationshintergrund, das sind 28 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner. Rund 231 000 von ihnen haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, 139 000 sind einge- bürgert und 76 000 Aussiedler. Hinzu kommen 42 000 Kinder und Jugendli- che, die keine eigene Migrationserfahrung haben und die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, denen aber durch einen oder beide Elternteile ein Migrationshintergrund zugeordnet wird. Im Vergleich der Bezirke gibt es den größten Anteil von Personen mit Migra- tionshintergrund in Hamburg-Mitte – fast 43 Prozent. Im Bezirk Hamburg- Nord sind es hingegen nur gut 22 Prozent. Doch auch innerhalb der Bezirke gibt es große Unterschiede zwischen den Stadtteilen. Die Anteile an der je- weiligen Gesamtbevölkerung sind in der beigefügten Tabelle 2 dargestellt. Billstedt, Wilhelmsburg und Rahlstedt sind die Stadtteile mit den (absolut) meisten Personen mit Migrationshintergrund. Die höchsten Anteile an der Bevölkerung im Stadtteil finden sich auf der Veddel und in Billbrook mit mehr als zwei Dritteln. Vergleichsweise wenige Personen mit Migrations- hintergrund leben dagegen in den Stadtteilen der Vier- und Marschlande (mit Ausnahme von Allermöhe), in denen sie deutlich unter zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen. Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung ist in den jüngeren Altersgruppen deutlich höher als in den älteren. Nur etwa zwölf Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger über 65 Jahre haben einen Migrationshintergrund, aber fast 43 Prozent der unter 15-jährigen. -

Niederschrift
1 Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Escheburg am Mittwoch, dem 09.02.2011, 19.30 Uhr, in Escheburg (Gemeindezentrum, Hofweg 2) - Nr. 1/2011, wi Anwesend: Bürgermeister Gunther Schrock 1. stellv. Bürgermeister Dr. Erich Fuhrt (bis 21.45 Uhr, TOP 23) Gemeindevertreterin Gisela Bolzendahl Gemeindevertreter Uwe Bolzendahl Gemeindevertreter Rainer Bork Gemeindevertreter Martin Böttcher Gemeindevertreter Wilfried Ehlert Gemeindevertreter Hans-Martin Knies Gemeindevertreter Hans Georg Oehr Gemeindevertreter Hans Jürgen Pfeiffer, jun. Gemeindevertreter Hans-Jürgen Pfeiffer Gemeindevertreter Dr. Ulrich Riederer Gemeindevertreter Wolf-Dieter Schultz Gemeindevertreterin Ursula Ullrich Gemeindevertreterin Heike Unterberg Gemeindevertreter Franz Wohltorf Gemeindevertreterin Helga Wohltorf Es fehlt: Gemeindevertreterin Anke Tandetzki-Runge (e) Außerdem: Herr Jacob vom Amt Hohe Elbgeest, zugleich als Protokollführer Zu TOP 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit Bürgermeister Schrock eröffnet die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung um 19.30 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass a) die Mitglieder der Gemeindevertretung durch schriftliche Einladung vom 27. Jan. 2011 ordnungsgemäß eingeladen worden sind, b) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung öffentlich durch Aushang bekannt gemacht worden sind, c) die Gemeindevertretung beschlussfähig ist, da mehr als die Hälfte der gesetzlichen Anzahl der Gemeindevertreter anwesend ist. 2 Zu TOP 2. Genehmigung der Tagesordnung für den öffentlichen Teil Bürgermeister Schrock bittet darum, nach TOP 10 die Punkte x Bestätigung der Wahl des Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Escheburg x Bestätigung der Wahl des stellvertretenden Wehrführers der Freiwillgen Feuerwehr Escheburg x Ernennung und Vereidigung des Wehrführers der Gemeinde Escheburg x Ernennung und Vereidigung des stellvertretenden Wehrführers der Gemeinde Escheburg mit in die Tagesordnung aufzunehmen. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte würden sich dann entsprechend verschieben.