Bewirtschaftungsplan Flussgebietseinheit Donau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rund Um Den Ochsenkopf 7 Sonntagstouren Im Fichtelgebirge Rund Um Den Ochsenkopf
Rund um den Ochsenkopf 7 Sonntagstouren im Fichtelgebirge Rund um den Ochsenkopf Einleitung Vorwort S. 4 Gut zu wissen! S. 6 Fahrradmitnahme im Bus S. 7 Sieben auf einen Streich! Unsere Entdecker-Touren Übersichtskarte S. 8 1 Von Bischofsgrün bis Bad Berneck (sehr leicht) und über St. Georgen nach Bayreuth (mittelschwer) S. 10 Impressum 2 Fünf Quellen und drei Brunnen (schwer) S. 22 Idee und Ausarbeitung: VGN / S. Daßler, Gertrud Härer (Stand: 11 / 2018) 3 Seen- und Flusstour (leicht) S. 37 Bilder: Gertrud Härer, Susanne Daßler, Karin Allabauer, Karl Mistelberger 4 Von Bischofsgrün nach Pegnitz (mittelschwer) S. 41 Fehler in der Tourenbeschreibung? Korrekturen 5 Baden, Bahntrassenrollen, Besichtigen (mittelschwer) S. 57 können gerne an [email protected] geschickt werden. 6 Mit Seilbahn und Fahrrad hinauf auf den Ochsenkopf, Kartengrundlagen: Inkatlas.com, © OpenStreetMap Mitwirkende (openstreetmap.org), OpenTopoMap (CC-BY-SA) reich mäandrierend wieder hinunter (mittelschwer) S. 66 7 Historisches Weidenberg und mehr – solo oder im Gestaltung: WerbeAtelier Kolvenbach-Post Druck: Gutenberg Druck + Medien GmbH Anschluss an die Touren 2, 4 und 5 (mittelschwer) S. 72 Auflage: 7.500 Fotos Titelseite – links oben: Bad Berneck Marktplatz, Einkehren und genießen links unten: neuer Radweg zwischen Warmensteinach und Weidenberg, Einkehrmöglichkeiten S. 79 rechts: Ochsenkopfgipfel mit Wahrzeichen; © VGN/S. Daßler Fotos Rückseite – links: Felsen am Radweg, rechts: Wegeauswahl; © G. Härer 2 Tour 1 Bischofsgrün – Bad Berneck – Bad Berneck 329 369 Abzw. -
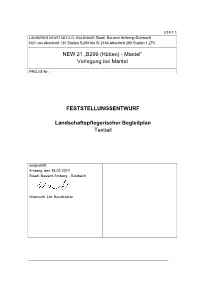
NEW21 Mantel
U19.1.1 LANDKREIS NEUSTADT A.D. WALDNAAB Staatl. Bauamt Amberg–Sulzbach N21 von Abschnitt 120 Station 5,290 bis St 2166 Abschnitt 290 Station 1,270 NEW 21 „B299 (Hütten) - Mantel“ Verlegung bei Mantel PROJIS-Nr.: FESTSTELLUNGSENTWURF Landschaftspflegerischer Begleitplan Textteil aufgestellt: Amberg, den 28.02.2017 Staatl. Bauamt Amberg - Sulzbach Wasmuth, Ltd. Baudirektor NEW21 „B299 (Hütten) – Mantel“ Verlegung bei Mantel Bau-km 0+000 bis 0+897 NEW21 Abs.120 St. 5,290 – St2166 Abs. 290 St. 1,270 Landschaftspflegerischer Begleitplan Fassung vom 24.02.2017 Auftraggeber: Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Archivstraße 1 92224 Amberg Betreuung: Dipl.-Ing. (FH) J. Baumer Auftragnehmer: Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) D. Narr Dipl.-Ing. (FH) M. Weimer Dipl.-Ing. (FH) I. Schweiss Geländearbeiten und faunistischer Fachbeitrag: Dipl.-Ing. (FH) E. Schraml Dipl.-Ing. (FH) W. Berninger NEW21 „B299 (Hütten) – Mantel“ Verlegung bei Mantel Landschaftspflegerischer Begleitplan Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ......................................................................................................... 6 1.1 Übersicht über die Inhalte des LBP ................................................................... 6 1.2 Verweis auf den allgemeinen methodischen Rahmen ...................................... 7 1.3 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets .................................................. 7 1.4 Überblick über die Schutzgebiete und Schutzobjekte im Untersuchungsgebiet ......................................................................................................................... -

Öffentliche Wasserversorgung Und Abwasserentsorgung in Bayern 2013
Statistische Berichte Kennziffer Q I 1 - 3j 2013 Öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Bayern 2013 Herausgegeben im Mai 2015 Bestellnummer Q11003 201351 Einzelpreis 13,40 € Publikationsservice Das Bayerische Landesamt für Statistik veröffentlicht jährlich über 400 Publikationen. Mit ihnen wird vor allem die informationelle Grundversorgung der Bevölkerung mit statistischen Daten gesichert. Kostenlos Newsletter Veröffentlichungen ist der Download der meisten Veröffentlichungen, z.B. Die Themenbereiche können individuell ausgewählt werden. von Statistischen Berichten (PDF- oder Excel-Format). Über Neuerscheinungen wird aktuell informiert. Kostenpflichtig Webshop sind alle Printversionen (auch von Statistischen Alle Veröffentlichungen sind im Internet Berichten), Datenträger und ausgewählte Dateien verfügbar unter (z.B. Verzeichnisse, Beiträge, Jahrbuch). www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen Impressum Statistische Berichte Vertrieb bieten in tabellarischer Form neuestes Zahlen- E-Mail [email protected] material der jeweiligen Erhebung. Dieses wird, Telefon 089 2119-3205 soweit erforderlich, methodisch erläutert und Telefax 089 2119-3457 kurz kommentiert. Auskunftsdienst Herausgeber, Druck und Vertrieb E-Mail [email protected] Bayerisches Landesamt für Statistik Telefon 089 2119-3218 St.-Martin-Str. 47 Telefax 089 2119-13580 81541 München © Bayerisches Landesamt für Statistik, München 2015 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Zeichenerklärung Auf- und Abrundungen -

Trends and Extreme Values of River Discharge Time Series
TRENDS AND EXTREME VALUES OF RIVER DISCHARGE TIME SERIES Dipl.-Syst. Wiss. Malaak Kallache Potsdam, April 2007 Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) Eingereicht im Fachbereich Geowissenschaften der Fakultat¨ II – Biologie, Chemie und Geowissenschaften der Universitat¨ Bayreuth, Deutschland Dissertation submitted for obtaining the degree of Doctor rerum naturalium in the department of Geosciences at the faculty of Biology, Chemistry and Geosciences of the University of Bayreuth, Germany Vollstandiger¨ Abdruck der von der Fakultat¨ Biologie, Chemie und Geowissenschaften der Universitat¨ Bayreuth genehmigten Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.). Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit vom November 2002 bis November 2007 am Lehrstuhl fur¨ Okologische¨ Modellbildung der Universitat¨ Bayreuth angefertigt. Die Arbeit wurde eingereicht am 16. April 2007 Das Rigorosum fand statt am 02. November 2007 Der Prufungsausschuss¨ bestand aus: Prof. Dr. C. Beierkuhnlein (Vorsitzender) Prof. Dr. H. Lange (Erstgutachter) Prof. Dr. H.J. Schellnhuber (Zweitgutachter) Prof. Dr. M. Hauhs PD Dr. G. Lischeid .....you cannot step twice into the same river Heraclitus CONTENTS Abstract xi Zusammenfassung xiii 1 Motivation 1 1.1 Climatechange .................................. 1 1.2 Influence of climate change on the hydrological cycle . ....... 2 1.3 Approachestoassesstrends . 3 1.4 Aimsandoutlineofthethesis . 5 2 Basic Methods and Data 9 2.1 Stochasticprocesses.............................. 9 2.1.1 Basicdefinitions ............................. 9 2.1.2 Autoregressivemovingaverageprocesses . 10 2.1.3 FractionalARIMAprocesses . 11 2.2 Waveletanalysis.................................. 13 2.2.1 Discretewavelettransform . 13 2.2.2 Daubechiesleastasymmetricwaveletfilters . 17 2.2.3 Waveletvariance ............................. 19 2.3 Extremevaluestatistics. 20 2.3.1 Modelsforblockmaxima . 20 2.3.2 Thresholdexcessmodels . -

Referenzen Gewässerbiologie (PDF)
Referenzliste Gewässerökologie, ÖKON GmbH, Kallmünz, April 2019 Gewässerökologie ÖKON bearbeitet seit über 25 Jahren Projekte zur Biologischen Gewässergütebestimmung. Seit in Kraft treten der EG-WRRL werden dazu die neuesten Verfahren zur Erfassung der Biokomponenten angewandt (ASTERICS, PERLODES, ECOPROF, PHYLIB u.s.w.). Auch die Ermittlung chemisch-physikalischer Parameter und die Kartierung der Gewässerstruktur (GSK) gehören zum Leistungsspektrum. Neben der Grundlagenerhebung werden Konzepte zur Entwicklung von Gewässer (GEK) und zur Beurteilung von Maßnahmen und Eingriffen an Gewässern erstellt. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt in der Erstellung von Konzepten zur Sanierung nährstoffbelasteter Seen (Seentherapie, Seenrestaurierung). Referenzen (Beispiele) ÖKON (2019ff, 2017): Gewässerökologisches Monitoring im Rahmen der Errichtung und Inbetriebnahme einer Wasserkraftanlage an der Vorsperre des Eixendorfer Stausees - Auftraggeber: Bayerische Landeskraftwerke GmbH, Nürnberg ÖKON (2018ff): Ökologische Beobachtung der Rinsen in Sarching - Auftraggeber: Gemeinde Barbing ÖKON (2018ff): Erstellung eines gewässerökologischen Gutachtens und einer Umweltver- träglichkeitsstudie im Vorfeld der wasserrechtlichen Neugenehmigung der Kläranlage Hof - Auftraggeber: Abwasserverband Saale, Hof ÖKON (2018ff): Elektrobefischung im Zuge einer Naturschutzfachlichen Prüfung zur Erweite- rung der Schifffahrt auf dem Inn bei Passau - Auftraggeber: PAN Planungsbüro im Auf- trag der Donauschifffahrt Wurm & Noé GmbH & Co. KG, Passau ÖKON (2018ff): Bewertung -

Umsetzungskonzept
Umsetzungskonzept Flusswasserkörper 1_F265 „Haidenaab von Einmündung Flernitzbach bis Mündung in die Naab“ für das Wasserwirtschaftsamt Weiden Steinhofgasse 11 92224 Amberg Umsetzungskonzept Haidenaab Moos Impressum Auftragnehmer Trepesch Landschaftsarchitektur Steinhofgasse 11 92224 Amberg Tel. 09621.973963 | Fax 09621.91677-00 [email protected] | www.trepesch.info Bearbeitung: Christopher Trepesch, Dipl.-Ing. (Univ.) Landschaftsarchitekt Julia Luber, B. Eng. Landschaftsarchitektur Inhaber: Dipl.-Geogr. Ingo Nienhaus Im Alten Breidt 1, 53797 Lohmar Tel.: 02246 – 925 60 79 – FAX: 02246 – 925 44 07 www.gewaesser-experten.de, [email protected] Mitwirkende an der Projektarbeit Ingo Nienhaus Dipl.-Geograph Andrea Mees Dipl.-Geograph Constanze Mächling M.Sc. Naturschutz und Landschaftsplanung Bernhard Moos Diplom-Biologe Max-Wiesent-Straße 6 91275 Auerbach/Opf. Tel.: 09643 -20 58 803 Fax.: 09643 - 20 58 804 e-mail: [email protected] Auftraggeber Wasserwirtschaftsamt Weiden Am Langen Steg 5 92637 Weiden i. d. OPf. Amberg, 10.11.2020 - 2 - Umsetzungskonzept Haidenaab Moos Inhalt 1 EINLEITUNG .............................................................................................................4 1.1 Hintergrund des Projektes 4 1.2 Kurzbeschreibung des Planungsraums 4 1.3 Defizite nach WRRL im zugeordneten Wasserkörper 5 2 GEBIETSÜBERSICHT ...............................................................................................5 2.1 Naturräumliche Gegebenheiten und Fließgewässertypen 5 2.2 Schutzgebiete (Natura -

FFH-VP OU Mantel
U19.2.1 LANDKREIS NEUSTADT A.D. WALDNAAB Staatl. Bauamt Amberg–Sulzbach N21 von Abschnitt 120 Station 5,290 bis St 2166 Abschnitt 290 Station 1,270 NEW 21 „B299 (Hütten) - Mantel“ Verlegung bei Mantel PROJIS-Nr.: FESTSTELLUNGSENTWURF Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Ausnahmeprüfung für das FFH-Gebiet DE 6237-371 "Haidenaab, Creussenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbach“ - Textteil - aufgestellt: Amberg, den 28.02.2017 Staatl. Bauamt Amberg - Sulzbach Wasmuth, Ltd. Baudirektor NEW21 „B299 (Hütten) – Mantel“ Verlegung bei Mantel Bau-km 0+000 bis 0+897 NEW21 Ab.120 St. 5,290 – St2166 Ab. 290 St. 1,270 Schutz des Europäischen Netzes „Natura 2000“ Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Ausnahmeprüfung für das FFH-Gebiet DE 6237-371 "Haidenaab, Creusenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbach“ Fassung vom 24.02.2017 Auftraggeber: Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Archivstraße 1 92224 Amberg Betreuung: Dipl.-Ing. (FH) J. Baumer Auftragnehmer: Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) D. Narr Dipl.-Ing. (FH) M. Weimer Dipl.-Ing. (FH) I. Schweiss Dipl.-Ing. (FH) E. Schraml Geländearbeiten und faunistischer Fachbeitrag: Dipl.-Ing. (FH) E. Schraml Dipl.-Ing. (FH) W. Berninger NEW 21 „B299 (Hütten) – Mantel“ Verlegung bei Mantel Unterlage zur FFH-VP für das FFH-Gebiet DE 6237-371 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung ....................................................................................................... 1 1.1 Anlass und Aufgabenstellung ............................................................................ 1 1.2 -

Wildenau Markt Luhe
"< "< "< 08800 09000 09200 09400 09600 09800 10000 10200 10400 10600 45 45 45 45 45 45 4 45 45 45 45 8 I I I 9 8 3 I I 8 1020 II 0 0 I I 1 891 0 382,52 9 915 0 I 0 1036 0 0 4 4 1 7 1 1 7 1 901 9 0 1041 9 3 876 4 4 2428 4 1038 1 5 0 5 1019 890 1008 1037 6 1 2 1 1 1 9 2,0 1009 1006 0 0 1038/1 / 902 "< 382,54 1 1 889 1 1037/2 0 1042 0 5 2 100 5 5086 09 911 / 1043/1 1093 5 1 1037/1 1 877 916 III 888 903 1001 1044 1059 1000 1096 1 9 I I 382,42 0 9 5 904 9 382,48 6 1004 382,68 1043 878 887 1044/1 58 10 910 905 1003 382,54 1 0 I 4 5 I I 4 9 886 / 6 0 1057 1 879 S 998 1044/2 905/2 1002 1 0 917 100,0 I I 5 880 "< 5 880/1 a 950/4 949 1044/3 Markt 1050 885 906 948/1TS 905/1 881 5 950/3 4 r 9 0 s 1 948/2 918 9 8 2 H 1044/4 4 a 2 7 s 1054 Haselhöhe e I l 907 h ö 0 382,39 882 0 e h 0 0 e 2 951 2 I s 951/1 I 24 I 30 I 8 7 7 ( 948 S 9 9 I 9 8 t Luhe - 4 4 3 1049 2 6 I 5 K 1044/5 5 382,39 5 883 4 7 909 / k 1 5 ) 0 5 I I r 382,42 952 1 e 5 9 952/1 e 908 b 985 0 919 1 s 997 I b I 94477 c 955/2 I I 6 2 B 1 1 a 953 I n c 996 9 7 2 Wildenau h 9 e 954 ä 955/3 920 946 Gew I Waldnaab 8 382,48 946 4 1 921 9 974 t i 9 984 9 955/1 7 / Vorläufige Sicherung Hochwassergefah9r41enfläche b 3 7 b 1 d 216 955 94455 / 7 r a 9 7 a 1053 I im Bereich Markt Luhe-Wildenau, Gemeinde Pirk 8 n e a I d 992 9 l a 5 I a 3 r H und Gemeinde Schirmitz vom 04.08.2015 6 I 922 215 2 a 382,55 W 986 a H i d 944444 t 1046 2634 981 e n 94433 N 382,48 a a 210 982 h a 214 9 i 1 939 9 b 382,39 924 991 7 1385/1 3 d 9 6 3 6 2 2637 0 0 0 e 0 0 0 7 923 7 9 382,39 940 9 4 4 382,39 5 5 n a 382,38 938 -

2 Radeln Im Oberpfälzer Wald Radeln Im Oberpfälzer Wald 3
RADMAGAZIN www.oberpfaelzerwald.de 2 Radeln im Oberpfälzer Wald Radeln im Oberpfälzer Wald 3 Morgenstimmung am Bayerisch-Böhmischen Freundschaftsweg Inhalt Übersicht Tourenvorschläge Radwege im Oberpfälzer Wald Steinwald-Stiftland-Tour 11 Vizinalbahn-Radweg 23 Naabtal-Radweg 34 Tirschenreuth Zoiglbier & Bocklweg 12 Waldnaabtal-Radweg 24 Schwarzachtal-Radweg 35 Kultige Biertour 13 Fichtelnaab-Radweg 25 Regen-Schwarzach-Radweg 35 Neustadt a.d. WN Oberpfälzer Seenland-Radweg 14 Höhen-Radweg 25 Aschatal-Radweg 36 OBERPFÄLZER Weiden i.d.OPf. Egergraben-Radweg 15 Sagenhafte Steinroute 26 Naab-Regen-Radweg 36 WALD Schwandorf Karpfen-Radweg Kemnather Land 15 Sibyllen-Radweg 26 Regental-Radweg 37 Steinwald-Radweg 16 Wallenstein-Radweg/Südroute 27 Weiher-Radweg 37 BAYERN Stiftländer Karpfen-Radweg 16 Wondreb-Radweg 27 Vulkantour 17 Bockl-Radweg 28 Naturparkland-Runde 17 Haidenaab-Radweg 29 Nützliche Hinweise und Tipps München Waldnaabtal-Tour 18 Creußen-Radweg 30 Naturpark-Entdecker-Runde 18 Pfreimdtal-Radweg 30 E-Bike-Region Oberpfälzer Wald 38 Oberpfälzer Hügelland-Runde 19 Luhe-Lerau-Radweg 31 Wissenswertes 39 Durch die Talauen von Haidenaab und Creußen 19 Paneuropa-Radweg 31 Radfreundliche Gastgeber 40 Vier-Seen-Weg 20 Zottbachtal-Radweg 32 Rad & Bus 41 Moosrunde 20 GEO-Radweg „Weg des Lebens“ 32 Übersichtskarte Oberpfälzer Wald 42/43 Brückenland-Runde 21 Bayerisch-Böhmischer Freundschaftsweg 33 4 Radeln im Oberpfälzer Wald Radeln im Oberpfälzer Wald 5 Bild links: Waldnaabtal-Radweg bei Neustadt a.d. Waldnaab · Bild rechts oben: Radlerpause am Regen bei Stefling · Bilder rechts unten, von links nach rechts: Weitblicke am Hochfels bei Stadlern · Unterwegs auf dem Bockl-Radweg · Radler an der Himmelsleiter Radeln auf ehemaligen Bahntrassen, steigungsarmen Flussradwegen oder durch anspruchsvolle Mittelgebirgslandschaften – wohl kaum eine andere Region bietet so viel Abwechslung für einen gelungenen Radurlaub wie der Oberpfälzer Wald. -

Die Landschaft Und Ihre Naturgegebenheiten
IMSPIEŒL DER ZEITEN ____________ DER LANDKREIS AMBERG-SULZBACH DER GROSSLANDKREIS AUFTRAG UND BEWÄLTIGUNG Geleitwort Landrat Dr. Hans Wagner, Arnberg 3 Der Landkreis Amberg-Sulzbach und sein Wappen Dr. Heribert Sturm, Arnberg 4 Die Landschaft und ihre Naturgegebenheiten Dr. Dietrich-Jürgen Manske, Regensburg 9 DAS GEBIET IM WANDEL DER JAHRHUNDERTE Die frühmittelalterlichen Anfänge nach den archäologischen Quellen Dr. Klaus Schwarz, München 47 Die territoriale Entwicklung Dr. Heribert Sturm, Arnberg 77 Die kirchliche Entwicklung Dr. Heribert Sturm, Arnberg 119 Die wirtschaftliche Entwicklung Dr. Heribert Sturm, Arnberg 139 Eisenerzbergbau und Eisenhütten seit 1800 Dr. Volker Nichelmann, Arnberg 159 Der Landkreis heute Rudolf Schörner, Arnberg 165 Grafik und Layout: Rudolf Schörner, Arnberg Fotos: Ursula Pfistermeister, Fürnried Druck: Amberger Zeitung 8000/2/78 Die Landschaft und ihre Naturgegebenheiten Die naturgeographischen Nach H. Strunz (1953) wurde der Raum unter den Meeresspiegel, wobei Tone, Grundlagen des zwischen Böhmen und dem Oberrhein Sande und Kalkschlamm in wechseln gebiet im Erdaltertum (Paläozoikum) der Folge und Mächtigkeit abgelagert Kreises Amberg-Sulzbach von einem kristallinen Grundgebirge worden sind. Am Ende der Jura-Zeit mit nahezu alpinen Ausmaßen einge bedeckte so ein mächtiges Paket aus Wenn bei der Vorstellung des 1974 nommen. Ende des Erdaltertums Rotliegendem, Zechstein (beide Perm), geschaffenen Großlandkreises Am (Jungkarbon bis Perm) war es durch Buntsandstein, Muschelkalk und Keu berg-Sulzbach mit -
Verzeichnis Der Wasserkörper in Bayern Anlage Zur Bekanntmachung Vom 23
Verzeichnis der Wasserkörper in Bayern Anlage zur Bekanntmachung vom 23. Januar 2012 1. Oberflächenwasserkörper Az.: 52b-U4537.2-2011/1-7 Flussgebiet Planungseinheit Wasserkörper Name Code Bezeichnung Code Bezeichnung Donau AP_PE01 Altmühl AP146 Altmühl bis Einmündung Hungerbach Altmühl von Einmündung Hungerbach bis zum Zusammenfluss mit Donau AP_PE01 Altmühl AP148 Main-Donau-Kanal alle Nebengewässer der Altmühl bis Einmündung Dornhauser Donau AP_PE01 Altmühl AP150 Mühlbach Donau AP_PE01 Altmühl AP166 Wieseth mit allen Nebengewässern Möhrenbach, Schambach, Rohrach (zur Altmühl), Brüllgraben, Donau AP_PE01 Altmühl AP187 Westenbrunnenbach, Hungerbach (zur Altmühl), Meinheimer Mühlbach, Störzelbach Donau AP_PE01 Altmühl AP188 Gailach Donau AP_PE01 Altmühl AP199 Schambach (Arnsberger Schambach) Südliche Schwarzach mit Nebengewässern vom Dennenloher Weiher Donau AP_PE01 Altmühl AP200 bis Einmündung Agbach Anlauter, Erlenbach (Markt Nennslingen), Morsbach, Donau AP_PE01 Altmühl AP201 Hafenbrunnenbach, Heimbach, Agbach Siegenbach (Lkr. Neumarkt i.d.OPf.), Schwarzach (zur Altmühl) bis Donau AP_PE01 Altmühl AP203 Dennenloher Weiher, Hengerbach bis Seligenporten Donau AP_PE01 Altmühl AP204 Schwarzach von Einmündung Agbach bis Mündung Donau AP_PE01 Altmühl AP218 Weiße Laber von Einmündung Rödlbrunnbach bis Unterbürg Sulz bis Einleitung in den Main-Donau-Kanal, Wiefelsbach, Roßbach Donau AP_PE01 Altmühl AP219 (zum Main-Donau-Kanal) Donau AP_PE01 Altmühl AP223 Weiße Laber von Unterbürg bis Mündung in den Main-Donau-Kanal Weiße Laber bis Einmündung -

Goldene Straße E.V., Haydnstraße 4, 92665 Altenstadt A.D
www.goldene-strasse.de der Waldnaab schenkte er 1354 den noch heute Als Sohn von Kaiser Johann von Luxemburg und seiner böhmischen Gemahlin in alter Form bewirtschafteten Corporationswald, Elisabeth, einer Tochter von König Wenzel II., wurde Karl am Pfingstsonntag, Die Goldene Straße 1358 gründete er eine Vorstadt, die sogenannte Die „Verbotene Straße“ Kaiser Karl IV. dem 14. Mai 1316 - also vor 700 Jahren - in Prag geboren. Sieben Jahre „Freyung“. Luhe verlieh er 1359 alle Rechte und Kaiser Karl IV. entstammte väterlicherseits dem Hause Die Bedeutung dieser wesentlich älteren südlichen verbrachte das Königskind aus Prag am französischen Hof. Diese Umgebung Freiheiten, die die Stadt Weiden hatte. Weiden Luxemburg und war ein Herrscher mit scharfem Verstand. Historisches Alternativroute der Goldenen Straße soll nicht Einst und heute prägte seine Denkweise in jeglicher Hinsicht. Hier bekam er die politischen selbst erhielt umfangreiches Geleitrecht und eine Er beherrschte fünf Sprachen – und hatte einen ausge- vergessen werden. Grundlagen für sein späteres Regententum vermittelt. prägten politischen Instinkt. Er verfügte über eine größere Hausmacht als Zollstation, beides für die Stadt eine Quelle be- Am 2. September 1347 wurde Karl mit seiner Gemahlin unter großen Feier- ständiger Einkünfte. Die Goldene Straße war aber all seine Vorgänger auf dem römisch-deutschen Kaiserthron. Durch Heirat, Die Namensgebung „Verbotene Straße“ erfolgte durch den Oberpfälzer lichkeiten in Prag empfangen und gekrönt. Es war der Beginn einer machtvol- nicht nur von großer politischer, sondern auch von Kauf, Tausch, Verpfändung und Erbschaft erwarb er von den Wittelsbachern Altstraßenforscher Anton Dollacker im 19. Jahrhundert und lässt sich wie len und klugen Regierungszeit. Das Rittertum verfiel in seiner Regierungszeit.