Umsetzungskonzept
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Guide to Bryologically Interesting Regions in Germany
A GUIDE TO BRYOLOGICALLY INTERESTING REGIONS IN GERMANY with contributions by K. von der Dunk, R. Lotto, R. Lübenau and G. Philippi edited and translated by Jan-Peter Frahm prepared for a bryological fieldtrip during the XIV Botanical Congress, Berlin 1987 THE FICHTEL MOUNTAINS by Klaus von der Dunk 1. General Information 1.1 Location The Fichtelgebirge is situated in the northeastern part of Bavaria and is enclosed to the north and East by the borders of the German Democratic Republic and the CSSR. The name "Fichtel"gebirge probably does not link with the spruce trees (Fichte = Picea abies), which is much abandoned today, but there is a word conjunction with some kind of sprites, called "Wichtel" in German, who are supposed to live in dark woods. The Fichtelgebirge has the shape of a horseshoe open to the east The interior part with the city of Wunsiedel is in about 600 m altitude. The surrounding mountains raise up to 1000m (Schnee-berg, Ochsenkopf). The Fichtelgebirge is part of the main water draining line: three rivers flow to the North Sea (Saale, Eger, Main), while the fourths (Naab) flows (via Danube) to the Black Sea. 1.2. Geology The Fichtelgebirge lies beyond a famous fault, the so-called Fränkische Linie (Fig.1). This fault divides the mesozoic layers of sedimentary rocks in the Southwest from the granitic igneous rocks in the Northeast. The mountain area itself consists of granite, now and then intruded by magma, especially in the southern part. In several places one can see large basalte quarries. The higher elevations of the granitic massif are often eroded to solitary rocks called "Blockmeere". -

Rund Um Den Ochsenkopf 7 Sonntagstouren Im Fichtelgebirge Rund Um Den Ochsenkopf
Rund um den Ochsenkopf 7 Sonntagstouren im Fichtelgebirge Rund um den Ochsenkopf Einleitung Vorwort S. 4 Gut zu wissen! S. 6 Fahrradmitnahme im Bus S. 7 Sieben auf einen Streich! Unsere Entdecker-Touren Übersichtskarte S. 8 1 Von Bischofsgrün bis Bad Berneck (sehr leicht) und über St. Georgen nach Bayreuth (mittelschwer) S. 10 Impressum 2 Fünf Quellen und drei Brunnen (schwer) S. 22 Idee und Ausarbeitung: VGN / S. Daßler, Gertrud Härer (Stand: 11 / 2018) 3 Seen- und Flusstour (leicht) S. 37 Bilder: Gertrud Härer, Susanne Daßler, Karin Allabauer, Karl Mistelberger 4 Von Bischofsgrün nach Pegnitz (mittelschwer) S. 41 Fehler in der Tourenbeschreibung? Korrekturen 5 Baden, Bahntrassenrollen, Besichtigen (mittelschwer) S. 57 können gerne an [email protected] geschickt werden. 6 Mit Seilbahn und Fahrrad hinauf auf den Ochsenkopf, Kartengrundlagen: Inkatlas.com, © OpenStreetMap Mitwirkende (openstreetmap.org), OpenTopoMap (CC-BY-SA) reich mäandrierend wieder hinunter (mittelschwer) S. 66 7 Historisches Weidenberg und mehr – solo oder im Gestaltung: WerbeAtelier Kolvenbach-Post Druck: Gutenberg Druck + Medien GmbH Anschluss an die Touren 2, 4 und 5 (mittelschwer) S. 72 Auflage: 7.500 Fotos Titelseite – links oben: Bad Berneck Marktplatz, Einkehren und genießen links unten: neuer Radweg zwischen Warmensteinach und Weidenberg, Einkehrmöglichkeiten S. 79 rechts: Ochsenkopfgipfel mit Wahrzeichen; © VGN/S. Daßler Fotos Rückseite – links: Felsen am Radweg, rechts: Wegeauswahl; © G. Härer 2 Tour 1 Bischofsgrün – Bad Berneck – Bad Berneck 329 369 Abzw. -

Gewässerabschnitte Mit Potenziell Signifikantem Hochwasserrisiko in Bayern Gemäß § 73 WHG I.V.M
4501000 4511000 4521000 4531000 4541000 98000 98000 54 54 Wasser Gewässerabschnitte mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko in Bayern gemäß § 73 WHG i.V.m. Art. 5 Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) Landkreis: Schwandorf Risikogewässer der HWRM-RL Gewässer Fließgewässer nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 88000 88000 54 54 Staatsgrenze Landesgrenze Landkreisgrenze bzw. Grenze kreisfreie Stadt Gemeindegrenze 78000 78000 54 54 Thüringen Risikogewässer Sachsen He ssen NES HO Landkreis KC KG CO KU HO Landkreisausschnitt LIF HAS WUN MSP AB SW BA TIR MIL WÜ BT TSCHECHISCHE KT NEW FO REPUBLIK ERH WEN NEA ER AS LAU FÜ N AM SAD SC AN CHA NM RH REG WUG R SR Ba den- EI Württemberg KEH DON FRG IN DEG ND LA DGF PAF DLG FS 68000 68000 AIC PAN PA 54 54 GZ DAH NU A ED MÜ AÖ FFB MN EBE STA MM LL M TS ÖSTERREICH RO OALKF WM KE GAP TÖ MB LI BGL OA SCHWEIZ 58000 58000 54 54 0 5 km Maßstab 1 : 70.000 48000 48000 Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) 54 54 Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, E-Mail: [email protected], Internet: www.lfu.bayern.de Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung - Tatsächliche Nutzung (ALKIS, Gewässer) 1 : 1 000 (2018) - Digitale Topographische Karte (DTK100) 1 : 100 000 (2018) - Amtliches Topographisches Kartographisches Informationssystem (ATKIS25) 1 : 25 000 (2018) Fachdaten: Fachinformationssystem Wasserwirtschaft Berichtstand: 22.12.2018 4501000 4511000 4521000 4531000 4541000 Bayerisches Landesamt für Umwelt Gewässerabschnitte mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko gemäß § 73 WHG i.V.m. Art. 5 der Richtlinie 2007/60/EG, Risikokulisse 2018 SAD im Landkreis Schwandorf Die Kilometerangaben basieren nicht auf der Flusskilometrierung, sondern wurden anhand digitaler Daten mit einem Gewässernetz im Maßstab 1:25.000 erstellt. -

Amtsblatt Für Den Landkreis Schwandorf
Amtsblatt für den Landkreis Schwandorf Nr. 14 vom 11. September 2007 Inhaltsverzeichnis Seite Ausbruch der Geflügelpest in den Gebieten der Gemeinden Bruck i. d. Opf. und Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf Allgemeinverfügung vom 11.09.2007 mit Anlagen 104 Herausgeber, Druck und Redaktion: Landratsamt Schwandorf, Wackersdorfer Str. 80, 92421 Schwandorf Telefon: 09431/471-354, Telefax 09431/471-110 Email: [email protected] www.landkreis-schwandorf.de Amtsblatt vom 103 11.09.2007 Vollzug des Tierseuchengesetzes (TierSG) und der Nutzgeflügel- Geflügelpestschutzverordnung; Ausbruch der Geflügelpest in den Gebieten der Gemeinden Bruck i. d. OPf. und Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf Das Landratsamt Schwandorf erlässt folgende A l l g e m e i n v e r f ü g u n g : Aufgrund des am 10.09.2007 in der Marktgemeinde Bruck, Landkreis Schwandorf amtlich festgestellten Ausbruches der Geflügelpest wird um die befallenen Seuchenbestände ein Sperrbezirk, ein Beobachtungsgebiet und eine Kontrollzone festgelegt. I. Festgelegte Bereiche 1. Der Sperrbezirk umfasst die in der Anlage 1 aufgeführten Gemeinden, Ortschaften und Ortsteile: 2. Das Beobachtungsgebiet umfasst die in der Anlage 2 aufgeführten Gemeinden, Ortschaften und Ortsteile: 3. Die Kontrollzone umfasst die in der Anlage 3 aufgeführten Gemeinden, Ortschaften und Ortsteile: II. Verbote und Beschränkungen im Sperrbezirk 1. Die im Sperrbezirk gehaltenen Vögel sind in geschlossenen Ställen oder unter einer überstehenden, dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung aufzustallen. 2. Im Sperrbezirk dürfen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Federwild und von Federwild stammende Erzeugnisse, Eier, tierische Nebenprodukte von Geflügel sowie Futtermittel weder in eine noch aus einer Vogelhaltung verbracht werden. 3. -
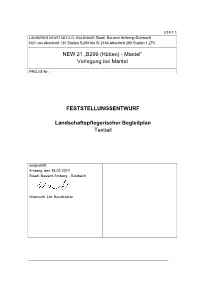
NEW21 Mantel
U19.1.1 LANDKREIS NEUSTADT A.D. WALDNAAB Staatl. Bauamt Amberg–Sulzbach N21 von Abschnitt 120 Station 5,290 bis St 2166 Abschnitt 290 Station 1,270 NEW 21 „B299 (Hütten) - Mantel“ Verlegung bei Mantel PROJIS-Nr.: FESTSTELLUNGSENTWURF Landschaftspflegerischer Begleitplan Textteil aufgestellt: Amberg, den 28.02.2017 Staatl. Bauamt Amberg - Sulzbach Wasmuth, Ltd. Baudirektor NEW21 „B299 (Hütten) – Mantel“ Verlegung bei Mantel Bau-km 0+000 bis 0+897 NEW21 Abs.120 St. 5,290 – St2166 Abs. 290 St. 1,270 Landschaftspflegerischer Begleitplan Fassung vom 24.02.2017 Auftraggeber: Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Archivstraße 1 92224 Amberg Betreuung: Dipl.-Ing. (FH) J. Baumer Auftragnehmer: Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) D. Narr Dipl.-Ing. (FH) M. Weimer Dipl.-Ing. (FH) I. Schweiss Geländearbeiten und faunistischer Fachbeitrag: Dipl.-Ing. (FH) E. Schraml Dipl.-Ing. (FH) W. Berninger NEW21 „B299 (Hütten) – Mantel“ Verlegung bei Mantel Landschaftspflegerischer Begleitplan Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ......................................................................................................... 6 1.1 Übersicht über die Inhalte des LBP ................................................................... 6 1.2 Verweis auf den allgemeinen methodischen Rahmen ...................................... 7 1.3 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets .................................................. 7 1.4 Überblick über die Schutzgebiete und Schutzobjekte im Untersuchungsgebiet ......................................................................................................................... -

Bewirtschaftungsplan Flussgebietseinheit Donau
I N I S M T S E N R E I B U E M L B A E Y . D E R N Bewirtschaftungsplan für den bayerischen Anteil der Flussgebietseinheit Donau Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie und ihre Umsetzung in Bayern Impressum Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit Rosenkavalierplatz 2, 81925 München Internet: www.stmug.bayern.de E-Mail: [email protected] Redaktion: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayerisches Landesamt für Umwelt Gestaltung: Bayerisches Landesamt für Umwelt Bildnachweis: A. Conrad, M. Heim, B. Horst, Landesamt für Umwelt, B. Lenhart, B. Peters, Regierung von Unterfranken, S. Trautwein © Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, München, Dezember 2009 . Inhaltsverzeichnis Seite EINFÜHRUNG 1 1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES BAYERISCHEN DONAUGEBIETS 7 1.1 Das bayerische Donaugebiet im Überblick 7 1.2 Oberflächengewässer 9 1.2.1 Oberflächenwasserkörper 9 1.2.2 Ökoregionen und Gewässertypen 10 1.3 Grundwasser 12 1.3.1 Grundwasserleiter 12 1.3.2 Grundwasserkörper 12 2 SIGNIFIKANTE BELASTUNGEN UND ANTHROPOGENE EINWIRKUNGEN AUF DEN 15 ZUSTAND VON OBERFLÄCHENGEWÄSSERN UND GRUNDWASSER 2.1 Oberflächengewässer 16 2.1.1 Stoffliche Belastungen 16 2.1.1.1 Nährstoffe 19 2.1.1.2 Schadstoffe 22 2.1.1.3 Bodeneinträge durch Erosion 23 2.1.2 Hydromorphologische Veränderungen, Wasserentnahmen und Abflussregulierungen 23 2.1.3 Einschätzung sonstiger anthropogener Belastungen 24 2.1.4 Zusammenfassung 25 2.2 Grundwasser 26 2.2.1 Stoffeinträge 26 2.2.2 Grundwasserentnahmen 28 3 ERMITTLUNG UND KARTIERUNG DER SCHUTZGEBIETE 31 3.1 Gebiete zur Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Gewässer für die 31 Entnahme von Trinkwasser gemäß Art. -

Öffentliche Wasserversorgung Und Abwasserentsorgung in Bayern 2013
Statistische Berichte Kennziffer Q I 1 - 3j 2013 Öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Bayern 2013 Herausgegeben im Mai 2015 Bestellnummer Q11003 201351 Einzelpreis 13,40 € Publikationsservice Das Bayerische Landesamt für Statistik veröffentlicht jährlich über 400 Publikationen. Mit ihnen wird vor allem die informationelle Grundversorgung der Bevölkerung mit statistischen Daten gesichert. Kostenlos Newsletter Veröffentlichungen ist der Download der meisten Veröffentlichungen, z.B. Die Themenbereiche können individuell ausgewählt werden. von Statistischen Berichten (PDF- oder Excel-Format). Über Neuerscheinungen wird aktuell informiert. Kostenpflichtig Webshop sind alle Printversionen (auch von Statistischen Alle Veröffentlichungen sind im Internet Berichten), Datenträger und ausgewählte Dateien verfügbar unter (z.B. Verzeichnisse, Beiträge, Jahrbuch). www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen Impressum Statistische Berichte Vertrieb bieten in tabellarischer Form neuestes Zahlen- E-Mail [email protected] material der jeweiligen Erhebung. Dieses wird, Telefon 089 2119-3205 soweit erforderlich, methodisch erläutert und Telefax 089 2119-3457 kurz kommentiert. Auskunftsdienst Herausgeber, Druck und Vertrieb E-Mail [email protected] Bayerisches Landesamt für Statistik Telefon 089 2119-3218 St.-Martin-Str. 47 Telefax 089 2119-13580 81541 München © Bayerisches Landesamt für Statistik, München 2015 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Zeichenerklärung Auf- und Abrundungen -

Trends and Extreme Values of River Discharge Time Series
TRENDS AND EXTREME VALUES OF RIVER DISCHARGE TIME SERIES Dipl.-Syst. Wiss. Malaak Kallache Potsdam, April 2007 Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) Eingereicht im Fachbereich Geowissenschaften der Fakultat¨ II – Biologie, Chemie und Geowissenschaften der Universitat¨ Bayreuth, Deutschland Dissertation submitted for obtaining the degree of Doctor rerum naturalium in the department of Geosciences at the faculty of Biology, Chemistry and Geosciences of the University of Bayreuth, Germany Vollstandiger¨ Abdruck der von der Fakultat¨ Biologie, Chemie und Geowissenschaften der Universitat¨ Bayreuth genehmigten Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.). Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit vom November 2002 bis November 2007 am Lehrstuhl fur¨ Okologische¨ Modellbildung der Universitat¨ Bayreuth angefertigt. Die Arbeit wurde eingereicht am 16. April 2007 Das Rigorosum fand statt am 02. November 2007 Der Prufungsausschuss¨ bestand aus: Prof. Dr. C. Beierkuhnlein (Vorsitzender) Prof. Dr. H. Lange (Erstgutachter) Prof. Dr. H.J. Schellnhuber (Zweitgutachter) Prof. Dr. M. Hauhs PD Dr. G. Lischeid .....you cannot step twice into the same river Heraclitus CONTENTS Abstract xi Zusammenfassung xiii 1 Motivation 1 1.1 Climatechange .................................. 1 1.2 Influence of climate change on the hydrological cycle . ....... 2 1.3 Approachestoassesstrends . 3 1.4 Aimsandoutlineofthethesis . 5 2 Basic Methods and Data 9 2.1 Stochasticprocesses.............................. 9 2.1.1 Basicdefinitions ............................. 9 2.1.2 Autoregressivemovingaverageprocesses . 10 2.1.3 FractionalARIMAprocesses . 11 2.2 Waveletanalysis.................................. 13 2.2.1 Discretewavelettransform . 13 2.2.2 Daubechiesleastasymmetricwaveletfilters . 17 2.2.3 Waveletvariance ............................. 19 2.3 Extremevaluestatistics. 20 2.3.1 Modelsforblockmaxima . 20 2.3.2 Thresholdexcessmodels . -

Referenzen Gewässerbiologie (PDF)
Referenzliste Gewässerökologie, ÖKON GmbH, Kallmünz, April 2019 Gewässerökologie ÖKON bearbeitet seit über 25 Jahren Projekte zur Biologischen Gewässergütebestimmung. Seit in Kraft treten der EG-WRRL werden dazu die neuesten Verfahren zur Erfassung der Biokomponenten angewandt (ASTERICS, PERLODES, ECOPROF, PHYLIB u.s.w.). Auch die Ermittlung chemisch-physikalischer Parameter und die Kartierung der Gewässerstruktur (GSK) gehören zum Leistungsspektrum. Neben der Grundlagenerhebung werden Konzepte zur Entwicklung von Gewässer (GEK) und zur Beurteilung von Maßnahmen und Eingriffen an Gewässern erstellt. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt in der Erstellung von Konzepten zur Sanierung nährstoffbelasteter Seen (Seentherapie, Seenrestaurierung). Referenzen (Beispiele) ÖKON (2019ff, 2017): Gewässerökologisches Monitoring im Rahmen der Errichtung und Inbetriebnahme einer Wasserkraftanlage an der Vorsperre des Eixendorfer Stausees - Auftraggeber: Bayerische Landeskraftwerke GmbH, Nürnberg ÖKON (2018ff): Ökologische Beobachtung der Rinsen in Sarching - Auftraggeber: Gemeinde Barbing ÖKON (2018ff): Erstellung eines gewässerökologischen Gutachtens und einer Umweltver- träglichkeitsstudie im Vorfeld der wasserrechtlichen Neugenehmigung der Kläranlage Hof - Auftraggeber: Abwasserverband Saale, Hof ÖKON (2018ff): Elektrobefischung im Zuge einer Naturschutzfachlichen Prüfung zur Erweite- rung der Schifffahrt auf dem Inn bei Passau - Auftraggeber: PAN Planungsbüro im Auf- trag der Donauschifffahrt Wurm & Noé GmbH & Co. KG, Passau ÖKON (2018ff): Bewertung -

FFH-VP OU Mantel
U19.2.1 LANDKREIS NEUSTADT A.D. WALDNAAB Staatl. Bauamt Amberg–Sulzbach N21 von Abschnitt 120 Station 5,290 bis St 2166 Abschnitt 290 Station 1,270 NEW 21 „B299 (Hütten) - Mantel“ Verlegung bei Mantel PROJIS-Nr.: FESTSTELLUNGSENTWURF Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Ausnahmeprüfung für das FFH-Gebiet DE 6237-371 "Haidenaab, Creussenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbach“ - Textteil - aufgestellt: Amberg, den 28.02.2017 Staatl. Bauamt Amberg - Sulzbach Wasmuth, Ltd. Baudirektor NEW21 „B299 (Hütten) – Mantel“ Verlegung bei Mantel Bau-km 0+000 bis 0+897 NEW21 Ab.120 St. 5,290 – St2166 Ab. 290 St. 1,270 Schutz des Europäischen Netzes „Natura 2000“ Unterlage zur FFH-Verträglichkeitsprüfung mit Ausnahmeprüfung für das FFH-Gebiet DE 6237-371 "Haidenaab, Creusenaue und Weihergebiet nordwestlich Eschenbach“ Fassung vom 24.02.2017 Auftraggeber: Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach Archivstraße 1 92224 Amberg Betreuung: Dipl.-Ing. (FH) J. Baumer Auftragnehmer: Bearbeitung: Dipl.-Ing. (FH) D. Narr Dipl.-Ing. (FH) M. Weimer Dipl.-Ing. (FH) I. Schweiss Dipl.-Ing. (FH) E. Schraml Geländearbeiten und faunistischer Fachbeitrag: Dipl.-Ing. (FH) E. Schraml Dipl.-Ing. (FH) W. Berninger NEW 21 „B299 (Hütten) – Mantel“ Verlegung bei Mantel Unterlage zur FFH-VP für das FFH-Gebiet DE 6237-371 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung ....................................................................................................... 1 1.1 Anlass und Aufgabenstellung ............................................................................ 1 1.2 -

Amtsblatt Für Den Landkreis Schwandorf
AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS SCHWANDORF Nr. 9 vom 08.04.2016 Inhaltsverzeichnis Seite Stellenausschreibung Landkreis Schwandorf: Bautechniker/in 2 Bekanntmachung zur Verlängerung der vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Weiden ermittelten Überschwemmungsgebiets an der Naab 2 Bekanntmachung zur vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt Weiden ermittelten Überschwemmungsgebiets der Schwarzach 3 Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); Betreiber: Bioenergie Altendorf GmbH & Co. KG, Altendorf 8 Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); Betreiber: Ruhland GmbH & Co. KG, Neukirchen-Balbini 8 Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung der Kreistagsmitglieder, bestellten Stellvertreter des Landrates und sonstiger ehrenamtlich tätiger Kreisbürger 9 1 Amtsblatt Nr. 9 / 2016 Stellenausschreibung Landkreis Schwandorf: Bautechniker/in Der Landkreis Schwandorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Bautechniker/in Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle (39 Wochenstunden). Den gesamten Text dieser Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter www.Landkreis-Schwandorf.de/Stellenausschreibungen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis spätestens 25. April 2016 an das Landratsamt Schwandorf, Personalverwaltung, Postfach 15 49, 92406 Schwandorf. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Ruf-Nr. 09431/471-494 (Frau Simon). -

Wildenau Markt Luhe
"< "< "< 08800 09000 09200 09400 09600 09800 10000 10200 10400 10600 45 45 45 45 45 45 4 45 45 45 45 8 I I I 9 8 3 I I 8 1020 II 0 0 I I 1 891 0 382,52 9 915 0 I 0 1036 0 0 4 4 1 7 1 1 7 1 901 9 0 1041 9 3 876 4 4 2428 4 1038 1 5 0 5 1019 890 1008 1037 6 1 2 1 1 1 9 2,0 1009 1006 0 0 1038/1 / 902 "< 382,54 1 1 889 1 1037/2 0 1042 0 5 2 100 5 5086 09 911 / 1043/1 1093 5 1 1037/1 1 877 916 III 888 903 1001 1044 1059 1000 1096 1 9 I I 382,42 0 9 5 904 9 382,48 6 1004 382,68 1043 878 887 1044/1 58 10 910 905 1003 382,54 1 0 I 4 5 I I 4 9 886 / 6 0 1057 1 879 S 998 1044/2 905/2 1002 1 0 917 100,0 I I 5 880 "< 5 880/1 a 950/4 949 1044/3 Markt 1050 885 906 948/1TS 905/1 881 5 950/3 4 r 9 0 s 1 948/2 918 9 8 2 H 1044/4 4 a 2 7 s 1054 Haselhöhe e I l 907 h ö 0 382,39 882 0 e h 0 0 e 2 951 2 I s 951/1 I 24 I 30 I 8 7 7 ( 948 S 9 9 I 9 8 t Luhe - 4 4 3 1049 2 6 I 5 K 1044/5 5 382,39 5 883 4 7 909 / k 1 5 ) 0 5 I I r 382,42 952 1 e 5 9 952/1 e 908 b 985 0 919 1 s 997 I b I 94477 c 955/2 I I 6 2 B 1 1 a 953 I n c 996 9 7 2 Wildenau h 9 e 954 ä 955/3 920 946 Gew I Waldnaab 8 382,48 946 4 1 921 9 974 t i 9 984 9 955/1 7 / Vorläufige Sicherung Hochwassergefah9r41enfläche b 3 7 b 1 d 216 955 94455 / 7 r a 9 7 a 1053 I im Bereich Markt Luhe-Wildenau, Gemeinde Pirk 8 n e a I d 992 9 l a 5 I a 3 r H und Gemeinde Schirmitz vom 04.08.2015 6 I 922 215 2 a 382,55 W 986 a H i d 944444 t 1046 2634 981 e n 94433 N 382,48 a a 210 982 h a 214 9 i 1 939 9 b 382,39 924 991 7 1385/1 3 d 9 6 3 6 2 2637 0 0 0 e 0 0 0 7 923 7 9 382,39 940 9 4 4 382,39 5 5 n a 382,38 938