Rochus Lussi Multiple Ichs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Raiders of the Lost Ark
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 12 2020 Full Issue Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation (2020) "Full Issue," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 12. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/12 This Full Issue is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. et al.: Full Issue Swiss A1nerican Historical Society REVIEW Volu1ne 56, No. 1 February 2020 Published by BYU ScholarsArchive, 2020 1 Swiss American Historical Society Review, Vol. 56 [2020], No. 1, Art. 12 SAHS REVIEW Volume 56, Number 1 February 2020 C O N T E N T S I. Articles Ernest Brog: Bringing Swiss Cheese to Star Valley, Wyoming . 1 Alexandra Carlile, Adam Callister, and Quinn Galbraith The History of a Cemetery: An Italian Swiss Cultural Essay . 13 Plinio Martini and translated by Richard Hacken Raiders of the Lost Ark . 21 Dwight Page Militant Switzerland vs. Switzerland, Island of Peace . 41 Alex Winiger Niklaus Leuenberger: Predating Gandhi in 1653? Concerning the Vindication of the Insurgents in the Swiss Peasant War . 64 Hans Leuenberger Canton Ticino and the Italian Swiss Immigration to California . 94 Tony Quinn A History of the Swiss in California . 115 Richard Hacken II. Reports Fifty-Sixth SAHS Annual Meeting Reports . -

1 Rechenschaftsbericht 2002
$ KANTON LANDAMMANN NIDWALDEN UND REGIERUNGSRAT Rechenschaftsbericht 2002 Sehr geehrter Herr Landratspräsident Sehr geehrte Damen und Herren Landräte Unter Hinweis auf Art. 61 Ziff. 12 der Kantonsverfassung beantragen wir Ihnen, den Rechenschaftsbe- richt 2002 des Regierungsrates zu genehmigen und die parlamentarischen Vorstösse gemäss den An- trägen in Ziff. 1.4.2 des Berichtes abzuschreiben. Freundliche Grüsse Stans, 20. Mai 2003 Rechenschaftsbericht 2002 1 INHALT 1 ALLGEMEINE REGIERUNGSTÄTIGKEIT 9 1.1 Vorbemerkungen 9 1.2 Regierungsprogramm 9 1.2.1 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Wirtschaft 9 1.2.2 Unterstützung professioneller Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich 10 1.2.3 Erhaltung des Bildungs- und Kulturangebots 10 1.2.4 Unterstützung eines zweckmässigen Verkehrs- und Kommunikationsangebotes 11 1.2.5 Nachhaltige Entwicklung der Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft 11 1.3 Parlamentarische Initiativen, Motionen und Postulate 12 1.4 Berichte über Aufträge aus Beschlüssen des Landrates zu parlamentarischen Vorstössen (Initiativen, Motionen und Postulate) 12 1.4.1 Berichterstattung 12 1.4.2 Anträge auf Abschreibung 14 1.5 Beziehungen zum Bund 15 1.5.1 Vernehmlassungen 15 1.5.2 Beziehungen zu den beiden eidgenössischen Parlamentariern 15 1.6 Interkantonale Zusammenarbeit 15 1.6.1 Zusammenarbeit mit Obwalden 15 1.6.2 Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK) 16 1.6.3 Fachdirektorenkonferenzen 17 2 STAATSKANZLEI 18 2.1 Eidgenössische Abstimmungen 18 2.2 Kantonale Abstimmungen 18 2.3 Wahlen 18 2.3.1 Landrat 18 2.3.2 -

Perspective, 2 | 2006 Art Nouveau Et Symbolisme En Suisse : État De La Recherche Sur La Peinture, 1
Perspective Actualité en histoire de l’art 2 | 2006 La Suisse/Période moderne Art nouveau et Symbolisme en Suisse : état de la recherche sur la peinture, 1890-1914 Laurent Langer, Art Nouveau and Symbolism in Swiss painting : an overview of current research Laurent Langer, Jugendstil und Symbolismus in der Schweizer Malerei. Der aktuelle Forschungsstand. Laurent Langer, La pittura « Art nouveau » e simbolista in Svizzera : stato della ricerca Laurent Langer, La pintura « Arte nuevo » y la pintura simbolista en Suiza. Estado de la investigación Laurent Langer Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/perspective/363 DOI : 10.4000/perspective.363 ISSN : 2269-7721 Éditeur Institut national d'histoire de l'art Édition imprimée Date de publication : 30 juillet 2006 Pagination : 227-246 ISSN : 1777-7852 Référence électronique Laurent Langer, « Art nouveau et Symbolisme en Suisse : état de la recherche sur la peinture, 1890-1914 », Perspective [En ligne], 2 | 2006, mis en ligne le 31 mars 2018, consulté le 01 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/perspective/363 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ perspective.363 Ce document a été généré automatiquement le 1 octobre 2020. Art nouveau et Symbolisme en Suisse : état de la recherche sur la peinture, 1... 1 Art nouveau et Symbolisme en Suisse : état de la recherche sur la peinture, 1890-1914 Laurent Langer, Art Nouveau and Symbolism in Swiss painting : an overview of current research Laurent Langer, Jugendstil und Symbolismus in der Schweizer Malerei. Der aktuelle Forschungsstand. Laurent Langer, La pittura « Art nouveau » e simbolista in Svizzera : stato della ricerca Laurent Langer, La pintura « Arte nuevo » y la pintura simbolista en Suiza. -

JAHRESBERICHT 2019 KUNSTGESELLSCHAFT LUZERN KUNSTMUSEUM LUZERN Kunstgesellschaft Luzern / Kunstmuseum Luzern Jahresbericht 2019
JAHRESBERICHT 2019 KUNSTGESELLSCHAFT LUZERN KUNSTMUSEUM LUZERN Kunstgesellschaft Luzern / Kunstmuseum Luzern Jahresbericht 2019 Aufbau der Ausstellung Turner. Das Meer und die Alpen, 2019, Foto: Marc Latzel Bericht des Präsidenten 4 Bericht der Direktorin 6 Ausstellungen 8 Medienresonanz 28 Publikationen 29 Besucherstatistik 32 Kunstvermittlung 35 Sammlung 37 Vorstand, Revisoren, Team 44 Mitglieder 46 Artclub Luzern 49 Stifung BEST Art Collection Luzern 50 Stiftung für das Kunstmuseum 52 Jahresrechnung 53 Bericht des Quästors 56 Revisionsbericht 57 Geldgeberinnen und Partner 58 3 Taryn Simon, Picture Collection. Folder: Costume – Veil, 2012, Archiv-Inkjet-Print und Letraset auf Wand, 120 × 158 cm, Edition 2 / 5, Kunstmuseum Luzern, BERICHT DES PRÄSIDENTEN Depositum der BEST Art Collection Luzern, M 2019.002q Es freut mich ausserordentlich, in meinem mittlerwei- das Erdgeschoss räumlich über den hohen Luftraum le schon sechsten Jahresbericht auf das vergangene mit unserem Foyer im 4. Obergeschoss zu verbin - Jahr zurückzublicken, da es für die Kunstgesellschaft den und im Eingangsbereich gleichsam einen Auftakt Luzern und das Kunstmuseum Luzern ein äusserst zum Museumsbesuch zu formulieren, präzis und erfolgreiches war. in seiner gewohnt spielerischen Art umgesetzt. Trotz grosser Bemühungen ist es uns nicht gelungen, die Das Hauptereignis war natürlich die anlässlich des sicherheitstechnischen Bedenken des KKL bezüglich 200-jährigen Jubiläums der Kunstgesellschaft Luzern des Standorts dieser Installation auszuräumen, so verwirklichte Ausstellung -
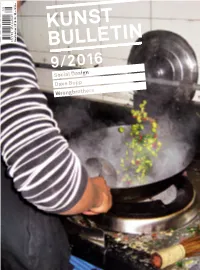
Sep Tember 2016 F R
September 2016 Fr. 10.– / € 8.– 9/2016 *Aargauer Kunsthaus Karl Ballmer 28. 8 – 13. 11. 2016 Kopf und Herz Aargauerplatz CH–5001 Aarau Di – So 10 – 17 Uhr Do 10 – 20 Uhr www.aargauerkunsthaus.ch Max von Moos Der Zeichner Ding Ding Objektkunst aus der Sammlung CARAVAN 3 / 2016: Samuli Blatter Karl Ballmer, Gliederfigur, um 1953 / 1957 Aargauer Kunsthaus, Aarau Ausstellungsreihe für junge Kunst 160725_KUNSTBULLETIN_155x210_SEPT_LAY.indd 1 25/07/16 15:51 FOKUS 28 Social Design — Interventionen in einer Welt voller Missstände. Patricia Grzonka 34 Dave Bopp — Psychotrope Malerei. Ralf Christofori 42 Wrongbrothers — Eine Raumstation namens Hoffnung. Daniel Morgenthaler 48 Performance im Blickfeld — Agatha Valkyrie Ice: Permapermadeath. Dorothea Rust 50 Ansichten — Das Meer wiegt mein Herz. Johanna Encrantz 52 Anti Musée — Onze motifs de fermeture d’expositions. Sylvain Menétrey 56 Focus Berlino — Estetica postdigitale e interdisciplinarità. Boris Magrini HINWEISE 58 Curator’s Choice — Digitale Kunst — Projekt des Monats / Kari Altmann, ‹Soft Mobility› 59 Users’ Choice — Digitale Kunst — Projekt des Monats / rhizome, The Download 59 Arles — Il y a de l’autre 60 Baden — Leonardo Finotti / Berlin — The Present in Drag 61 Böheimkirchen/Wien — Georgia Creimer und Thomas Reinhold 62 Chiasso — Simonetta Ferrante / Genf — Passionnément céramique 64 Genf — Récit d’un temps court / Karlsruhe — Digitale Wasserspiele 65 Lausanne — Piero Manzoni 66 Luzern — Andy Guhl / Mailand — Theaster Gates / München — Sylvie Fleury 68 Paris — Joana Hadjithomas, Khalil -

Militant Switzerland Vs. Switzerland, Island of Peace
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 5 2020 Militant Switzerland vs. Switzerland, Island Of Peace Alex Winiger Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation Winiger, Alex (2020) "Militant Switzerland vs. Switzerland, Island Of Peace," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 5. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/5 This Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Winiger: Militant Switzerland vs. Switzerland, Island Of Peace Militant Switzerland vs. Switzerland, Island of Peace Two Monuments, Two Conceptions by Alex Winiger Two monumental murals depict Switzerland during the First World War: the votive painting in the Lower Ranft Chapel in Flüeli-Ranft by Robert Durrer (1867-1934), Albert Hinter (1876- 1957) and Hans von Matt (1899-1985) from 1920-21, and the cycle of Charles L’Eplattenier (1874-1946) in the Knights’ Hall of the Co- lombier Castle from 1915-19, depicting the mobilization of Swiss soldiers in 1914.1 They report in rich details how differently artists in that country saw the war of 1914-18. Both were put into architectural monuments built around 1500.2 However, they differ greatly in their 1 For L’Eplattenier’s works at Colombier Castle, see Sylvie Pipoz-Perroset, Les décorations murales de Charles L’Eplattenier au château de Colombier (1916-1949): pour une approche de la peinture en milieu militaire, mémoire de licence (chez l’auteur 2002); id., Les décorations de Charles L’Eplattenier Colombier Castle, in: Kunst und Architektur in der Schweiz 2004.1, “Patriotische Wandmalerei im 20. -

Hans Von Matt, Verzeichnis Dokumentebene: D 1, D 2, Fotos Werk Und Private Fotos, Aus Holzkiste Und Glasplatten Kantonsbibliothek Nidwalden
KANTON BILDUNGSDIREKTION KANTONSBIBLIOTHEK Engelbergstrasse 34, Postfach 1243, 6371 Stans NIDWALDEN 041 618 73 00, www.nw.ch Hans von Matt, Verzeichnis Dokumentebene: D 1, D 2, Fotos Werk und private Fotos, aus Holzkiste und Glasplatten Kantonsbibliothek Nidwalden Bild Objektname Metadaten HvM Motiv, Beschreibung, Schlag- Besitzer worte (von KB vergeben) Signatur Vorlage Jahr Müller-Mettler, vergrösserte Im Garten eines Landhauses in gute, Risch mono T7 Risch, Martha Müller-Mettler KBNW_013_D1_00 1 Negativ 1937 Flums, gute, Grab Schmohn Grabmal Maria Schmon-Neyer, Flums KBNW_013_D1_00 2_01 Negativ 1940 Seite 1 von 231 KANTON NIDWALDEN, Bildungsdirektion, Kantonsbibliothek Stans, 10. Januar 2018 Flums, gute, Grab Schmohn Grabmal Maria Schmon-Neyer, Flums KBNW_013_D1_00 2_02 Negativ 1940 Kopp Beromünster Grabmal Major Michael Kopp- Herzog, Beromünster, evt. 1940 KBNW_013_D1_00 3_01 Negativ 1943 Kopp Beromünster Grabmal Major Michael Kopp- Herzog, Beromünster, evt. 1940 KBNW_013_D1_00 3_02 Negativ 1943 Seite 2 von 231 KANTON NIDWALDEN, Bildungsdirektion, Kantonsbibliothek Stans, 10. Januar 2018 Donatorentafel, Luzern Museum Luzern KBNW_013_D1_00 6_01 Negativ 1944 Donatorentafel, Luzern Museum Luzern KBNW_013_D1_00 6_02 Negativ 1944 Donatorentafel, Luzern Museum Luzern KBNW_013_D1_00 6_03 Negativ 1944 Seite 3 von 231 KANTON NIDWALDEN, Bildungsdirektion, Kantonsbibliothek Stans, 10. Januar 2018 Donatorentafel, Luzern Museum Luzern KBNW_013_D1_00 6_04 Negativ 1944 Halter-Ming, ganzes Grab Grabmal Wilhelm Halter-Ming, Baumeister, Friedhof Sihlfeld, -

ANNEMARIE VON MATT Widerstehlich Nidwaldner Museum
ANNEMARIE VON MATT Werkliste widerstehlich mit Beiträgen von Mathis Altmann, Sophie Jung, Judith Keller, Simone Lappert, Quinn Latimer, Céline Manz, Sam Porritt, Manon Wertenbroek 7. März —– 27. September 2020 Nidwaldner Museum Winkelriedhaus Vorwort Annemarie von Matt ist Meisterin in der Selbstins- zenierung und gilt mit ihrem prozesshaften, konzeptuellen Schaffen als Vorreiterin für Strömungen in der Kunst, die erst später, in den 1960er Jahren, als solche wahrgenommen und bezeichnet werden. Dass Annemarie von Matt ein derart eigenständiges Werk als Künstlerin, Frau und Künst- Text Patrizia Keller Patrizia Text «Ein neues Wort: WIDERSTEHLICH contra Unwidersteh- lerehefrau zu jener Zeit – vor, während und nach dem lich. Ich wäre WIDDERSTEHLICH […]» schrieb Annemarie Zweiten Weltkrieg – und in der vergleichsweise traditionel- von Matt in eines ihrer Notizbücher von 1949/1950. Widder, len Innerschweiz entwickelte, ist umso bemerkenswerter. widerborstig, gegen den Strom, unwiderstehlich, auferste- Ihre prägnanten literarischen und bildnerischen Aussagen hen, wieder… – Solche und ähnliche Assoziationen werden zu den festen, konservativen Rollenverteilungen und ihre bei mir geweckt, wenn ich das Wort «widerstehlich» lese. stete Suche, sich davon zu befreien, zeichnen ihr Werk aus. Und bei Ihnen? Wie hochaktuell Annemarie von Matts Schaffen ist, Zu ihren Lebzeiten sprengte Annemarie von Matt mit wie ihre Fragestellungen und Arbeitsweisen bis heute nicht ihrem künstlerisch-literarischen Werk die Grenzen der an Gültigkeit verloren haben, soll die Ausstellung wider- Konvention. 1905 in Root, Luzern, geboren, war die Auto- stehlich zeigen. Mit Mathis Altmann (*1987), Sophie Jung didaktin während der 20er Jahre Teil des Luzerner Künst- (*1982), Judith Keller (*1985), Simone Lappert (*1985), lerkreises und wurde zu einer über die regionalen Grenzen Quinn Latimer (*1978), Céline Manz (*1981), Sam Porritt hinaus bekannten Künstlerin. -

Chramuri Alois Arnold · 6462 Seedorf · 079 668 24 92 Inhalt
Chramuri Alois Arnold · 6462 Seedorf · 079 668 24 92 Inhalt h Zentralschweiz allg. Seite 2 bis 5 h Schwyz Seite 6 bis 10 h Obwalden Seite 11 bis 13 h Nidwalden Seite 14 bis 18 h Luzern Seite 19 bis 25 h Zug Seite 26 bis 27 h Glarus Seite 28 bis 29 Februar 2018 · 02_2_1 - Zentralschweiz Chramuri Nach Inhalt suchen mit STRG+F (PC) oder z+F (Mac) h Zum Inhaltsverzeichnis Chramuri Alois Arnold · 6462 Seedorf · 079 668 24 92 2 Zentralschweiz allg. CH 934 CH 194 Eine kulinarische Entdeckungsreise Die Innerschweiz in Vergangenheit und durch die Zentralschweiz Gegenwart Hg. Max Mittler Martin Sigrist, Beatrice Lang, Caroline. B. Stüssi Illustrationen u. Texte aus drei Jahrhunderten, Neuer Umschau Buchverlag Neustadt 2005 Fotos u.a. Iten Karl, ExLibris 1969 144 Seiten, 23.5 x 30.5 cm, Pb 157 Seiten, 17.5 x 24.5 cm, geb. Ln, SU Guter Zustand Zustand gut Fr. 20.- CH 1025 Freunde aus der Urschweiz. UR 102 Weggefährten und ihre Welt Nous. Die Urschweiz heute Jakob Wyrsch, SW-Portraits Die Urschweiz am Comptoir Suisse in Lausanne Josef von Matt Verlag Stans 1971 13.-28. Sept 1975. Konzept: Iten Karl 252 Seiten, 13 x 21 cm, geb. Ln, SU Text und Redaktion: Gerhard Oswald Guter Zustand, SU leicht gebräunt Fr. 27.- o. P., 12 x 18 cm, Taschenbuch Zustand: Leim löst sich Fr. 20.- CH 538 Wie sie heimgingen CH 419 Josef Zielmann Die Urschweiz und ihre Wappen Comenius-Verlag Hitzkirch Luzern 1982, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden 127 Seiten, 15 x 22 cm, Pb, Sign. -

KULTURCLUB.CH Das Monatlich Erscheinende Magazin Des SRF Kulturclubs › › August 2020
KULTURCLUB_CH_August_2020.qxp_KULTURCLUB_CH_August_2020 31.07.20 10:37 Seite 1 KULTURCLUB.CH Das monatlich erscheinende Magazin des SRF Kulturclubs › www.kulturclub.ch › August 2020 «Weltklasse» 2020 bei Radio SRF 2 Kultur › Kontext: Vom Publikum gewünscht › Streifzug nach Stans › Hörspiel/Soap: «Roll over Beethoven» › Hörspiele im August › Museumstipp › Filmtipp › Musik für einen Gast: Vera Kaa – Auf vielen Wegen immer zu sich selbst «Weltklasse» 2020 bei Radio SRF 2 Kultur Jeden Abend Konzertgenuss, vom 3. bis 23. August, ab 20 Uhr Martha Adriano Heitmann Foto: Argerich. KULTURCLUB_CH_August_2020.qxp_KULTURCLUB_CH_August_2020 31.07.20 10:37 Seite 2 Der Dirigent Herbert Blomstedt, *11. Juli 1927, lebt in Luzern und ist Mitglied der Königlich-Schwedischen Musikakademie. Foto: Martin Lengemann schierend der eine, während der andere die Schwerelosigkeit und die Tiefgründigkeit der italienischen Seele erkundet. Hautnah aus dem Archiv «Weltklasse» 2020 bei Radio SRF 2 Kultur Da nicht abzusehen war, ob überhaupt und allenfalls wie viele Konzerte diesen Hautnah mit den Ohren Sommer live stattfinden werden, haben wir vorsorglich (das war Plan C) das Radio-Kon- Jeden Abend Konzertgenuss, vom 3. bis 23. August, ab 20 Uhr zertarchiv nach entsprechenden Perlen abge- sucht. erien im Sommer 2020? Die finden statt, Und so können wir auch diesen Sommer So finden Sie in diesem Sommerpro- Fwenn auch für die meisten vermutlich et- eine Liveübertragung anbieten, die sogar nah gramm auch eine Wiederbegegnung mit dem was anders als ursprünglich gedacht. Und der an das Ursprüngliche heranreicht: Martha inzwischen verstorbenen Nikolaus Harnon- Festivalsommer 2020? Auch der findet statt, Argerich als Solistin in Beethovens erstem court (ganz unkompliziert haben die damals ebenfalls etwas anders als geplant. -

Annemarie Von Matt, Verzeichnis Dokumentebene: C 1, Fotos Zum Werk Kantonsbibliothek Nidwalden
KANTON BILDUNGSDIREKTION KANTONSBIBLIOTHEK Engelbergstrasse 34, Postfach 1243, 6371 Stans NIDWALDEN 041 618 73 00, www.nw.ch Annemarie von Matt, Verzeichnis Dokumentebene: C 1, Fotos zum Werk Kantonsbibliothek Nidwalden Bild Objektname Metadaten AvM Motiv, Beschreibung, Schlagworte (von KB vergeben) Signatur Jahr Maria mit Kind: Zeichnung, Blei- Alte Signatur: AvM2_001. stift auf Papier. Glasnegativ Stickereientwurf. Die "erste Marien- zeichnung 1926" Siehe Benteli S. 55 KBNW_012_C1_01_00 1 1926 Braut mit Tulpe: Entwurf für Dieses heisst Braut Tulpe Alte Signatur: AvM2_002. Stickerei- Stickerei. Zeichnung, Bleistift entwurf auf Papier. Glasnegativ Siehe Benteli S. 55 KBNW_012_C1_01_00 2 1927 KANTON NIDWALDEN, Bildungsdirektion, Kantonsbibliothek Stans, 6. Februar 2019 Kissen "Programm": Kissen "Programm" Die VIELEN Alte Signatur: AvM2_003 Frau mit Hut, Textilarbeit. Glas- ARTEN Material'S negativ Goldstoff, Silber, Sammet, Seide, Leinen, Baumwolle, Seidenstück, in Spritztechnik Mädchenkopf / Kissen in verschiedenen Silber- stoffen mit Aplication KBNW_012_C1_01_0 03 1927 Zwei Kissen in Wollstoff: links: Spritztechnik auf Gewebe Alte Signatur: AvM2_004 Textilarbeit. u. Stickerei Glasnegativ rechts: Lederapplikation auf Wollstoff KBNW_012_C1_01_0 04 1927 Maria mit Kind / Muttergottes: Spritztechnik und Alte Signatur: AvM2_005. Auch "Ma- Textilarbeit. Glasnegativ wurde gekauft für die Sammlung ria mit Krone" im Gewerbemuseum "ALLWO" es Schaben u. anderem Gezie- fer wahrscheinlich Weil auf Wollstoff und mit z. T. mit Wolle bestickt war / gespritzt -

Die Dunkelschwestern (UA
Mela Meierhans - Die Dunkelschwestern (UA) Kompositionen von Mela Meierhans nach Texten und Arbeiten der Schweizer Bildenden Künstlerinnen und Autorinnen Sonja Sekula und Annemarie von Matt Im Konzert anlässlich der Ausstellung „Die Dunkelschwestern“ im Kunsthaus Aarau spielt das „ensemble dialogue“ zwei Kompositionen, welche sich auf Texte und Arbeiten der beiden Schweizer Bildenden Künstlerinnen, Autorinnen und sehr unterschiedlichen Einzelgängerinnen Sonja Sekula und Annemarie von Matt beziehen. Annemarie von Matts geliebtes „Örgeli“ (Spieldose) spielt dabei eine wesentliche Rolle. „Mela Meierhans ist mir als Komponistin aufgefallen, die ein starkes Interesse an Literatur hat, besonders an solcher von Aussenseiterinnen. Ihr Orchesterwerk nach Werken von Sonja Sekula zeugt für einen sensiblen Umgang mit abgründigen wie wortspielerischen Texten. Auf das in Auftrag gegebene neue Werk mit Vertonungen von Arbeiten Annemarie von Matts darf man deshalb gespannt sein.“ Roger Perret, Projektleiter Darstellende Künste und Literatur beim Kulturprozent des Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich Programm: Mela Meierhans: „Nightselves oder meine Nacht schläft nicht“, zu Sonja Sekula, UA der Ensemble-Version/ursprünglich für Orchester (1997); Mela Meierhans: „SCHATT-ier/IRR-ungen der Annemarie von Matt”, nach Texten von Annemarie von Matt, UA Mit: „ensemble dialogue“: Leslie Leon (Stimme), Magda Vogel (Stimme), Diane Eaton (Horn/Naturhorn), Claudia Eigenmann (Violoncello), Meinrad Haller (Klarinetten), Jürg Luchsinger (Akkordeon), Cristin Wildbolz (Kontrabass),