Christliche Thematik Im Werk Von Annemarie Von Matt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
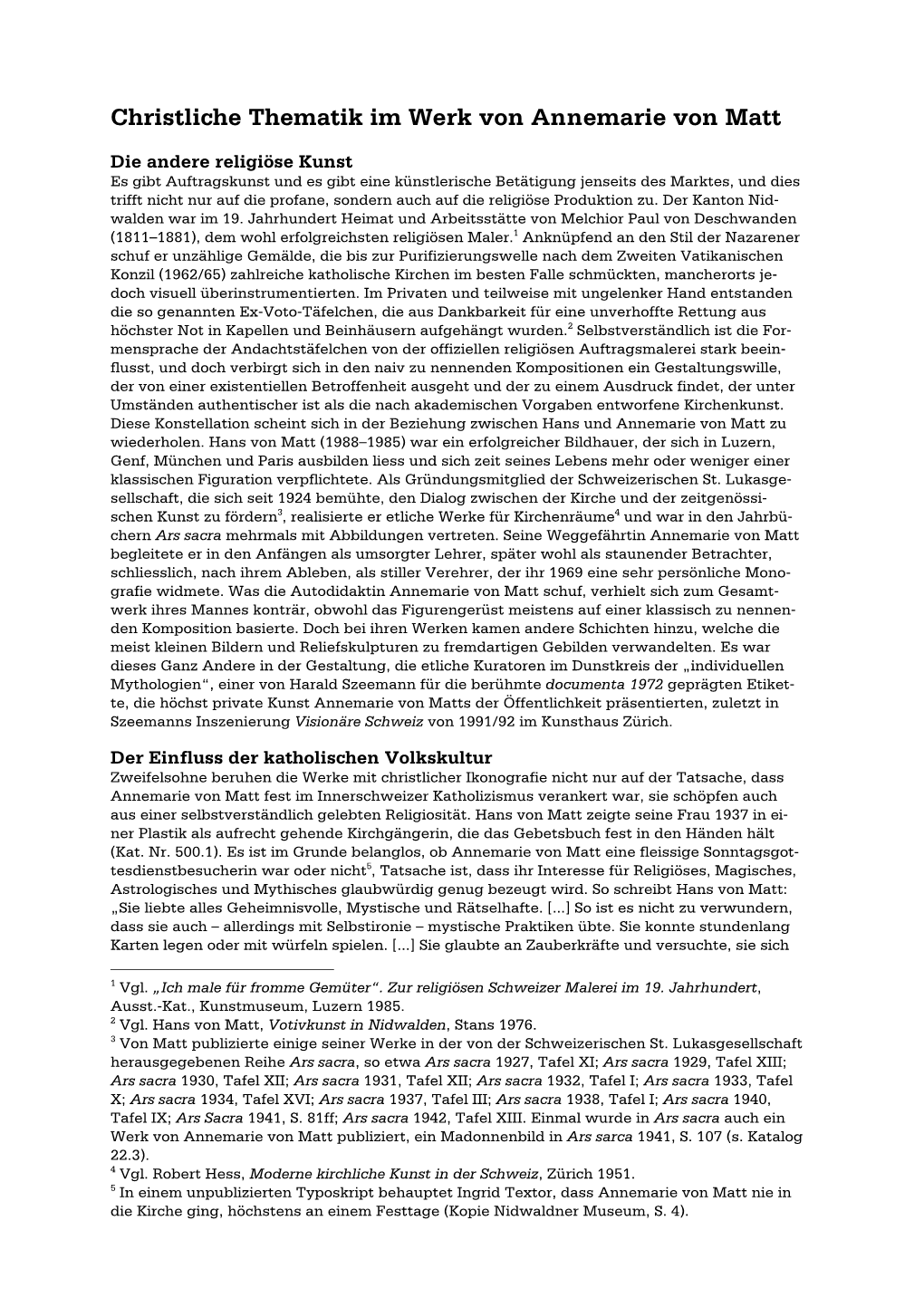
Load more
Recommended publications
-

Raiders of the Lost Ark
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 12 2020 Full Issue Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation (2020) "Full Issue," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 12. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/12 This Full Issue is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. et al.: Full Issue Swiss A1nerican Historical Society REVIEW Volu1ne 56, No. 1 February 2020 Published by BYU ScholarsArchive, 2020 1 Swiss American Historical Society Review, Vol. 56 [2020], No. 1, Art. 12 SAHS REVIEW Volume 56, Number 1 February 2020 C O N T E N T S I. Articles Ernest Brog: Bringing Swiss Cheese to Star Valley, Wyoming . 1 Alexandra Carlile, Adam Callister, and Quinn Galbraith The History of a Cemetery: An Italian Swiss Cultural Essay . 13 Plinio Martini and translated by Richard Hacken Raiders of the Lost Ark . 21 Dwight Page Militant Switzerland vs. Switzerland, Island of Peace . 41 Alex Winiger Niklaus Leuenberger: Predating Gandhi in 1653? Concerning the Vindication of the Insurgents in the Swiss Peasant War . 64 Hans Leuenberger Canton Ticino and the Italian Swiss Immigration to California . 94 Tony Quinn A History of the Swiss in California . 115 Richard Hacken II. Reports Fifty-Sixth SAHS Annual Meeting Reports . -

Perspective, 2 | 2006 Art Nouveau Et Symbolisme En Suisse : État De La Recherche Sur La Peinture, 1
Perspective Actualité en histoire de l’art 2 | 2006 La Suisse/Période moderne Art nouveau et Symbolisme en Suisse : état de la recherche sur la peinture, 1890-1914 Laurent Langer, Art Nouveau and Symbolism in Swiss painting : an overview of current research Laurent Langer, Jugendstil und Symbolismus in der Schweizer Malerei. Der aktuelle Forschungsstand. Laurent Langer, La pittura « Art nouveau » e simbolista in Svizzera : stato della ricerca Laurent Langer, La pintura « Arte nuevo » y la pintura simbolista en Suiza. Estado de la investigación Laurent Langer Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/perspective/363 DOI : 10.4000/perspective.363 ISSN : 2269-7721 Éditeur Institut national d'histoire de l'art Édition imprimée Date de publication : 30 juillet 2006 Pagination : 227-246 ISSN : 1777-7852 Référence électronique Laurent Langer, « Art nouveau et Symbolisme en Suisse : état de la recherche sur la peinture, 1890-1914 », Perspective [En ligne], 2 | 2006, mis en ligne le 31 mars 2018, consulté le 01 octobre 2020. URL : http://journals.openedition.org/perspective/363 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ perspective.363 Ce document a été généré automatiquement le 1 octobre 2020. Art nouveau et Symbolisme en Suisse : état de la recherche sur la peinture, 1... 1 Art nouveau et Symbolisme en Suisse : état de la recherche sur la peinture, 1890-1914 Laurent Langer, Art Nouveau and Symbolism in Swiss painting : an overview of current research Laurent Langer, Jugendstil und Symbolismus in der Schweizer Malerei. Der aktuelle Forschungsstand. Laurent Langer, La pittura « Art nouveau » e simbolista in Svizzera : stato della ricerca Laurent Langer, La pintura « Arte nuevo » y la pintura simbolista en Suiza. -

JAHRESBERICHT 2019 KUNSTGESELLSCHAFT LUZERN KUNSTMUSEUM LUZERN Kunstgesellschaft Luzern / Kunstmuseum Luzern Jahresbericht 2019
JAHRESBERICHT 2019 KUNSTGESELLSCHAFT LUZERN KUNSTMUSEUM LUZERN Kunstgesellschaft Luzern / Kunstmuseum Luzern Jahresbericht 2019 Aufbau der Ausstellung Turner. Das Meer und die Alpen, 2019, Foto: Marc Latzel Bericht des Präsidenten 4 Bericht der Direktorin 6 Ausstellungen 8 Medienresonanz 28 Publikationen 29 Besucherstatistik 32 Kunstvermittlung 35 Sammlung 37 Vorstand, Revisoren, Team 44 Mitglieder 46 Artclub Luzern 49 Stifung BEST Art Collection Luzern 50 Stiftung für das Kunstmuseum 52 Jahresrechnung 53 Bericht des Quästors 56 Revisionsbericht 57 Geldgeberinnen und Partner 58 3 Taryn Simon, Picture Collection. Folder: Costume – Veil, 2012, Archiv-Inkjet-Print und Letraset auf Wand, 120 × 158 cm, Edition 2 / 5, Kunstmuseum Luzern, BERICHT DES PRÄSIDENTEN Depositum der BEST Art Collection Luzern, M 2019.002q Es freut mich ausserordentlich, in meinem mittlerwei- das Erdgeschoss räumlich über den hohen Luftraum le schon sechsten Jahresbericht auf das vergangene mit unserem Foyer im 4. Obergeschoss zu verbin - Jahr zurückzublicken, da es für die Kunstgesellschaft den und im Eingangsbereich gleichsam einen Auftakt Luzern und das Kunstmuseum Luzern ein äusserst zum Museumsbesuch zu formulieren, präzis und erfolgreiches war. in seiner gewohnt spielerischen Art umgesetzt. Trotz grosser Bemühungen ist es uns nicht gelungen, die Das Hauptereignis war natürlich die anlässlich des sicherheitstechnischen Bedenken des KKL bezüglich 200-jährigen Jubiläums der Kunstgesellschaft Luzern des Standorts dieser Installation auszuräumen, so verwirklichte Ausstellung -

Militant Switzerland Vs. Switzerland, Island of Peace
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 5 2020 Militant Switzerland vs. Switzerland, Island Of Peace Alex Winiger Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation Winiger, Alex (2020) "Militant Switzerland vs. Switzerland, Island Of Peace," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 5. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/5 This Article is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Winiger: Militant Switzerland vs. Switzerland, Island Of Peace Militant Switzerland vs. Switzerland, Island of Peace Two Monuments, Two Conceptions by Alex Winiger Two monumental murals depict Switzerland during the First World War: the votive painting in the Lower Ranft Chapel in Flüeli-Ranft by Robert Durrer (1867-1934), Albert Hinter (1876- 1957) and Hans von Matt (1899-1985) from 1920-21, and the cycle of Charles L’Eplattenier (1874-1946) in the Knights’ Hall of the Co- lombier Castle from 1915-19, depicting the mobilization of Swiss soldiers in 1914.1 They report in rich details how differently artists in that country saw the war of 1914-18. Both were put into architectural monuments built around 1500.2 However, they differ greatly in their 1 For L’Eplattenier’s works at Colombier Castle, see Sylvie Pipoz-Perroset, Les décorations murales de Charles L’Eplattenier au château de Colombier (1916-1949): pour une approche de la peinture en milieu militaire, mémoire de licence (chez l’auteur 2002); id., Les décorations de Charles L’Eplattenier Colombier Castle, in: Kunst und Architektur in der Schweiz 2004.1, “Patriotische Wandmalerei im 20. -

Hans Von Matt, Verzeichnis Dokumentebene: D 1, D 2, Fotos Werk Und Private Fotos, Aus Holzkiste Und Glasplatten Kantonsbibliothek Nidwalden
KANTON BILDUNGSDIREKTION KANTONSBIBLIOTHEK Engelbergstrasse 34, Postfach 1243, 6371 Stans NIDWALDEN 041 618 73 00, www.nw.ch Hans von Matt, Verzeichnis Dokumentebene: D 1, D 2, Fotos Werk und private Fotos, aus Holzkiste und Glasplatten Kantonsbibliothek Nidwalden Bild Objektname Metadaten HvM Motiv, Beschreibung, Schlag- Besitzer worte (von KB vergeben) Signatur Vorlage Jahr Müller-Mettler, vergrösserte Im Garten eines Landhauses in gute, Risch mono T7 Risch, Martha Müller-Mettler KBNW_013_D1_00 1 Negativ 1937 Flums, gute, Grab Schmohn Grabmal Maria Schmon-Neyer, Flums KBNW_013_D1_00 2_01 Negativ 1940 Seite 1 von 231 KANTON NIDWALDEN, Bildungsdirektion, Kantonsbibliothek Stans, 10. Januar 2018 Flums, gute, Grab Schmohn Grabmal Maria Schmon-Neyer, Flums KBNW_013_D1_00 2_02 Negativ 1940 Kopp Beromünster Grabmal Major Michael Kopp- Herzog, Beromünster, evt. 1940 KBNW_013_D1_00 3_01 Negativ 1943 Kopp Beromünster Grabmal Major Michael Kopp- Herzog, Beromünster, evt. 1940 KBNW_013_D1_00 3_02 Negativ 1943 Seite 2 von 231 KANTON NIDWALDEN, Bildungsdirektion, Kantonsbibliothek Stans, 10. Januar 2018 Donatorentafel, Luzern Museum Luzern KBNW_013_D1_00 6_01 Negativ 1944 Donatorentafel, Luzern Museum Luzern KBNW_013_D1_00 6_02 Negativ 1944 Donatorentafel, Luzern Museum Luzern KBNW_013_D1_00 6_03 Negativ 1944 Seite 3 von 231 KANTON NIDWALDEN, Bildungsdirektion, Kantonsbibliothek Stans, 10. Januar 2018 Donatorentafel, Luzern Museum Luzern KBNW_013_D1_00 6_04 Negativ 1944 Halter-Ming, ganzes Grab Grabmal Wilhelm Halter-Ming, Baumeister, Friedhof Sihlfeld, -

ANNEMARIE VON MATT Widerstehlich Nidwaldner Museum
ANNEMARIE VON MATT Werkliste widerstehlich mit Beiträgen von Mathis Altmann, Sophie Jung, Judith Keller, Simone Lappert, Quinn Latimer, Céline Manz, Sam Porritt, Manon Wertenbroek 7. März —– 27. September 2020 Nidwaldner Museum Winkelriedhaus Vorwort Annemarie von Matt ist Meisterin in der Selbstins- zenierung und gilt mit ihrem prozesshaften, konzeptuellen Schaffen als Vorreiterin für Strömungen in der Kunst, die erst später, in den 1960er Jahren, als solche wahrgenommen und bezeichnet werden. Dass Annemarie von Matt ein derart eigenständiges Werk als Künstlerin, Frau und Künst- Text Patrizia Keller Patrizia Text «Ein neues Wort: WIDERSTEHLICH contra Unwidersteh- lerehefrau zu jener Zeit – vor, während und nach dem lich. Ich wäre WIDDERSTEHLICH […]» schrieb Annemarie Zweiten Weltkrieg – und in der vergleichsweise traditionel- von Matt in eines ihrer Notizbücher von 1949/1950. Widder, len Innerschweiz entwickelte, ist umso bemerkenswerter. widerborstig, gegen den Strom, unwiderstehlich, auferste- Ihre prägnanten literarischen und bildnerischen Aussagen hen, wieder… – Solche und ähnliche Assoziationen werden zu den festen, konservativen Rollenverteilungen und ihre bei mir geweckt, wenn ich das Wort «widerstehlich» lese. stete Suche, sich davon zu befreien, zeichnen ihr Werk aus. Und bei Ihnen? Wie hochaktuell Annemarie von Matts Schaffen ist, Zu ihren Lebzeiten sprengte Annemarie von Matt mit wie ihre Fragestellungen und Arbeitsweisen bis heute nicht ihrem künstlerisch-literarischen Werk die Grenzen der an Gültigkeit verloren haben, soll die Ausstellung wider- Konvention. 1905 in Root, Luzern, geboren, war die Auto- stehlich zeigen. Mit Mathis Altmann (*1987), Sophie Jung didaktin während der 20er Jahre Teil des Luzerner Künst- (*1982), Judith Keller (*1985), Simone Lappert (*1985), lerkreises und wurde zu einer über die regionalen Grenzen Quinn Latimer (*1978), Céline Manz (*1981), Sam Porritt hinaus bekannten Künstlerin. -

Chramuri Alois Arnold · 6462 Seedorf · 079 668 24 92 Inhalt
Chramuri Alois Arnold · 6462 Seedorf · 079 668 24 92 Inhalt h Zentralschweiz allg. Seite 2 bis 5 h Schwyz Seite 6 bis 10 h Obwalden Seite 11 bis 13 h Nidwalden Seite 14 bis 18 h Luzern Seite 19 bis 25 h Zug Seite 26 bis 27 h Glarus Seite 28 bis 29 Februar 2018 · 02_2_1 - Zentralschweiz Chramuri Nach Inhalt suchen mit STRG+F (PC) oder z+F (Mac) h Zum Inhaltsverzeichnis Chramuri Alois Arnold · 6462 Seedorf · 079 668 24 92 2 Zentralschweiz allg. CH 934 CH 194 Eine kulinarische Entdeckungsreise Die Innerschweiz in Vergangenheit und durch die Zentralschweiz Gegenwart Hg. Max Mittler Martin Sigrist, Beatrice Lang, Caroline. B. Stüssi Illustrationen u. Texte aus drei Jahrhunderten, Neuer Umschau Buchverlag Neustadt 2005 Fotos u.a. Iten Karl, ExLibris 1969 144 Seiten, 23.5 x 30.5 cm, Pb 157 Seiten, 17.5 x 24.5 cm, geb. Ln, SU Guter Zustand Zustand gut Fr. 20.- CH 1025 Freunde aus der Urschweiz. UR 102 Weggefährten und ihre Welt Nous. Die Urschweiz heute Jakob Wyrsch, SW-Portraits Die Urschweiz am Comptoir Suisse in Lausanne Josef von Matt Verlag Stans 1971 13.-28. Sept 1975. Konzept: Iten Karl 252 Seiten, 13 x 21 cm, geb. Ln, SU Text und Redaktion: Gerhard Oswald Guter Zustand, SU leicht gebräunt Fr. 27.- o. P., 12 x 18 cm, Taschenbuch Zustand: Leim löst sich Fr. 20.- CH 538 Wie sie heimgingen CH 419 Josef Zielmann Die Urschweiz und ihre Wappen Comenius-Verlag Hitzkirch Luzern 1982, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden 127 Seiten, 15 x 22 cm, Pb, Sign. -

Annemarie Von Matt, Verzeichnis Dokumentebene: C 1, Fotos Zum Werk Kantonsbibliothek Nidwalden
KANTON BILDUNGSDIREKTION KANTONSBIBLIOTHEK Engelbergstrasse 34, Postfach 1243, 6371 Stans NIDWALDEN 041 618 73 00, www.nw.ch Annemarie von Matt, Verzeichnis Dokumentebene: C 1, Fotos zum Werk Kantonsbibliothek Nidwalden Bild Objektname Metadaten AvM Motiv, Beschreibung, Schlagworte (von KB vergeben) Signatur Jahr Maria mit Kind: Zeichnung, Blei- Alte Signatur: AvM2_001. stift auf Papier. Glasnegativ Stickereientwurf. Die "erste Marien- zeichnung 1926" Siehe Benteli S. 55 KBNW_012_C1_01_00 1 1926 Braut mit Tulpe: Entwurf für Dieses heisst Braut Tulpe Alte Signatur: AvM2_002. Stickerei- Stickerei. Zeichnung, Bleistift entwurf auf Papier. Glasnegativ Siehe Benteli S. 55 KBNW_012_C1_01_00 2 1927 KANTON NIDWALDEN, Bildungsdirektion, Kantonsbibliothek Stans, 6. Februar 2019 Kissen "Programm": Kissen "Programm" Die VIELEN Alte Signatur: AvM2_003 Frau mit Hut, Textilarbeit. Glas- ARTEN Material'S negativ Goldstoff, Silber, Sammet, Seide, Leinen, Baumwolle, Seidenstück, in Spritztechnik Mädchenkopf / Kissen in verschiedenen Silber- stoffen mit Aplication KBNW_012_C1_01_0 03 1927 Zwei Kissen in Wollstoff: links: Spritztechnik auf Gewebe Alte Signatur: AvM2_004 Textilarbeit. u. Stickerei Glasnegativ rechts: Lederapplikation auf Wollstoff KBNW_012_C1_01_0 04 1927 Maria mit Kind / Muttergottes: Spritztechnik und Alte Signatur: AvM2_005. Auch "Ma- Textilarbeit. Glasnegativ wurde gekauft für die Sammlung ria mit Krone" im Gewerbemuseum "ALLWO" es Schaben u. anderem Gezie- fer wahrscheinlich Weil auf Wollstoff und mit z. T. mit Wolle bestickt war / gespritzt -

Die Dunkelschwestern (UA
Mela Meierhans - Die Dunkelschwestern (UA) Kompositionen von Mela Meierhans nach Texten und Arbeiten der Schweizer Bildenden Künstlerinnen und Autorinnen Sonja Sekula und Annemarie von Matt Im Konzert anlässlich der Ausstellung „Die Dunkelschwestern“ im Kunsthaus Aarau spielt das „ensemble dialogue“ zwei Kompositionen, welche sich auf Texte und Arbeiten der beiden Schweizer Bildenden Künstlerinnen, Autorinnen und sehr unterschiedlichen Einzelgängerinnen Sonja Sekula und Annemarie von Matt beziehen. Annemarie von Matts geliebtes „Örgeli“ (Spieldose) spielt dabei eine wesentliche Rolle. „Mela Meierhans ist mir als Komponistin aufgefallen, die ein starkes Interesse an Literatur hat, besonders an solcher von Aussenseiterinnen. Ihr Orchesterwerk nach Werken von Sonja Sekula zeugt für einen sensiblen Umgang mit abgründigen wie wortspielerischen Texten. Auf das in Auftrag gegebene neue Werk mit Vertonungen von Arbeiten Annemarie von Matts darf man deshalb gespannt sein.“ Roger Perret, Projektleiter Darstellende Künste und Literatur beim Kulturprozent des Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich Programm: Mela Meierhans: „Nightselves oder meine Nacht schläft nicht“, zu Sonja Sekula, UA der Ensemble-Version/ursprünglich für Orchester (1997); Mela Meierhans: „SCHATT-ier/IRR-ungen der Annemarie von Matt”, nach Texten von Annemarie von Matt, UA Mit: „ensemble dialogue“: Leslie Leon (Stimme), Magda Vogel (Stimme), Diane Eaton (Horn/Naturhorn), Claudia Eigenmann (Violoncello), Meinrad Haller (Klarinetten), Jürg Luchsinger (Akkordeon), Cristin Wildbolz (Kontrabass), -

Ausstellungen Exhibitions 2019
1 Ausstellungen / Exhibitions AUSSTELLUNGEN EXHIBITIONS 2019 09.03. 17.11. «UND DIE ALTEN FORMEN STÜRZEN EIN» KUNST UM 1800 AUS DER SAMMLUNG 09.03. 16.06. NEWS! ERWERBUNGEN IM KONTEXT DER SAMMLUNG 06.04. 26.05. KEIICHI TANAAMI In Kooperation mit Fumetto comic Festival Luzern 08.06. 25.08. ANITA ZUMBÜHL Very few things consist of a single substance – IN KOOPERATION MIT BILDENDE KUNST STADT LUZERN 06.07. 13.10. TURNER Das Meer und die Alpen 14.09. 24.11. VOM BAND ZUM BYTE Digitalisierung der Videosammlung – IN KOOPERATION MIT HELVETIA VERSICHERUNG 02.11.2019 09.02.2020 GIULIA PISCITELLI, CLEMENS VON WEDEMEYER Nella SocietÀ, IN GESELLSCHAFT 07.12.2019 09.02.2020 FABIAN PEAKE A Swift at the Corner 07.12.2019 09.02.2020 JAHRES AUSSTELLUNG ZENTRAL SCHWEIZER KUNST- SCHAFFEN, Kabinettausstellung Miriam Sturzenegger 3 Editorial / Editorial Wir feiern 200 Jahre! Die Zentral schweiz We are celebrating our 200th anniversary! war lange eine wenig entwickelte, ärmliche For a long time, Central Switzerland Region, aber im 19. Jahrhundert änderte was an under-developed and poor region. sich dies komplett: Einerseits engagierte This changed in the 19th century. On the sich die aufkommende Zivilgesellschaft one hand, nascent civil society became in zahlreichen Vereinen, was zu geistigem involved in numerous associations re- Reichtum führte. Auch die Gründung sulting in intellectual riches. The founda- der Kunstgesellschaft Luzern 1819 fällt tion of the Kunstgesellschaft Luzern in in diese Aufbruchsstimmung. Anderer- 1819 took place in that atmosphere of a seits entwickelte sich die Zentralschweiz new beginning. On the other hand, Cen- dank des einsetzenden Tourismus auch tral Switzerland also developed econom i- wirtschaftlich: Die Dampfschifffahrt auf cally thanks to the advent of tourism. -

Dorfplan Stans.Pdf
e Knirigass eg nmattw Schütze A m Reistweg e s s a g i r i WELCOME n K TO STANS! engelbergerdruck.ch Stans (pop. 8.000), capital of Nidwalden, played an igasse : Druck Knir important role in Swiss history: a heroic act by 20 S Arnold von Winkelried ended in a Swiss victory of 19 t. K eventlokal.net n la i r a- the Battle of Sempach in 1386, and Saint Nicholas of a R R a - i n Flue mediated the “Treaty of Stans” in 1481. After a ra : Gestaltung 18 a l K great fi re in 1713 many buildings and the main . t S diegoballi.ch village square were rebuilt. In 1797 J.W. Goethe 22 Rathausplatz 28 visited Stans. In 1798/99 J.H. Pestalozzi started a 12 on Illustrati school for orphaned children. Today Stans is a rather 13 se 17 tras rgs small town with wealth of culture and commerce, Mü 21 24 14 e s including Pilatus Aircraft Inc. Stans is ideally s ga piel situated for active holidays. Panoramic views of Lake 16 S turm Mark r 11 3 se tgasse Lucerne and the Alpse are magnifi cent from the as 14 27 v 15 iedg l chm 23 29 u S 26 i Stanserhorn (1900P m), accessible by a historic sl 9 Sp äs Mürgstr 1 ittelg g asse asse 9 en Näg 5 mountain railway (since 1893) and the world’s fi rst 11 8 ot elig e T asse ® s e 25 30 CabriO cable car (since 2012). -

Annemarie Von Matt – Sonja Sekula: Wie Bilder Zur Sprache Kommen Von Roman Kurzmeyer
Annemarie von Matt – Sonja Sekula: Wie Bilder zur Sprache kommen von Roman Kurzmeyer Als Sonja Sekula mit ihren Eltern 1936 Luzern verliess, um sich mit ihnen in New York niederzulassen, war sie 18 Jahre alt. Annemarie von Matt lebte vor der Heirat mit dem Bildhauer Hans von Matt 1928-1935 ebenfalls in Luzern, danach in Stans. Der Luzerner Künstlerkreis, zu dem auch der Stanser Hans von Matt zählte, war überschaubar. Hans von Matt und Annemarie von Matt kannten Bertie Sekula. 1928 beauftragte sie Hans von Matt mit dem Bildnis ihrer Tochter Sonja. Ob Annemarie von Matt später Sonja Sekula als Künstlerin wahrnahm ist ungewiss, aber doch eher unwahrscheinlich. Von Matt war eine damals in der Region durch ihre Marienbilder bekannte Malerin, deren Name aber in den vierziger Jahren, als Sekula im Kreis der im amerikanischen Exil lebenden Surrealisten um André Breton verkehrte und in New York auszustellen begann, selbst vor Ort schon wieder am verblassen war. Sekula konnte ihre Werke in zwei der bedeutendsten Avantgardegalerien New Yorks ausstellen, beide von Frauen gegründet und geleitet, zunächst ab 1943 in Peggy Guggenheims Art of This Century und später in der Galerie von Betty Parsons, in der sie neben einigen heute legendären Figuren des amerikanischen abstrakten Expressionismus wie Barnett Newman oder Mark Rothko und vielen weiteren, heute ausserhalb der Vereinigten Staaten vergessenen Künstlerinnen und Künstlern ausstellte. Unter diesen Vergessenen der Formierungsjahre des abstrakten Expressionismus sind besonders viele Künstlerinnen wie Gertrude Barrer, Perle Fine, Elaine de Kooning, Lee Krasner, Jeanne Miles, Anne Ryan, Ethel Schwabacher, Janet Sobel oder Hedda Sterne.1 Mit Annemarie von Matt und Sonja Sekula stehen hier zwei Künstlerinnen zur Diskussion, die aus demselben lokalen Künstlerkreis stammten, aber aus verschiedenen sozialen Schichten und in völlig unterschiedlichen und unverbundenen künstlerischen Milieus arbeiteten.