Radikal Sozial
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
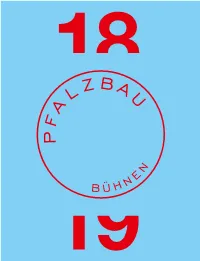
Spielzeitheft 2018 / 2019
Sommergäste 138 Eine Odyssee 039 2. Sinfoniekonzert 067 Ratten Ludwigshafen 141 Tanz Trommel 076 3. Sinfoniekonzert 092 Verzeichnis Ich lieb dich 077 4. Sinfoniekonzert 099 VERZEICHNIS 002 TANZ Utsushi 020 Die Geschichte vom kleinen Onkel 085 5. Sinfoniekonzert 111 SPIELPLAN 006 Cementary 029 Eine Weihnachtsgeschichte 086 6. Sinfoniekonzert 122 GRUSSWORTE 014 Planites 034 Kaschtanka 095 Jutta Steinruck und FREMDSPRACHIGE STÜCKE Prof. Dr. Cornelia Reifenberg 014 Extremalism / Bolero 044 Schorschi schrumpft 114 Hugo: Eine Utopie 030 Tilman Gersch 015 Scala 052 Astons Steine 121 The Institute of Global Loneliness 037 Pfalzbau Freunde 016 The Great Tamer 056 Jim Knopf 125 Clean City 040 Bacon 062 Die drei ??? – Fluch des Piraten 132 SCHAUSPIEL Die Leiden des jungen Werther 094 Die unendliche Geschichte Monsieur Claude und seine Töchter 021 Grand Finale 068 136 A Christmas Carol 142 Dead Poets Rock 144 Schloss Prozess Verwandlung 023 Carmen 074 Crooked Letter, Crooked Letter 142 Pasionaria 078 Fremde Heimat 024 EXTRAS JUNGER PFALZBAU – KURSE Huang Yi & KUKA 081 Ottoman Sufi-Night 025 Hugo: Eine Utopie 030 Für die Allerkleinsten 144 NACH ATHEN! The Institute of Global Loneliness 037 Carmina Burana 088 Internationales Festival Ludwigshafen 027 Für Kinder von 4 – 10 146 Clean City 040 La Fresque 090 James Tuft 031 Für Jugendliche 147 Wer hat Angst vor Virginia Woolf? 046 Autobiography 096 Politeia 033 Generationenprojekt 152 Geächtet 048 The Gift 100 Für Menschen mit Beeinträchtigung 152 Onom Agemo & The Disco Jumpers 035 Die Selbstmordschwestern -

Schauspiel 19 20
SCHAUSPIEL 19 20 VORWORT Liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Vertrauen und die überwältigende positive Resonanz, die Sie unserem Angebot im letzten Jahr entgegengebracht haben. Sie haben be wiesen, dass Bonn eine Theaterstadt ist und sein Schauspielhaus unbedingt behalten will. Und wir sind glücklich, für Sie spielen zu dürfen und weiterhin mit Ihnen darüber zu diskutieren, wie wir uns ein gemeinsames, friedliches Zusammenleben in dieser Stadt vorstellen können und wollen. Denn Theater ist ein Möglichkeitsraum, wo „kostbare Momente der gemeinsamen Erfahrung“ produziert werden, „ein Fest des Augenblicks und der gegenwärtigen Anwesenheit“ (Ulrich Khuon, Bonn, März 2019). Auch in der kommenden Spielzeit bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Themen und unterschiedlichen künstlerischen Handschriften an. Natürlich wollen wir ebenso spielfreudig, fantasievoll, kritisch, aber auch humorvoll auf die Probleme unserer Zeit sehen wie im letzten Jahr und uns wieder von den Grundfragen der Aufklärung leiten lassen. Wenn wir uns in der letzten Spielzeit augenzwinkernd mit der Leibnizschen Aussage „Die Welt ist die beste aller denkbaren Möglichkeiten“ beschäftigt haben, also mit der sogenannten Conditio Humana, dann richten wir den Blick dieses Jahr mehr auf die zentra len Fragen der praktischen Vernunft. Ausgehend von der Beschäftigung mit den Handlungsmustern des Menschen und seiner Gesellschaftssysteme, gehen wir nun folgenden Fragen nach: Was ist gutes oder besseres Handeln? Wie sollte man handeln, wenn man zusammenleben will? In welchen Zwängen steckt das Individuum bei seinen Versuchen, frei und vorbehaltslos zu handeln? Scheinbar überkommene Begriffe wie Moral, Ehre, Verantwortung, Lüge, Miss gunst usw. untersuchen wir neu, versuchen sie anhand literarischer Beispiele vom 17. Jahrhundert bis in die Zukunft hinein zu deuten. -

Gastspiele / Programm 2018 KLUGE GEFÜHLE Von Maryam Zaree In
Gastspiele / Programm 2018 KLUGE GEFÜHLE von Maryam Zaree in der Regie von Isabel Osthues, Theater und Orchester Heidelberg DICKHÄUTER von Tina Müller in der Regie von Brigitta Soraperra , Theater Fallalpha Zürich SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD (Amerika-Trilogie Teil I) von Klaus Gehre nach Sergio Leone in der Regie von Klaus Gehre, Staatstheater Braunschweig VOR SONNENAUFGANG von Ewald Palmetshofer nach Gerhart Hauptmann in der Regie von Nora Schlocker, Theater Basel PUSSY RIOTS von Magz Barrawasser und Florian Heller in der Regie von Magz Barrawasser, Schauspiel Essen HOMOHALAL von Ibrahim Amir in der Regie von Laura Linnenbaum, Staatsschauspiel Dresden ZUCKEN von Sasha Marianna Salzmann in der Regie von Sebastian Nübling, junges theater basel in Kooperation mit dem Maxim Gorki Theater DREI SIND WIR von Wolfram Höll in der Regie von Valerie Voigt-Firon, Burgtheater Wien JA, EH! BEISL, BIER UND BACHMANNPREIS von Stefanie Sargnagel in der Regie von Christina Tscharyiski, Rabenhof Theater Wien FRÄULEIN AGNES von Rebekka Kricheldorf in der Regie von Erich Sidler, DT Göttingen VERSETZUNG von Thomas Melle in der Regie von Brit Bartkowiak, Deutsches Theater Berlin DAS HEIMATKLEID von Kirsten Fuchs in der Regie von Tim Egloff, GRIPS Theater Berlin GEISTER SIND AUCH NUR MENSCHEN von Katja Brunner in der Regie von Claudia Bauer, Schauspiel Leipzig VEREINTE NATIONEN von Clemens J. Setz in der Regie von Holle Münster (Prinzip Gonzo), Volkstheater Wien in Kooperation mit dem Max Reinhardt Seminar GET DEUTSCH OR DIE TRYIN ̓ von Necati Öziri in der Regie -

Publicly Funded Music Theatres
Publicly funded music theatres Sources: German Music Information Centre and German Theatre and Orchestra Association, 2018 Flensburg Schleswig-Holsteinisches Landestheater Stralsund A Aalto-Theater Essen Theater Vorpommern B Theater Krefeld und Mönchengladbach Rendsburg MUSIC THEATRES C Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf Theater Kiel Greifswald D Theater & Philharmonie Thüringen, Altenburg State theatre E Mittelsächsisches Theater Theater Lübeck Volkstheater Rostock Regional theatre Neubrandenburg Municipal (or municipal Stadttheater Theater und Orchester union) theatre Bremerhaven Neubrandenburg/Neustrelitz Hamburgische Mecklenburgisches Staatsoper Staatstheater, Schwerin Neustrelitz Music theatre with two or more sites Theater Bremen Theater Lüneburg Oldenburgisches Staatstheater Komische Oper SEATING CAPACITY OF Berlin PRINCIPAL VENUES Staatsoper Staatsoper Unter den Linden, Berlin Hannover Städtische Bühnen Staatstheater Osnabrück Braunschweig Brandenburger 2,023 Theater8 Friedrichstadt-Palast, Berlin 1,000 Theater Bielefeld Deutsche 500 Theater Münster Theater Oper Berlin Halber- Magdeburg stadt 102 TfN · Theater für Nordharzer Anhaltisches Theater Musiktheater im Revier, Niedersachsen, Hildesheim Städtebund- Dessau, Dessau-Roßlau Staatstheater Gelsenkirchen Landestheater theater9 Cottbus Note: The map indicates the primary per- Detmold Theater Duisburg Nordhausen Quedlinburg Oper formance location for the theatre concerned; Krefeld Theater Dortmund Leipzig – other auditoriums or venues are excluded. A Oper Halle Opernhaus Sorbisches -

2011 Bonitz, Sarah Theater Augsburg Clauß, Christian Staatsschauspiel
Absolventenverträge 2010 - 2015 2010 Belitski, Natalia Düsseldorfer Schauspielhaus Böhm, Georg Theater Bielefeld Crisand, Benedikt Theater Heidelberg Eckert, Edgar Centraltheater Leipzig Hans, Paula Deutsches Theater Göttingen Hänsel, Laura a.G. Schauspiel Essen Jopt, Lisa Schauspiel Essen Kosel, David Braunschweig Nowak, Jannik Schauspiel Essen Prisor, Lukas Berliner Ensemble Ruchter, Michael Theater Rostock Schuch, Albrecht Maxim-Gorki-Theater Berlin Simon, David a.G. Schauspiel Essen Talinski, Johann David Staatstheater Braunschweig Tessenow, Sebastian Schauspiel Essen Wulf, Franziska Zürich, Neumarkt 2011 Bonitz, Sarah Theater Augsburg Clauß, Christian Staatsschauspiel Dresden Crisand, Benedikt Theater Heidelberg Gröschel, Cornelia Staatstheater Karlsruhe Kauff, Benedikt a.G. Staatsschauspiel Dresden Koschorz, Jeremias Theater Magdeburg Krause, Annett a.G. Staatsschauspiel Dresden Löffler, Sophia Staatstheater Karlsruhe Löwe, Moritz Theater Oberhausen Momann, Henner Theater Oldenburg Pensel, Alexander neues Theater Halle Pätzold, Franz Residenztheater München Reincke, Franziska Junges Theater Göttingen Steinhauser, Johanna Theater Plauen/Zwickau Steinmacher, Alois Regiestudium Salzburg Schumacher, Thomas Deutsches Theater Berlin Strohbach, Georg Theater Neuss Weinreich, Eike Theater Oberhausen Westernströer, Ines Staatsschauspiel Dresden Absolventenverträge 2010 - 2015 2012 Beykirch, Mareike Theater Düsseldorf Buchholz, Nils freischaffend als „Nisse Barfuss“ Hastenpflug, Timo Hessisches Landestheater Marburg Haupt, Carolin Centraltheater -

Download Auf Unse- Schauspieldramaturg Am Volkstheater Publikum Am Landestheater Linz
zeitschrift der dramaturgischen gesellschaft 02/14 leben, kunst und produktion wie wollen wir arbeiten? dokumentation der jahreskonferenz der dramaturgischen gesellschaft mannheim 23.– 26. januar 2014 editorial Sagen, was man denkt und tun, was man sagt outside the box: o soll man anfangen, wenn man die diesjährige dg-Jahres- über die man im Verlauf der Konferenz so ausführlich dis- market wkonferenz zusammenfassen will? Wo aufhören? Vielleicht kutiert habe. Mit einem Zitat aus dem alten DEFA-Kultfilm war es ein Spezifikum dieser Tagung, dass es keine Bottom Spur der Steine: »Wichtig ist nur eines. Man muss sagen, was Line, kein eindeutiges Ergebnis, keine politische Forderung man denkt und tun, was man sagt.« oder gar ein künstlerisches Manifest gab. Vielleicht steht 5–7/jun am Ende die einfache, aber deswegen noch lange nicht über- In dieser Dokumentation finden Sie, neben einem ausführ- flüssige Erkenntnis, dass weniger mehr ist. Dass wir Drama- lichen Bericht über die Konferenz von Maren Kames, die zeitraumexit turgen darauf achtgeben müssen, die Balance zu wahren: prägnantesten Vorträge von Niko Paech, Axel Haunschild zwischen künstlerischem Gestaltungswillen, Angestellten- und Ulf Schmidt sowie die auf der Konferenz vorgestellten mannheim dasein und Leitungsverantwortung, zwischen kreativer Fik- Best Practice-Beispiele aus Großbritannien und Belgien tion und institutioneller Wirklichkeit, zwischen Kunst und und die Abschlussdiskussion. Einige Eindrücke von den Leben. Oder ist das alles Work-Life-Bullshit und die Lösung zahlreichen Beiträgen der Teilnehmer geben wir skizzen- liegt ganz woanders, etwa im Übergang ins digitale Zeital- haft in den Stichworten der Open Space-Diskussionen und symposium ter? Am Ende dieser Konferenz schwirrte so mancher Kopf, einigen Randnotizen wieder. -

Öffentlich Finanzierte Musiktheater
Öffentlich finanzierte Musiktheater Quellen: Deutsches Musikinformationszentrum und Deutscher Bühnenverein 2018 Flensburg Schleswig-Holsteinisches Landestheater Stralsund A Aalto-Theater Essen Theater Vorpommern B Theater Krefeld und Mönchengladbach Rendsburg MUSIKTHEATER C Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf Theater Kiel Greifswald D Theater & Philharmonie Thüringen, Altenburg Staatstheater E Mittelsächsisches Theater Theater Lübeck Volkstheater Rostock Landestheater Neubrandenburg Stadt- bzw. Städtebund- Stadttheater Theater und Orchester theater Bremerhaven Neubrandenburg/Neustrelitz Hamburgische Mecklenburgisches Staatsoper Staatstheater, Schwerin Neustrelitz Musiktheater mit mehreren Standorten Theater Bremen Theater Lüneburg Oldenburgisches Staatstheater Komische Oper SITZPLATZANGEBOT Berlin DER HAUPTSPIEL- Staatsoper Staatsoper Unter den Linden, Berlin Hannover STÄTTEN Städtische Bühnen Staatstheater Osnabrück Braunschweig Brandenburger 2.023 Theater8 Friedrichstadt-Palast, Berlin 1.000 Theater Bielefeld Deutsche 500 Theater Münster Theater Oper Berlin Halber- Magdeburg stadt 102 TfN · Theater für Niedersachsen, Nordharzer Anhaltisches Theater Musiktheater im Revier, Städtebund- Dessau, Dessau-Roßlau Staatstheater Hildesheim 9 Gelsenkirchen Landestheater theater Cottbus Hinweis: Dargestellt ist der jeweilige Detmold Theater Duisburg Nordhausen Quedlinburg Oper primäre Aufführungsort für Musiktheater; Krefeld Theater Dortmund Leipzig – weitere Säle oder Aufführungsstätten wer- A Oper Halle Sorbisches Opernhaus Landesbühnen B National-Ensemble, -

Theater & Orchester an Neuen Orten
TTHEATERHEATER & OORCHESTERRCHESTER AANN NNEUENEUEN OORTENRTEN SEHNSUCHT 14.10.09 ÜBER UNS Seite 2 Intendant Und dann das THEATERKINO Kerstin Grübmeyer und Nina Stadt für die nächsten Jahre öffentlichen Premierenfeiern! in der Hauptstraße: Auch die- Steinhilber auf Heidelberg. als Wirkungsstätte gewählt Ich wünsche uns allen eine sen Ort haben wir völlig neu Ebenso geht es den beiden haben. Jetzt sind sie als anregende Spielzeit 2009/10! und sehr ungewöhnlich ge- neuen Mitarbeiterinnen un- Gäste hier – bei Ihnen. Später Eine neue Zeit beginnt jetzt! staltet. Das hat sich herumge- seres Generalmusikdirektors werden sie Botschafter Hei- Übrigens können Sie uns sprochen und auch tagsüber und unseres Orchesters, der delbergs in der Welt sein und auch mailen: Vorname.Nach- kommen die Besucher. Hier Orchestergeschäftsführerin von der Offenheit, der Dis- [email protected] oder laufen exklusiv die Theater- Birgit Veddeler und der Kon- kussionsfreudigkeit und dem [email protected]. fassungen berühmter Filme. zertdramaturgin Maria Goeth. Kunstsinn des hiesigen Publi- In unseren Ensembles gilt kums berichten. Sie, unsere Ihr Doch nicht nur die zwei aufre- es junge, vielversprechende Zuschauer wissen: neben der Lieber Theaterfreunde, genden neue Spielorte prägen Künstler willkommen zu Universität sind wir die an- Peter Spuhler, Intendant in den nächsten Jahren die heißen – bitte schließen Sie dere Institution, die stolz ist, eine neue Zeit beginnt jetzt – unsere Arbeit, sondern auch sie rasch in Ihr Herz: sie ha- so viele Menschen aus aller für das Heidelberger Theater eine Vielzahl neuer Mitarbei- ben es mehr als verdient! Ich Welt zu beschäftigen. Aus Peter Spuhler studierte in und für Sie, unsere Besucher! ter. Über vierzig neue „Feste“ bin mir sicher, dass unsere Dutzenden unterschiedlichen Wien Regie und Dramaturgie. -

MUSICAL Life
Contents | 10 | Concert Halls 274 MUSICAL LIFE Benedikt Stampa 11 | Festspiele and Festivals 300 in Germany Franz Willnauer 12 | Contemporary Music 328 CONTENTS Stefan Fricke 13 | Popular Music 350 Intro Prefatory note Preface Editorial note Peter Wicke Music Monika Grütters Martin Maria Krüger German Music 14 | Jazz 376 is variety Minister of State for President of the Information Centre Hans-Jürgen Linke Culture and the Media German Music Council 15 | World Music 400 Julio Mendívil 8 22 24 26 16 | Music in Church 414 Meinrad Walter 17 | Musicology 444 Essays Page Dörte Schmidt 18 | Information and Documentation 464 1 | Introduction: Musical Life in Germany 30 Martina Rebmann, Reiner Nägele Christian Höppner 19 | Music Museums and Musical Instrument Collections 486 2 | Music in Germany’s State Education System 50 Heike Fricke Ortwin Nimczik 20 | Preferences and Publics 510 3 | Music Education Outside the State School System 80 Karl-Heinz Reuband Michael Dartsch 21 | Music in Broadcasting 536 4 | Music Communication 108 Holger Schramm Johannes Voit 22 | Music Economy 566 5 | Education for Music Professions 130 Wolfgang Seufert Hans Bäßler, Ortwin Nimczik 6 | Amateur Music-Making 160 Astrid Reimers The German 7 | Orchestras, Radio Ensembles and Opera Choruses 188 Music Council 600 Gerald Mertens Barbara Haack 8 | Independent Ensembles 218 Richard Lorber, Tobias Eduard Schick List of institutions and abbreviations 614 9 | Music Theatre 244 Arnold Jacobshagen Picture credits 616 6 7 Prefatory Note | and abroad who are interested in the diversity of Germany’s musical life and its current offerings, contacts and statistics. Nowhere else can one find such a huge amount of information on Germany’s music in such a convenient yet authoritative form. -

SPIELZEIT 2021 | 2022 September Bis Januar TERMINE Spielzeit 2021 | 2022
SPIELZEIT 2021 | 2022 September bis Januar TERMINE Spielzeit 2021 | 2022 Sa 04.09. 19:30 DIRK SCHÄFER SINGT JACQUES BREL: 2021 DOCH DAVON NICHT GENUG! . S. 08 So 05.09. 19:30 Premiere DAS LEBEN EIN TRAUM . S. 10 Mi 08.09. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. S. 12 September Do 09.09. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Fr 10.09. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. S. 12 So 12.09. 19:30 FESTE. S. 14 Do 16.09. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Do 23.09. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Fr 24.09. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. S. 12 Mi 29.09. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Fr 01.10. 19:30 IPHIGENIA. S. 16 Sa 02.10. 19:30 Premiere DER TOD UND EIN MÄDCHEN . S. 18 2021 Mo 04.10. 19:30 IPHIGENIA. S. 16 Di 05.10. 19:30 KELLER . S. 20 Oktober Do 07.10. 19:30 ANNE-MARIE DIE SCHÖNHEIT. S. 22 Fr 08.10. 19:30 DR NEST . S. 24 Sa 09.10. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. S. 12 Mi 13.10. 19:30 Premiere LET'S WORK. S. 26 Do 14.10. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Fr 15.10. 19:30 DIRK SCHÄFER SINGT JACQUES BREL: DOCH DAVON NICHT GENUG! . S. 08 Do 21.10. 19:30 LET'S WORK . S. 26 Fr 22.10. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 So 24.10. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. -
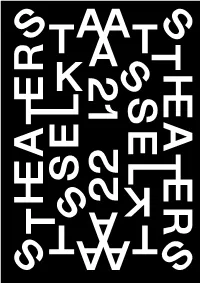
Spielzeitheft 21 22 Web 2Fe63
1 2 Wozzeck 44 How to Gatsby 2483 Oper von Alban Berg frei nach dem Roman Der große ML: Francesco Angelico Gatsby von F. Scott Fitzgerald R: Florian Lutz für alle ab 14 Jahren Premiere 24. Sep 2021 R: Benjamin Hoesch → Opernhaus und Barbara Frazier Premiere 26. Sep 2021 Tosca 46 → TiF – Theater im Fridericianum Musikdrama in drei Akten von Giacomo Puccini Sein oder Nichtsein 90 ML: Francesco Angelico Komödie von Nick Whitby R: Sláva Daubnerová nach dem Film von Ernst Lubitsch Premiere 25. Sep 2021 R: Christian Weise → Opernhaus Premiere 9. Okt 2021 → Schauspielhaus Die gute Erde (UA) 86 nach dem Roman Der Funke Leben (UA) 92 von Pearl S. Buck nach dem Roman R: Mina Salehpour von Erich Maria Remarque Premiere 25. Sep 2021 R: Lars-Ole Walburg → Schauspielhaus Premiere 22. Okt 2021 → Schauspielhaus FAUST Gretchen 88 Eine theatrale Videoinstallation Cabaret 48 nach Johann Wolfgang von Musical von John Kander, Goethe Joe Masteroff und Fred Ebb R: Bert Zander ML: Peter Schedding Premiere 25. Sep 2021 R: Henriette Hörnigk → TiF – Theater im Fridericianum Premiere 23. Okt 2021 → Opernhaus Schwanensee | Zwanenmeer | UA) 148 A Divine Comedy 94 / 152) אגם הברבורים Tanzdoppelabend von United Tanzperformance Cowboys und Roni Chadash von Florentina Holzinger Premiere 26. Sep 2021 Premiere 29. Okt 2021 → Schauspielhaus → Schauspielhaus Oh yeah, Baby! 246 In einem tiefen, dunklen Wald Ein (mobiles) Discostück Ein Familienstück nach Paul Maar von Leandro Kees für alle ab 6 Jahren 250 für alle ab 2 Jahren R: Cordula Jung Premiere 26. Sep 2021 Premiere: 4. Nov 2021 → TiF Foyer → Opernhaus Tausend4 deutsche Diskotheken Weihnachtsoratorium 50 Krabat 254 Der Kirschgarten 112 (UA) 96 Partizipatives Musiktheater+ mit Ein Jugendstück+ nach Otfried Komödie von Anton Tschechow Eine Serie nach dem Roman Musik von Johann Sebastian Bach Preußler für alle ab 14 Jahren R: Jan Friedrich von Michel Decar ML: Kiril Stankow R: Barbara Frazier Premiere 7. -
Schauspiel Frankfurt Spielzeit 18/19
SIND? WIR GEWORDEN WIR SCHAUSPIEL FRANKFURT SPIELZEIT 18/19 WER WIR WIR WER WIE SIND SIND WIE UM BRÜCHE BRÜCHEUM WER WIR WIE SIND SIND? WIR GEWORDEN 1 Eine große Frage, die wir auf der Bühne natürlich nicht be- antworten können, aber die wir exemplarisch anhand be- stimmter Themen mit den Mitteln des Theaters beleuchten wollen. Dabei haben uns spannende Autor_innen unter- stützt: Das Autorenerfolgsduo Lutz Hübner und Sarah INHALT Nemitz, der holländische Regisseur und Autor Eric de Vroedt, die Autoren Clemens Meyer und Jan Neumann so- wie für unsere Monodramen-Serie »Stimmen einer Stadt« die Autorin Antje Rávic Strubel und die Autoren Martin LIEBES Mosebach und Thomas Pletzinger. Stoffe und Stücke wichtiger Gegenwartsautoren werden außerdem erst- mals am Schauspiel Frankfurt auf die Bühne gebracht: von dem großen jüdischen Schriftsteller David Grossman, PUBLIKUM dem englischen Regisseur und Autor Tim Crouch, dem österreichischen Dramatiker Ewald Palmetshofer und unserem Autor und Dramaturgen Konstantin Küspert. Zugleich wird in unserer dreijährigen Kooperation mit dem Mousonturm Rimini-Protokoll, die in Frankfurt als Künst- lerkollektiv ihre Wurzeln haben, ein neues Projekt mit den ir sind am Schauspiel Frankfurt und in dieser Menschen dieser Stadt entwickeln. Stadt angekommen: Ihr Interesse an unserem neuen Ensemble und Ihre Offenheit für viele Erfolgreich haben wir mit unserem großen kulturellen Bil- unterschiedliche ästhetische Ansätze auf der dungsprojekt »All Our Futures« begonnen, das jetzt mit Bühne haben uns durch eine erfolgreiche fast 200 Jugendlichen, neun Pädagog_innen und zehn erste Spielzeit getragen. Der Publikumszu- Künstler_innen aus der freien Szene an drei verschiede- spruch war riesig und Ihr Vertrauen großartig, nen Orten der Stadt in seine zweite Runde geht.