Geteilte Zeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
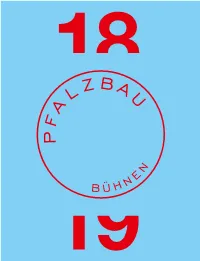
Spielzeitheft 2018 / 2019
Sommergäste 138 Eine Odyssee 039 2. Sinfoniekonzert 067 Ratten Ludwigshafen 141 Tanz Trommel 076 3. Sinfoniekonzert 092 Verzeichnis Ich lieb dich 077 4. Sinfoniekonzert 099 VERZEICHNIS 002 TANZ Utsushi 020 Die Geschichte vom kleinen Onkel 085 5. Sinfoniekonzert 111 SPIELPLAN 006 Cementary 029 Eine Weihnachtsgeschichte 086 6. Sinfoniekonzert 122 GRUSSWORTE 014 Planites 034 Kaschtanka 095 Jutta Steinruck und FREMDSPRACHIGE STÜCKE Prof. Dr. Cornelia Reifenberg 014 Extremalism / Bolero 044 Schorschi schrumpft 114 Hugo: Eine Utopie 030 Tilman Gersch 015 Scala 052 Astons Steine 121 The Institute of Global Loneliness 037 Pfalzbau Freunde 016 The Great Tamer 056 Jim Knopf 125 Clean City 040 Bacon 062 Die drei ??? – Fluch des Piraten 132 SCHAUSPIEL Die Leiden des jungen Werther 094 Die unendliche Geschichte Monsieur Claude und seine Töchter 021 Grand Finale 068 136 A Christmas Carol 142 Dead Poets Rock 144 Schloss Prozess Verwandlung 023 Carmen 074 Crooked Letter, Crooked Letter 142 Pasionaria 078 Fremde Heimat 024 EXTRAS JUNGER PFALZBAU – KURSE Huang Yi & KUKA 081 Ottoman Sufi-Night 025 Hugo: Eine Utopie 030 Für die Allerkleinsten 144 NACH ATHEN! The Institute of Global Loneliness 037 Carmina Burana 088 Internationales Festival Ludwigshafen 027 Für Kinder von 4 – 10 146 Clean City 040 La Fresque 090 James Tuft 031 Für Jugendliche 147 Wer hat Angst vor Virginia Woolf? 046 Autobiography 096 Politeia 033 Generationenprojekt 152 Geächtet 048 The Gift 100 Für Menschen mit Beeinträchtigung 152 Onom Agemo & The Disco Jumpers 035 Die Selbstmordschwestern -

Publicly Funded Music Theatres
Publicly funded music theatres Sources: German Music Information Centre and German Theatre and Orchestra Association, 2018 Flensburg Schleswig-Holsteinisches Landestheater Stralsund A Aalto-Theater Essen Theater Vorpommern B Theater Krefeld und Mönchengladbach Rendsburg MUSIC THEATRES C Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf Theater Kiel Greifswald D Theater & Philharmonie Thüringen, Altenburg State theatre E Mittelsächsisches Theater Theater Lübeck Volkstheater Rostock Regional theatre Neubrandenburg Municipal (or municipal Stadttheater Theater und Orchester union) theatre Bremerhaven Neubrandenburg/Neustrelitz Hamburgische Mecklenburgisches Staatsoper Staatstheater, Schwerin Neustrelitz Music theatre with two or more sites Theater Bremen Theater Lüneburg Oldenburgisches Staatstheater Komische Oper SEATING CAPACITY OF Berlin PRINCIPAL VENUES Staatsoper Staatsoper Unter den Linden, Berlin Hannover Städtische Bühnen Staatstheater Osnabrück Braunschweig Brandenburger 2,023 Theater8 Friedrichstadt-Palast, Berlin 1,000 Theater Bielefeld Deutsche 500 Theater Münster Theater Oper Berlin Halber- Magdeburg stadt 102 TfN · Theater für Nordharzer Anhaltisches Theater Musiktheater im Revier, Niedersachsen, Hildesheim Städtebund- Dessau, Dessau-Roßlau Staatstheater Gelsenkirchen Landestheater theater9 Cottbus Note: The map indicates the primary per- Detmold Theater Duisburg Nordhausen Quedlinburg Oper formance location for the theatre concerned; Krefeld Theater Dortmund Leipzig – other auditoriums or venues are excluded. A Oper Halle Opernhaus Sorbisches -

Öffentlich Finanzierte Musiktheater
Öffentlich finanzierte Musiktheater Quellen: Deutsches Musikinformationszentrum und Deutscher Bühnenverein 2018 Flensburg Schleswig-Holsteinisches Landestheater Stralsund A Aalto-Theater Essen Theater Vorpommern B Theater Krefeld und Mönchengladbach Rendsburg MUSIKTHEATER C Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf Theater Kiel Greifswald D Theater & Philharmonie Thüringen, Altenburg Staatstheater E Mittelsächsisches Theater Theater Lübeck Volkstheater Rostock Landestheater Neubrandenburg Stadt- bzw. Städtebund- Stadttheater Theater und Orchester theater Bremerhaven Neubrandenburg/Neustrelitz Hamburgische Mecklenburgisches Staatsoper Staatstheater, Schwerin Neustrelitz Musiktheater mit mehreren Standorten Theater Bremen Theater Lüneburg Oldenburgisches Staatstheater Komische Oper SITZPLATZANGEBOT Berlin DER HAUPTSPIEL- Staatsoper Staatsoper Unter den Linden, Berlin Hannover STÄTTEN Städtische Bühnen Staatstheater Osnabrück Braunschweig Brandenburger 2.023 Theater8 Friedrichstadt-Palast, Berlin 1.000 Theater Bielefeld Deutsche 500 Theater Münster Theater Oper Berlin Halber- Magdeburg stadt 102 TfN · Theater für Niedersachsen, Nordharzer Anhaltisches Theater Musiktheater im Revier, Städtebund- Dessau, Dessau-Roßlau Staatstheater Hildesheim 9 Gelsenkirchen Landestheater theater Cottbus Hinweis: Dargestellt ist der jeweilige Detmold Theater Duisburg Nordhausen Quedlinburg Oper primäre Aufführungsort für Musiktheater; Krefeld Theater Dortmund Leipzig – weitere Säle oder Aufführungsstätten wer- A Oper Halle Sorbisches Opernhaus Landesbühnen B National-Ensemble, -

MUSICAL Life
Contents | 10 | Concert Halls 274 MUSICAL LIFE Benedikt Stampa 11 | Festspiele and Festivals 300 in Germany Franz Willnauer 12 | Contemporary Music 328 CONTENTS Stefan Fricke 13 | Popular Music 350 Intro Prefatory note Preface Editorial note Peter Wicke Music Monika Grütters Martin Maria Krüger German Music 14 | Jazz 376 is variety Minister of State for President of the Information Centre Hans-Jürgen Linke Culture and the Media German Music Council 15 | World Music 400 Julio Mendívil 8 22 24 26 16 | Music in Church 414 Meinrad Walter 17 | Musicology 444 Essays Page Dörte Schmidt 18 | Information and Documentation 464 1 | Introduction: Musical Life in Germany 30 Martina Rebmann, Reiner Nägele Christian Höppner 19 | Music Museums and Musical Instrument Collections 486 2 | Music in Germany’s State Education System 50 Heike Fricke Ortwin Nimczik 20 | Preferences and Publics 510 3 | Music Education Outside the State School System 80 Karl-Heinz Reuband Michael Dartsch 21 | Music in Broadcasting 536 4 | Music Communication 108 Holger Schramm Johannes Voit 22 | Music Economy 566 5 | Education for Music Professions 130 Wolfgang Seufert Hans Bäßler, Ortwin Nimczik 6 | Amateur Music-Making 160 Astrid Reimers The German 7 | Orchestras, Radio Ensembles and Opera Choruses 188 Music Council 600 Gerald Mertens Barbara Haack 8 | Independent Ensembles 218 Richard Lorber, Tobias Eduard Schick List of institutions and abbreviations 614 9 | Music Theatre 244 Arnold Jacobshagen Picture credits 616 6 7 Prefatory Note | and abroad who are interested in the diversity of Germany’s musical life and its current offerings, contacts and statistics. Nowhere else can one find such a huge amount of information on Germany’s music in such a convenient yet authoritative form. -

SPIELZEIT 2021 | 2022 September Bis Januar TERMINE Spielzeit 2021 | 2022
SPIELZEIT 2021 | 2022 September bis Januar TERMINE Spielzeit 2021 | 2022 Sa 04.09. 19:30 DIRK SCHÄFER SINGT JACQUES BREL: 2021 DOCH DAVON NICHT GENUG! . S. 08 So 05.09. 19:30 Premiere DAS LEBEN EIN TRAUM . S. 10 Mi 08.09. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. S. 12 September Do 09.09. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Fr 10.09. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. S. 12 So 12.09. 19:30 FESTE. S. 14 Do 16.09. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Do 23.09. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Fr 24.09. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. S. 12 Mi 29.09. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Fr 01.10. 19:30 IPHIGENIA. S. 16 Sa 02.10. 19:30 Premiere DER TOD UND EIN MÄDCHEN . S. 18 2021 Mo 04.10. 19:30 IPHIGENIA. S. 16 Di 05.10. 19:30 KELLER . S. 20 Oktober Do 07.10. 19:30 ANNE-MARIE DIE SCHÖNHEIT. S. 22 Fr 08.10. 19:30 DR NEST . S. 24 Sa 09.10. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. S. 12 Mi 13.10. 19:30 Premiere LET'S WORK. S. 26 Do 14.10. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 Fr 15.10. 19:30 DIRK SCHÄFER SINGT JACQUES BREL: DOCH DAVON NICHT GENUG! . S. 08 Do 21.10. 19:30 LET'S WORK . S. 26 Fr 22.10. 19:30 DAS LEBEN EIN TRAUM. S. 10 So 24.10. 19:30 YVONNE, PRINZESSIN VON BURGUND. -
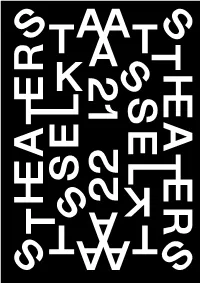
Spielzeitheft 21 22 Web 2Fe63
1 2 Wozzeck 44 How to Gatsby 2483 Oper von Alban Berg frei nach dem Roman Der große ML: Francesco Angelico Gatsby von F. Scott Fitzgerald R: Florian Lutz für alle ab 14 Jahren Premiere 24. Sep 2021 R: Benjamin Hoesch → Opernhaus und Barbara Frazier Premiere 26. Sep 2021 Tosca 46 → TiF – Theater im Fridericianum Musikdrama in drei Akten von Giacomo Puccini Sein oder Nichtsein 90 ML: Francesco Angelico Komödie von Nick Whitby R: Sláva Daubnerová nach dem Film von Ernst Lubitsch Premiere 25. Sep 2021 R: Christian Weise → Opernhaus Premiere 9. Okt 2021 → Schauspielhaus Die gute Erde (UA) 86 nach dem Roman Der Funke Leben (UA) 92 von Pearl S. Buck nach dem Roman R: Mina Salehpour von Erich Maria Remarque Premiere 25. Sep 2021 R: Lars-Ole Walburg → Schauspielhaus Premiere 22. Okt 2021 → Schauspielhaus FAUST Gretchen 88 Eine theatrale Videoinstallation Cabaret 48 nach Johann Wolfgang von Musical von John Kander, Goethe Joe Masteroff und Fred Ebb R: Bert Zander ML: Peter Schedding Premiere 25. Sep 2021 R: Henriette Hörnigk → TiF – Theater im Fridericianum Premiere 23. Okt 2021 → Opernhaus Schwanensee | Zwanenmeer | UA) 148 A Divine Comedy 94 / 152) אגם הברבורים Tanzdoppelabend von United Tanzperformance Cowboys und Roni Chadash von Florentina Holzinger Premiere 26. Sep 2021 Premiere 29. Okt 2021 → Schauspielhaus → Schauspielhaus Oh yeah, Baby! 246 In einem tiefen, dunklen Wald Ein (mobiles) Discostück Ein Familienstück nach Paul Maar von Leandro Kees für alle ab 6 Jahren 250 für alle ab 2 Jahren R: Cordula Jung Premiere 26. Sep 2021 Premiere: 4. Nov 2021 → TiF Foyer → Opernhaus Tausend4 deutsche Diskotheken Weihnachtsoratorium 50 Krabat 254 Der Kirschgarten 112 (UA) 96 Partizipatives Musiktheater+ mit Ein Jugendstück+ nach Otfried Komödie von Anton Tschechow Eine Serie nach dem Roman Musik von Johann Sebastian Bach Preußler für alle ab 14 Jahren R: Jan Friedrich von Michel Decar ML: Kiril Stankow R: Barbara Frazier Premiere 7. -

Spielzeitheft 2020/21 Herunterladen
IST DAS EIN SPIEL? SPIELZEIT 2021/22 001 Dir ist übel. Was ist das für ein Bett? Ein Plastiktablett im Farbton Als Stadttheater werden wir in den kommenden Spielzeiten alter Fußnägel schwebt neben dir. Die Hände, die es halten, haben die weiter an unserer Öffnung in die Stadtgesellschaft hinein Farbe übernommen. arbeiten, uns weiter vernetzen und vielfältige Formen von »Geschlafen bis nachmittags, mh? Diese Tabletten knallen echt rein, Teilhabe ermöglichen. Der Weg, den wir damit beschrei- kein Zweifel.« ten, mündet in den Gedanken der erweiterten nationalen Der Pfleger hat einen sonderbaren Akzent. Ist er Franzose? und internationalen Zusammenarbeit. Schließlich werden »Als ich vierzehn war, hatte ich selbst mal eine üble Gehirnerschütterung. wir in der Spielzeit 2022 / 23 Gastgeber zweier bedeuten- Seitdem macht mein Finger immer das hier, wenn ich mich anstreng«, sagt der Theaterfestivals sein: Das Festival »Politik im Freien er und strengt sich an und sein Finger schreibt seltsame Kreise in die Luft. LIEBES Theater« und »Theater der Welt«. Gehirnerschütterung, denkst du. Aha. Analog zu dieser Planung möchte ich ein kommendes Pro- »War sogar noch um einiges schlimmer als Ihre«, als hätte er dich gehört, jekt hervorheben, das den programmatischen Titel »SHARE!« »höhere Treppe. Mein Geheimtipp jedenfalls …« trägt. Es entsteht aus den Erfahrungen und Arbeitsbezie- CLOSE Die Hand mit dem Finger hebt die Tellerglocke und – als hätte der Pfleger hungen unseres groß angelegten kulturellen Bildungspro- ein Höllentor aufgestoßen – der Gestank von Krankenhausessen züngelt auf. PUBLIKUM jekts »All Our Futures«. Gerade in Hinblick auf die junge Kartoffeln, Erbsen und ein Stück gequältes Geflügel kullern auf dem Generation hat die Pandemie wie ein Kontrastmittel die Un- Systemgeschirr herum. -

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
ANTAGON THEATERAKTION · AKTIONSTHEATERKASSEL · HESSISCHES LANDESTHEATER MARBURG · HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN · SWOOSH LIEUH · RADIOLIVET- HEATER · SCHAUSPIELHESSISCHE FRANKFURT · STADTTHEATER GIESSEN · STAATSTHEATER DARM- STADT· STAATSTHEATER KASSEL · THEATRIUM STEINAU · ANTAGON THEATERAKTION · AKTIONSTHEATERKASSEL · HESSISCHES LANDESTHEATER MARBURG · HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADENTHEATERTAGE · KORNELIUS EICH · RADIOLIVETHEATER · SCHAUSPIEL FRANKFURT · STADTTHEATER GIESSEN · STAATSTHEATER DARMSTADT · STAATS THEATER KASSEL· H EAT · HESSENKUSS ·THEATERLABOR INC. · TION · AKTIONSTHEATERKASSEL · HESSISCHMARBURG· THEATER SEHEN! · HESSISCHES2021 STAATSTHEATER WIESBADEN · KORNELIUS EICH · SCRIPTEDREALITY · SCHAUSPIEL20.06. – 26.06.FRANKFURT IN MARBURG · STADTTHEATER GIE- SSEN · STAATSTHEATER DARMSTADT · STAATSTHEATER KASSEL· THEATRIUM STEINAU HESSISCHESHESSISCHES LANDESTHEATER LANDESTHEATER MARBURG MARBURG · SCHAUSPIEL · SCHAUSPIEL FRANKFURT FRANKFURT · STAATSTHEATER · STAATSTHEATER DARMSTADT DARMSTADT · STAATSTHEATER · STAATSTHEATER GIESSENGIESSEN · STAATSTHEATER · STAATSTHEATER KASSEL KASSEL · STAATSTHEATER · STAATSTHEATER WIESBADEN WIESBADEN · ANNE · ANNE DECKER DECKER · ANTON · ANTON RUDAKOV RUDAKOV · ASJA · ASJA · BARBARA · BARBARA LUCILUCI CARVALHO CARVALHO · ESTHER · ESTHER STEINBRECHER STEINBRECHER · GAL · GAL FEFFERMANN FEFFERMANN · GLOGOWSKI / HARTUNG / HOESCH / RODRÍGUEZ · GLOGOWSKI / HARTUNG / HOESCH / RODRÍGUEZ · HANNA · HANNA STEINMAIRSTEINMAIR · HANNA · HANNA STEINMAIR, STEINMAIR, MAX MAX BRANDS BRANDS & BASTIAN & BASTIAN -

N PREMIERENVORSCHAUEN
n PREMIERENVORSCHAUEN Theater Aachen Auf dem Paseo del Prado Warten in Godow Musiktheater > mittags Don Klaus Recherchestück Angst essen Seele auf Hagen Iskhalo somlambo / Der Ruf des Wassers Der Zauberer der Smaragdenstadt > Der Ring - Teil 1 > PU UA Extrawurst Werther > Interkontinentale Stückentwicklung Bautzener Bühnenball 2019 Der Zauberer von Oz UA Die Nashörner Das leere Haus > von Anno Schreier __________________________________________ Selfies einer Utopie Pique Dame Tosca Sweeney Todd Musical Theater Baden-Baden 7 Geißlein PU La Calisto Furor Kito und die Tanzfiedel PU Schauspiel Der zerbrochne Krug Nathan der Weise Noch ist Polen nicht verloren Der Fall Hau UA Prěki - Durich - Loborka Das Dschungelbuch > nach dem Roman Eine Nacht in Venedig Lazarus > von Bernd Schroeder Nur ein Tag Die Jungfrau von Orleans Hamlet Mały nykus (Der kleine Wassermann) Die Irre von Chaillot Hochzeit mit Hindernissen Die Wiedervereinigung der beiden Koreas Kammer Der Vorname Arche Nora Nathan // Abraumhalde Simplicius Simplicissimus Holmes und das Biest von Bautzen Furor Jugend ohne Gott __________________________________________ Adams Äpfel Krach in Chiozza Kurze Interviews mit diesen Männern Junges Theater Studiobühne Bayreuth Lokal Europa UA Blauer als sonst Hauptbühne Louis am Strand Peterchens Mondfahrt Der kleine Wassermann mÖrgens > Weihnachtsmärchen Romulus der Große Demut vor deinen Taten Baby > UA von Philipp Löhle Ein seltsames Paar oder Edgar Allan Poes Die Konferenz der Tiere > Zwaa Scheena Buum > unheimliche Geschichten Das Gewächshaus -

Tabela De Área De Especialização
Museu Lasar Segall Biblioteca Jenny Klabin Segall Tabela de Área de Especialização CARNAVAL CINEMA CIRCO DANÇA FOTOGRAFIA OPERA RADIO TEATRO TELEVISAO DOCUMENTAÇAO LASAR SEGALL MUSEU LASAR SEGALL POLITICA CULTURAL 1 Museu Lasar Segall Biblioteca Jenny Klabin Segall Tabela de Forma Atualizada em Dezembro de 2006 AFORISMA AGENDA ALBUM ALBUM DE FIGURINHAS ALMANAQUE ANUARIO ARGUMENTO BIBLIOGRAFIA SN Usado para designar o conjunto de obras documentais que dizem respeito às diversas manifestações artísticas. BIOGRAFIA CALENDÁRIO CATALOGO CD-ROM CITAÇAO COLETANEA COMENTARIO CORRESPONDENCIA CRITICA CRONOLOGIA SN Exposição ano a ano de fatos relativos a um tema. CURRICULO DEBATE DEPOIMENTO DIARIO DICIONARIO DIRETORIO DISCOGRAFIA DOSSIE DRAMATURGIA Museu Lasar Segall Biblioteca Jenny Klabin Segall SN Relação e descrição das peças teatrais de um autor, de um país, de uma região geográfica ou de uma época, durante um intervalo de tempo. ENCICLOPEDIA ENSAIO ENTREVISTA ESCRITOS ESTATISTICA ESTATUTO ESTUDO FICHA TECNICA FILMOGRAFIA SN Relação e descrição dos filmes de um cineasta, de um país, de uma região geográfica ou de um tema, durante um largo intervalo de tempo. (Ortiz, Carlos) FILMOGRAFIA EM VIDEO SN Relação e descrição dos filmes de um cineasta, de um país, de uma região geográfica ou de um tema, que foram transferidos de seu suporte original para o suporte magnético de vídeo. FOTOBIOGRAFIA GLOSSARIO GUIA HISTORIA SN Estudo das origens e processos de uma arte ou de um ramo do conhecimento. HISTORICO SN Estudo sintético da origem, da natureza e do desenvolvimento de um tema, grupo, companhia ou espaço de apresentação. HOMENAGEM ICONOGRAFIA INDICE INVENTARIO LITERATURA SN Usado para obras catalogadas em CL (Cinema-literatura), TL (Teatro-literatura) ou TVL (Televisão-literatura); inclui romance, novela, diário, etc. -

Radikal Sozial
dramaturgie Zeitschrift der Dramaturgischen Gesellschaft RADIKAL SOZIAL Wahrnehmung und Beschreibung von Realität im Theater Symposion der Dramaturgischen Gesellschaft 20. bis 22. Januar 2006 in Berlin im Haus der Berliner Festspiele dg 2/2005 Radikal sozial. Wahrnehmung und Beschreibung von Realität im Theater Symposion der Dramaturgischen Gesellschaft vom 20 – 22.Januar 06 im Haus der Berliner Festspiele in Zusammenarbeit mit den Berliner Festspielen und dem Sonderforschungsbereich der Freien Universität Berlin „Kulturen des Performativen“ Freitag 20.01.06 14:00 – 15:45 | Rangfoyer Begrüßung durch Manfred Beilharz, Intendant Hessisches Staatstheater Wiesbaden und Vorsitzender der Dramaturgischen Gesell- schaft, Joachim Sartorius, Intendant der Berli- ner Festspiele und Markus Luchsinger, künstle- rischer Leiter von spielzeiteuropa Eröffnungsvortrag von Dirk Baecker, Professor für Soziologie an der Universität Wit- ten/Herdecke [S.09] Vorstellung der Themenschwerpunkte der Tagung durch den Vorstand 16:00 – 17:30 | Rangfoyer 16:00 – 17:30 | Probebühne 16:00 – 17:30 | Große Bühne Sehnsucht nach Intervention Dramaturgie jenseits von Dramatik Schwarzmarkt für nützliches Sabrina Zwach, Kuratorin des 6. Festivals Politik Werkstattgespräch mit Christiane Kühl, Journa- Wissen und Nicht-Wissen. im Freien Theater Berlin 2005 und KünstlerIn- listin und Dramaturgin, Matthias von Hartz, Re- Die halluzinierte Volkshochschule der Mobilen nen der Sparte „Interventionen“ des Festivals gisseur und Kurator, Carena Schlewitt, Kurato- Akademie. Workshop mit