1. Forschungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

OPENING PANDORA's BOX David Cameron's Referendum Gamble On
OPENING PANDORA’S BOX David Cameron’s Referendum Gamble on EU Membership Credit: The Economist. By Christina Hull Yale University Department of Political Science Adviser: Jolyon Howorth April 21, 2014 Abstract This essay examines the driving factors behind UK Prime Minister David Cameron’s decision to call a referendum if the Conservative Party is re-elected in 2015. It addresses the persistence of Euroskepticism in the United Kingdom and the tendency of Euroskeptics to generate intra-party conflict that often has dire consequences for Prime Ministers. Through an analysis of the relative impact of political strategy, the power of the media, and British public opinion, the essay argues that addressing party management and electoral concerns has been the primary influence on David Cameron’s decision and contends that Cameron has unwittingly unleashed a Pandora’s box that could pave the way for a British exit from the European Union. Acknowledgments First, I would like to thank the Bates Summer Research Fellowship, without which I would not have had the opportunity to complete my research in London. To Professor Peter Swenson and the members of The Senior Colloquium, Gabe Botelho, Josh Kalla, Gabe Levine, Mary Shi, and Joel Sircus, who provided excellent advice and criticism. To Professor David Cameron, without whom I never would have discovered my interest in European politics. To David Fayngor, who flew halfway across the world to keep me company during my summer research. To my mom for her unwavering support and my dad for his careful proofreading. And finally, to my adviser Professor Jolyon Howorth, who worked with me on this project for over a year and a half. -

Zuschauen Oder Einmischen?
ZUSCHAUEN ODER DEUTSCHLAND EINMISCHEN? Aus der Krise lernen 4 POTENTIALE DES ALTERS NUTZEN! SCHWERPUNKT Arbeitsbereich der FES zum Einbinden bürgerschaftlichen Engagement statt abschieben 21 älterer Menschen INTERNATIONAL Europa aus dem Gleichgewicht 28 2/2010 TITELTHEMA Eigener Arbeitsbereich der FES Bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen stärken BÜRG E R S C haftli C hes E N G A G ement und gesellschaftspolitische Partizipation sind zentrale Themen in der Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, die auf ganz unterschied- liche Weise bearbeitet werden. Eine besondere Form der Auseinandersetzung mit diesem Themenkomplex ist der Arbeitsbereich „Bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen stärken“. In Deutschland ist der demo- einsamung von älteren Men- rungswissen oft nicht in erfolg- graphische Wandel in vollem schen begegnet werden? Wel- reiche Aktivitäten umgesetzt Gang. Im Jahr 2050 wird jede/r che Rollen können und wollen werden. dritte Deutsche 60 Jahre oder ältere Menschen in einer sich Die Friedrich-Ebert-Stiftung älter sein, jede/r neunte sogar ändernden Gesellschaft einneh- möchte diesen Trend unterstüt- 80 Jahre oder älter. men? zen und das bürgerschaftliche Ein posi- Engagement älterer Menschen tiver As- weiter stärken. Ein Projektziel pekt des ist es, die ältere Generation demogra- darin zu unterstützen, ihr Er- phischen fahrungswissen, ihre Potenziale Wandels und Ressourcen noch stärker ist: Ältere für die Gestaltung und für den Menschen Zusammenhalt unserer Gesell- sind heute schaft einzubringen. im Durch- Ein Schwerpunkt des Projektes schnitt ist die politische Mitwirkung gesünder von Senioren und Seniorinnen. und besser Schließlich soll durch bürger- ausgebil- schaftliches Engagement nicht det als in der Sozialstaat ersetzt wer- der Ver- den, sondern die gesellschaft- Im Zuge dieser Veränderungen gangenheit. -

First Draft Proposal
Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament S&D A Union of Democracy: A Progressive Vision for the Future of Europe Friday 6 December 2013, 9:30 – 18:00 Tempio di Adriano - Piazza di Pietra, Rome Working languages EN/IT Friday 6 December: 09:30 - 10:00 Opening Remarks by Hannes SWOBODA, President of the Socialists and Democrats Group in the European Parliament, and Roberto GUALTIERI, Member of the European Parliament and S&D Co-ordinator for the Committee for Constitutional Affairs 10:00 - 11:30 Session I State of Democracy in Europe and its Challenges Chair: Jo LEINEN, MEP European Issues in National Agendas ∙ Institutional Challenges ∙ Citizens Participation ∙ European Political Parties ∙ Growing Extremism and Populism ∙ New Rights for Citizens ∙ Accession to the ECHR ∙ The Role of the Chart of Fundamental Rights Panel: Luciano BARDI, Professor, European University Institute ● Luigi BERLINGUER, MEP ● Vannino CHITI, Member of the Italian Senate - President of the European Affairs Committee ● Virgilio DASTOLI, President of European Movement Italy ● Emilio De CAPITANI, Secretary of The Fundamental Rights European Experts Group (FREE Group) ● Sandro GOZI, Vice-President of the Assembly of Council of Europe ● Enrique GUERRERO SALOM, MEP ● Zita GURMAI, MEP ● Elena PACIOTTI, President of Fondazione Basso ● Yonnec POLET, Deputy Secretary General of the Party of European Socialists 11:30 - 12:30 Debate 12:30 - 14:00 Buffet Lunch 14:00 - 15:30 Session II Developing Democratic Governance Chair: Paolo -

The Similarities and the Differences in the Functioning of the European Right Wing: an Attempt to Integrate the European Conservatives and Christian Democrats
Journal of Social Welfare and Human Rights, Vol. 1 No. 2, December 2013 1 The Similarities and the Differences in the Functioning of the European Right Wing: An Attempt to Integrate the European Conservatives and Christian Democrats Dr. Kire Sarlamanov1 Dr. Aleksandar Jovanoski2 Abstract The text reviews the attempt of the European Conservative and Christian Democratic Parties to construct a common platform within which they could more effectively defend and develop the interests of the political right wing in the European Parliament. The text follows the chronological line of development of events, emphasizing the doctrinal and the national differences as a reason for the relative failure in the process of unification of the European right wing. The subcontext of the argumentation protrudes the ideological, the national as well as the religious-doctrinal interests of some of the more important Christian Democratic, that is, conservative parties in Europe, which emerged as an obstacle of the unification. One of the more important problems that enabled the quality and complete unification of the European conservatives and Christian Democrats is the attitude in regard to the formation of EU as a federation of countries. The weight down of the British conservatives on the side of the national sovereignty and integrity against the Pan-European idea for united European countries formed on federal basis, is considered as the most important impact on the unification of the parties from the right ideological spectrum on European land. Key words: Conservative Party, Christian Democratic Party, CDU European Union, European People’s Party. 1. Introduction On European land, the trend of connection of political parties on the basis of ideology has been notable for a long time. -

Festschrift Zum 70-Jahr-Jubiläum
der ingenieur der ingenieur. www.voi.atwww.voi.at . [email protected]@voi.at ZEITSCHRIFT DES VERBANDES ÖSTERREICHISCHER INGENIEURE Festausgabe 70 Jahre VÖI Ehrenschutz und Vorworte Seite 5 Geschichte und Aufgaben des Verbandes Seite 28 Übersicht über die Ausbildung in Österreich Seite 38 Haus der Ingenieure Seite 39 Zukunft des Inge- nieurwesens Seite 76 2 70 JAHRE VÖI · FESTSCHRIFT Festausgabe anlässlich der 70 Jahr-Feier des VÖI VERBAND ÖSTERREICHISCHER INGENIEURE FESTSCHRIFT · 70 JAHRE VÖI 3 4 70 JAHRE VÖI · FESTSCHRIFT Den Ehrenschutz über diese Veranstaltung hat freundlicherweise der Herr Bundespräsident Dr. Heinz Fischer übernommen. FESTSCHRIFT · 70 JAHRE VÖI 5 6 70 JAHRE VÖI · FESTSCHRIFT Die Präsidentin des Nationalrates der Republik Österreich sehr geehrte Ingenieurinnen und Ingenieure! seit nunmehr 70 Jahren hält der Verband Österreichischer Ingenieure die Interessen Ihres berufsstandes hoch. seit damals durchlief das berufsrecht der Ingenieure viele neuregelungen und anpassungen im nationalrat. dabei haben sich Vertreterinnen und Vertreter des Verbandes Österreichi- scher Ingenieure von beginn an engagiert eingebracht – so zum beispiel im Rahmen des nationalen Qualifikationsrahmens. Für seine weitere arbeit wünsche ich dem Verband Österreichischer Ingenieure viel erfolg und gratuliere den Funktionärinnen und Funktionären zum „Runden“. Ich hoffe, sie mögen sich Ihre einsatzbereitschaft in der sache und Ihr engagement im sinne der Menschen, die sie vertreten, für die Zukunft bewahren. alles gute, doris bures © Parlamentsdirektion -
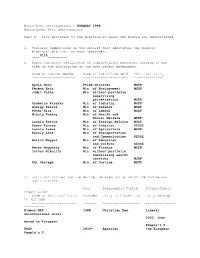
HUNGARY 1998 Macro-Level Data Questionnaire Part I: Data Pertinent
Macro-Data Questionnaire - HUNGARY 1998 Macro-Level Data Questionnaire Part I: Data Pertinent to the Election at which the Module was Administered 1. Variable number/name in the dataset that identifies the primary electoral district for each respondent. ____V114__________ 2. Names and party affiliation of cabinet-level ministers serving at the time of the dissolution of the most recent government. Name of Cabinet Member Name of the Office Held Political Party ---------------------- ----------------------- --------------- Gyula Horn Prime Minister MSZP Ferenc Baja Min. of Environment MSZP Judit Csiha Min. without portfolio supervising privatization MSZP Szabolcs Fazakas Min. of Industry MSZP Gyorgy Keleti Min. of Defence MSZP Peter Kiss Min. of Labour MSZP Mihaly Kokeny Min. of Health and Social Welfare MSZP Laszlo Kovacs Min. of Foreign Affairs MSZP Gabor Kuncze Min. of Interior SZDSZ Laszlo Lakos Min. of Agriculture MSZP Karoly Lotz Min. of Transportation and Communication SZDSZ Balint Magyar Min. of Education and Culture SZDSZ Peter Megyessy Min. of Finance MSZP Istvan Nikolits Min. without portfolio supervising secret services MSZP Pal Vastagh Min. of Justice MSZP 3. Political Parties (active during the election at which the module was administered). Year Ideological Family International Organization Name of Political Party Founded Party is Closest to Party Belongs to (if any) ----------------------- ------- ------------------- ---------------- ---------- Fidesz-MPP 1988 Christian Dem. Liberal International until 2000, then moved to European People's P. FKGP 1930* Agrarian the European People's P. suspended the FKGP's membership in 1992 KDNP 1988 Christian Dem. The European People's P. suspended the KDNP's membership in 1997 MDF 1988 Christian Dem. European People's P. -

Ess4 - 2008 Documentation Report
ESS4 - 2008 DOCUMENTATION REPORT THE ESS DATA ARCHIVE Edition 5.5 Version Notes, ESS4 - 2008 Documentation Report ESS4 edition 5.5 (published 01.12.18): Applies to datafile ESS4 edition 4.5. Changes from edition 5.4: Czechia: Country name changed from Czech Republic to Czechia in accordance with change in ISO 3166 standard. 25 Version notes. Information updated for ESS4 ed. 4.5 data. 26 Completeness of collection stored. Information updated for ESS4 ed. 4.5 data. Israel: 46 Deviations amended. Deviation in F1-F4 (HHMMB, GNDR-GNDRN, YRBRN-YRBRNN, RSHIP2-RSHIPN) added. Appendix: Appendix A3 Variables and Questions and Appendix A4 Variable lists have been replaced with Appendix A3 Codebook. ESS4 edition 5.4 (published 01.12.16): Applies to datafile ESS4 edition 4.4. Changes from edition 5.3: 25 Version notes. Information updated for ESS4 ed.4.4 data. 26 Completeness of collection stored. Information updated for ESS4 ed.4.4 data. Slovenia: 46 Deviations. Amended. Deviation in B15 (WRKORG) added. Appendix: A2 Classifications and Coding standards amended for EISCED. A3 Variables and Questions amended for EISCED, WRKORG. Documents: Education Upgrade ESS1-4 amended for EISCED. ESS4 edition 5.3 (published 26.11.14): Applies to datafile ESS4 edition 4.3 Changes from edition 5.2: All links to the ESS Website have been updated. 21 Weighting: Information regarding post-stratification weights updated. 25 Version notes: Information updated for ESS4 ed.4.3 data. 26 Completeness of collection stored. Information updated for ESS4 ed.4.3 data. Lithuania: ESS4 - 2008 Documentation Report Edition 5.5 2 46 Deviations. -

Ecfr.Eu We Are Living Through a Global Counter-Revolution
ecfr.eu We are living through a global counter-revolution. The institutions and values of liberal internationalism are being eroded beneath our feet and societies are becoming increasingly polarised. The consensus for EU action is increasingly difficult to forge, but there is a way forward. In this new world, the European Council on Foreign Relations will take a bottom-up approach to building grassroots consensus for greater cooperation on European foreign and security policy. Our vision is to demonstrate that engaging in common European action remains the most effective way of protecting European citizens. But we will reach out beyond those already converted to our message, framing our ideas and calls for action in a way that resonates with key decision-makers and the wider public across Europe’s capitals. Mark Leonard, Director “ 9 November is one of these portentous dates which characterised German and European history. I feel you couldn’t have chosen a better day on which to launch the new European Council on Foreign Relations here in Berlin.” Frank-Walter Steinmeier (2007) President of the Federal Republic of Germany and former Federal Minister for Foreign Affairs ecfr.eu OUR LEADERSHIP The European Council on Foreign Mark Leonard Relations (ECFR) is an award-winning think-tank that aims to conduct Director cutting-edge independent research in pursuit of a coherent, effective, Mark is the Director and co-founder of ECFR. He was and values-based European foreign chairman of the World Economic Forum’s Global Agenda policy. Council on Geoeconomics until 2016, director of foreign policy at the Centre for European Reform, and director of We provide an exclusive meeting the Foreign Policy Centre. -
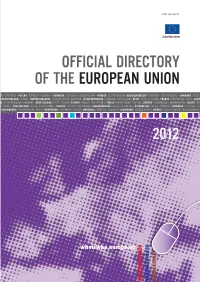
Official Directory of the European Union
ISSN 1831-6271 Regularly updated electronic version FY-WW-12-001-EN-C in 23 languages whoiswho.europa.eu EUROPEAN UNION EUROPEAN UNION Online services offered by the Publications Office eur-lex.europa.eu • EU law bookshop.europa.eu • EU publications OFFICIAL DIRECTORY ted.europa.eu • Public procurement 2012 cordis.europa.eu • Research and development EN OF THE EUROPEAN UNION BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑ∆Α • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND • ÖSTERREICH • POLSKA • PORTUGAL • ROMÂNIA • SLOVENIJA • SLOVENSKO • SUOMI/FINLAND • SVERIGE • UNITED KINGDOM • BELGIQUE/BELGIË • БЪЛГАРИЯ • ČESKÁ REPUBLIKA • DANMARK • DEUTSCHLAND • EESTI • ΕΛΛΑΔΑ • ESPAÑA • FRANCE • ÉIRE/IRELAND • ITALIA • ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS • LATVIJA • LIETUVA • LUXEMBOURG • MAGYARORSZÁG • MALTA • NEDERLAND -

Österreich Im 20. Jahrhundert – Im Prisma Eines Politischen Lebens
Anton Pelinka Österreich im 20. Jahrhundert – im Prisma eines politischen Lebens Karl Waldbrunner als Repräsentant seiner Zeit Vorbemerkung: Dieser Aufsatz stützt sich, was seine biographischen Aspekte be- trifft, auf die in diesem Buch veröffentlichte Arbeit „Karl Waldbrunner: Schnitt- stellen eines Lebens zwischen Industrie und Politik“ von Manfred Zollinger. Die biographischen Hinweise folgen Zollingers umfassender Darstellung. Karl Waldbrunner war österreichischer Sozialdemokrat. Als Arbeiterkind wurde er nach seinem Studium Repräsentant der „technischen Intelligenz“ der Partei. Ab 1945 prägte er – als Zentralsekretär und als Bundesminister – die SPÖ, die Bun- desregierung und damit auch die Nachkriegszeit. Er steht, neben anderen, für den sozialdemokratischen Anteil an dem, was als Erfolgsgeschichte der Zweiten Repu- blik gilt. Sein Leben und seine Politik reflektieren das Auf und Ab, das Österreich im 20. Jahrhundert durchzumachen hatte. Karl Waldbrunners politische Karriere war in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Viele Aspekte seiner Laufbahn wichen von den herrschenden Mustern ab. Er war Angehöriger der „technischen Intelligenz“, Akademiker. In 1. seiner Generation, die ihre entscheidende Prägung in der Ersten Republik erhielt, waren Personen mit diesem Hintergrund nur selten Sozialisten – wenn nicht der deutschnationale und der christlichsoziale Antisemitismus sie, ihrer jüdischen Herkunft wegen, zu Sozialisten machte. Waldbrunner repräsentierte die kleine Minderheit der nicht- jüdischen sozialistischen Intelligenz. Wer war, wer wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts in Österreich Sozialdemokrat, Sozialdemokratin? Die große Mehrheit der Arbeiterschaft identifizierte sich mit dem sozialistischen Lager. Für das Proletariat waren die Sozialdemokratische Ar- beiterpartei und die Freien Gewerkschaften – Victor Adlers „siamesische Zwillinge“ – so etwas wie eine Heimat. Man wählte die Partei – und war auch in vielen Fäl- len deren Mitglied. Und man sah in den sozialdemokratischen Richtungsgewerk- schaften, den „Freien“, den bestmöglichen Schutz am Arbeitsplatz. -

«Poor Family Name», «Rich First Name»
ENCIU Ioan (S&D / RO) Manager, Administrative Sciences Graduate, Faculty of Hydrotechnics, Institute of Construction, Bucharest (1976); Graduate, Faculty of Management, Academy of Economic Studies, Bucharest (2003). Head of section, assistant head of brigade, SOCED, Bucharest (1976-1990); Executive Director, SC ACRO SRL, Bucharest (1990-1992); Executive Director, SC METACC SRL, Bucharest (1992-1996); Director of Production, SC CASTOR SRL, Bucharest (1996-1997); Assistant Director-General, SC ACRO SRL, Bucharest (1997-2000); Consultant, SC GKS Special Advertising SRL (2004-2008); Consultant, SC Monolit Lake Residence SRL (2008-2009). Vice-President, Bucharest branch, Romanian Party of Social Solidarity (PSSR) (1992-1994); Member of National Council, Bucharest branch Council and Sector 1 Executive, Social Democratic Party of Romania (PSDR) (1994-2000); Member of National Council, Bucharest branch Council and Bucharest branch Executive and Vice-President, Bucharest branch, Social Democratic Party (PSD) (2000-present). Local councillor, Sector 1, Bucharest (1996-2000); Councillor, Bucharest Municipal Council (2000-2001); Deputy Mayor of Bucharest (2000-2004); Councillor, Bucharest Municipal Council (2004-2007). ABELA BALDACCHINO Claudette (S&D / MT) Journalist Diploma in Social Studies (Women and Development) (1999); BA (Hons) in Social Administration (2005). Public Service Employee (1992-1996); Senior Journalist, Newscaster, presenter and producer for Television, Radio and newspaper' (1995-2011); Principal (Public Service), currently on long -

Draft List of Invittees
FORUM ON NEW SECURITY ISSUES: “SHARED INTERESTS & VALUES BETWEEN SOUTHEASTERN EUROPE & THE TRANSATLANTIC COMMUNITY" (FONSI) WORKSHOP V: KOSOVO: SEEKING A SUSTAINABLE STATUS A workshop organised by The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP) with the support of The German Marshall Fund of the US (GMFUS) and the NATO's Public Diplomacy Division Thessaloniki, 4-6 March 2005 List of Participants AFENTOULI Ino (Ms.), Information Officer, NATO Public Diplomacy Division, Brussels e-mail: [email protected] Despina-Ino Afentouli works as Information Officer at NATO’s Public Diplomacy Division. In this capacity she is in charge of information activities in Greece and regional coordinator for the Caucasus. In addition, she is responsible of the Academic Affairs Program, sponsored by PDD. She studied Law at the Athens University and earned a MA in Political Communication at Paris-I (Sorbonne). Before joining NATO she worked for fifteen years as a journalist specialising in Foreign Policy and European Affairs. She was Diplomatic Editor at the Athens News Agency, responsible for the Greek edition of the Economist Intelligence Unit and political correspondent at KATHIMERINI daily. As Secretary General of the European Network of Women Journalists has participated in many activities aiming at the rapprochement of media professionals in Southeastern Europe. She was also very active in Greek-Turkish rapprochement initiatives. For her work related with European Affairs she received the Calligas Award of the European Association of Journalists (Nov. 2000). ANTONATOS Panayotis (Mr.), Desk Officer for Kosovo, A3 Directorate, Ministry of Foreign Affairs, Athens e-mail: [email protected] Born on the 15th of December, 1973 in Athens.