Die Kirche St. Martin in Busskirch – Jona
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Eschenbacher Neujahrsblatt 11 Gekennzeichnete Kunst Bevor- Ben
ESCHENBACHER 11 NEUJAHRSBLATT Pfarrkirche, Kapellen und weitere Zeugen barocker Frömmigkeit Ein kostbares Erbe In dieser Ausgabe: Seite Barock als Ausdruck neuer Frömmigkeit 1 Christianisierung des Linthgebiets 2 Baugeschichte der Pfarrkirche 2 Haggenberg-Altar 6 St. Vinzentius-Reliquie 7 Geschichte der Kirchenorgel 8 Geläute 8 Selbständige Pfarrei seit 1537 11 St. Jakobuskapelle Neuhaus 12 Furrer-Chappeli 14 Kapelle zur Hl. Familie Bürg 15 Kapelle „Maria Königin” Ermenswil 16 Feld- und Wegkreuze 18 Schlussgedanken 20 Schlusspunkt 20 erstem grossen Höhepunkt über. Der Spätbarock gilt als zweiter Höhepunkt und stand am Ende des 18. Jahrhunderts. Es folgten das Rokoko und dann der Klas- sizismus. sowohl in profanen, insbesonde- BAROCK ALS AUSDRUCK re aber in sakralen Bauten bis in Nach der Reformation im 16. NEUER FRÖMMIGKEIT die heutige Zeit. Wegen seiner Jahrhundert verfolgten Katho- pompösen Kunst etwas von den liken und Protestanten unter- Die Epoche des Barocks erlebte üblichen Normen abweichend, schiedliche Interessen, was auch im 17. und 18. Jahrhundert ihre fand er später als eigenständige in der Baukunst ihrer Kirchen zum Blütezeit. „Barock”, aus der por- Epoche Anerkennung. Man unter- Ausdruck kam. Die Protestanten tugiesischen Sprache stammend, scheidet zwischen Früh-, Hoch- pflegten ein einfaches, gradli- heisst wörtlich übersetzt „unre- und Spätbarock. Der Frühbarock niges Erscheinungsbild, derweil gelmässig und schief”. Diese entsprang aus der Renaissance die Katholiken eine durch pom- Kunstform hinterliess ihre Spuren und ging in den Hochbarock als pöse und verzierte Gebäude Eschenbacher Neujahrsblatt 11 gekennzeichnete Kunst bevor- ben. Mit dem Einfall der Aleman- (830), Busskirch (840), Uznach zugten. Die barocke Frömmigkeit nen um 450 herum wurde zwar (856) und Eschenbach (885). -

Seeuferplanung Zürich- Obersee 1997
KANTON ST. GALLENBAUDEPARTEMENT / PLANUNGSAMT SEEUFERPLANUNG Zürich-/Obersee Vernehmlassung 1995 Revision und Ergänzung 1997 OePlan/ Büro für Datum: 25.03.97 Landschaftspflege o Wegenstr. 5 Tel. Nr. : 071 / 722 57 22 9436 Balgach Fax. Nr.: 071 / 722 57 32 Thomas Oesch, dipl. Kulturing. ETH/SIA Peter Laager, dipl.phil.II, Geograf ý Spinnereistr. 29 Tel. Nr. : 055 / 210 29 02 Rolf Stieger, Landschaftsarchitekt HTL 8640 Rapperswil Fax. Nr.: 055 / 210 29 02 Seeuferplanung Zürich-/Obersee Kt. St. Gallen Seite 1 INHALTSVERZEICHNISSEITE 1 AUSGANGSLAGE4 2 ALLGEMEINE ZIELSETZUNG5 3 GRUNDLAGEN ZUM THEMA SEEUFER5 3.1 Begriffe5 3.2 Leben in der Uferzone6 3.3 Funktion der Flachwasserzone6 3.3.1 Allgemeines6 3.3.2 Besondere Lebensraumtypen6 3.4 Wichtige Gesetzesgrundlagen7 3.5 Raumplanerische Grundlagen8 4 VORGEHEN9 4.1 Ergänzung der Bestandesaufnahme9 4.2 Seeuferbewertung9 4.3 Vorrangfunktionen9 4.4 Koordination der see- und der landseitigen Planung9 4.4.1 Bearbeitung9 4.4.2 Abgrenzung10 5 BESTANDESAUFNAHME10 5.1 Natur und Landschaft10 5.1.1 Wasserstand10 5.1.2 Angaben zur Wasserchemie10 5.1.3 Angaben zu den Wasserpflanzen11 5.1.4 Beschaffenheit der Uferlinien13 5.1.5 Typisierung der landseitigen Lebensräume14 5.1.6 Angaben zur Vogelwelt16 5.1.7 Angaben zur Fischfauna17 5.1.8 Angaben zu den Amphibien17 5.1.9 Geotope18 5.2 Erholung18 5.2.1 Zugänglichkeit18 5.2.2 Intensität18 5.2.3 Erholungsdruck19 5.2.4 Privatschiffahrt auf Zürich- und Obersee19 Seeuferplanung Zürich-Obersee 1997/25.03.97/ OePlan Seeuferplanung Zürich-/Obersee Kt. St. Gallen Seite 2 -

Die Südostschweiz, Gaster/See, 17.1.2013
www.suedostschweiz.ch ausgabe gasteR und see donneRSTAG, 17. JAnuAR 2013 | nR. 15 | AZ 8730 uZnAch | chF 3.00 AnZeiGe ReDakTiOn: ReGion ReGion SpoRT ReGion Zürcherstrasse 45, 8730 uznach Bestellen Sie Ihre Tel. 055 285 91 00, Fax 055 285 91 11 Die aufenthaltsdauer Die Gemeinde benken Zwei Lokalrivalen im Aboplus-Mehrwertkarte ReichWeiTe: bei: Südostschweiz 121 187 exemplare, 240 000 Leser Presse und Print AG von Patienten im nimmt 2012 mehr inlinehockey kämpfen Abo- und Zustellservice abO- unD ZuSTeLLSeRvice: Zürcherstrasse 45 0844 226 226, [email protected] CH-8730 Uznach inSeRaTe: Spital Linth ist weiter Steuern ein als um den einzug in den Tel. 0844 226 226 Zürcherstrasse 45, 8730 uznach, www.suedostschweiz.ch Tel. 055 285 91 04, [email protected] rückläufig. SeiTe 5 budgetiert. SeiTe 6 Wintercup-Final. SeiTe 13 Für den TSV Jona folgt nun die Kür Wirtschaftliche Trendwende Rapperswil-Jona. –Überraschend souverän haben sich die NLB-Vol- leyballer aus Jona in die Finalrunde gespielt. Der Aufsteiger glänzte in der Qualifikation mit starken Auf- tritten und neun Siegen –jetzt folgt ist in der Region in Sichtweite für das TSV-Team das Kräftemes- sen mit den besten sieben NLB- Das Wirtschaftswachstum in portrückgang gelitten. Die in der Regi- «Gemäss unserer Einschätzung deutet Appenzell. Die Heterogenität des Kan- Mannschaften. Warum die Joner der Ostschweiz erlebte in den on breit vertretene Exportindustrie die Nachfrageentwicklung im Ausland tons St. Gallen sei für das Linthgebiet aber mit gedämpften Erwartungen letzten Jahren eine Achterbahn- kämpfte mit einer Überschuldung im darauf hin, dass die Trendwende ge- eine Gefahr, kommen die Autoren der zur Finalrunde antreten und nicht fahrt. -

Media Alert the First in Swiss Ice Hockey: Sc Rapperswil-Jona Lakers Starts the New Season with Kinexon
MEDIA ALERT THE FIRST IN SWISS ICE HOCKEY: SC RAPPERSWIL-JONA LAKERS STARTS THE NEW SEASON WITH KINEXON Munich, October 13, 2020 – With the SC Rapperswil-Jona Lakers, the Swiss professional ice hockey league now uses real-time analysis technology from KINEXON. The club hopes that the digitalization measure will be an important step to reach the next level of performance. Ice hockey is an increasing part of the KINEXON portfolio. Teams in the NHL, such as the New Jersey Devils, New York Rangers, Pittsburgh Penguins, as well as the German Ice Hockey Federation all track player performance in real time using centimeter-accurate ultra-wideband technology. Now, that same technology will be used in St. Galler Kantonalbank Arena starting in the 2020-2021 season. Using small sensors integrated in the players’ equipment and anchors throughout the arena, KINEXON can collect hundreds of precise performance metrics even during the toughest checks and process them in real-time into previously inaccessible data-based insights. Development That Improves Fan Experience and Offers the Sponsor Real Added Value in Brand Communication "With the help of live data, we want to develop the players in the sporting field. We receive very precise information about movement sequences, energy metabolism and other performance data, which we can evaluate exactly. We also want to improve the live experience in the arena. The fans receive selected live data during the game directly published on our state-of-the-art video cube. Now they can see, for example, the number of sprints a player makes, or the exact number of minutes played (time-on-ice). -

Naturwaldreservat Weid
Naturwaldreservat Weid Förderung der Biodiversität durch natürliche Waldentwicklung Ausgewählte Zielarten des Waldreservates Verhaltensregeln im Waldreservat Ziel des Waldreservates Zunderschwamm Keine Bäume und Sträucher In diesem Wald können die Bäume sehr alt werden, und sie sterben natürlicherweise ab, wie in einem Urwald. (Fomes fomentarius) absägen oder beschädigen Der Zunderschwamm besiedelt geschwächte Der bis zu 30 cm grosse, mehr- Dadurch entstehen Lebensräume und Nahrungsgrundlagen für Tier-, Pflanzen- und Pilzarten der verschiedenen Laubbäume, vor allem Buchen, selten auch jährige, robuste Fruchtkörper Keine Pflanzen pflücken Stadien der Zerfallsphase eines Waldes. Charakteristisch für einen solchen naturnahen Wald sind viel Totholz Nadelbäume. Er zersetzt das Holz und führt streut Millionen mikroskopisch die mineralisierten Stoffe wieder dem Wald- kleiner Sporen aus, welche über und die zahlreichen davon lebenden Organismen. boden zu. Deshalb ist er für den Stoffkreislauf Wunden am Baum in das Holz Tiere nicht stören in Buchenwäldern von zentraler Bedeutung. eindringen. Der faserige Kern Im bewirtschafteten Wald ist er wesentlich wurde früher als Zunder zum am Abbau nicht verwertbarer Restholzsorti- Feuer entfachen verwendet und Keine Abfälle liegen lassen So wird sich der Wald im Reservat entwickeln mente beteiligt. sogar zu Kleidern verarbeitet. Reservatsperimeter Kein Feuer entfachen • Durch Alterung, Windwurf, Schneedruck, Baumkrankheiten, Gemeindegrenze kleinflächigen Borkenkäfer befall und Konkurrenz um Licht sterben Bäume ab. So bildet sich das angestrebte, stehende Keinen Lärm verursachen und liegende Totholz. In den entstandenen Lücken wachsen Abseits des Wanderweges junge Bäume auf, womit sich der Generationen zyklus 18-45 mm 14-35 mm 8-12 mm nicht Velo fahren schliesst. Nicht campieren • Einige Bäume werden sehr alt, hoch und dick und entwickeln sich zu Biotopbäumen mit sogenannten Mikrohabitaten wie Keine Sportanlässe durchführen Höhlen, Rissen oder toten Ästen. -

Rapperswil-Jona Masterplan Siedlung Und Landschaft
Rapperswil-Jona Masterplan Siedlung und Landschaft Teil 2 – Bericht Konzept 30. Juni 2006 Der vorliegende Bericht wurde der Behördenkonferenz am 17.10.2005 vorgestellt und zur Kenntnis genommen. Die IG RUV hat den Masterplan Siedlung und Landschaft am 09.11.2005 zur Mitwirkung freigegeben. Die Mitwirkung hat mit Beginn an der öffentlichen Vorstellung vom 11.01.2006 bis Ende März stattgefunden. Die eingegangenen Hinweise und Anregungen sind in diesem Bericht eingearbeitet. Die Behördenkonferenz Rappers- wil-Jona hat den Masterplan am 26. Juni 2006 verabschiedet. Arbeitsgruppe RUV Walter Domeisen Stadtpräsident Rapperswil, Co-Leitung Benedikt Würth Gemeindepräsident Jona, Co-Leitung Urs Böhler Gemeinderat Jona Martin Klöti Stadtrat Rapperswil Reto Klotz Leiter Ressort Bau, Rapperswil Armin Schmucki Stadtrat Rapperswil Stefan Ritz Gemeinderat Jona Josef Thoma Gemeinderatsschreiber Jona Patrick Ruggli Ernst Basler + Partner AG Hans-Ueli Hohl ARE Kanton St. Gallen Interessengemeinschaft RUV Meinungsbildungsgremium mit Vertretung aller angesprochenen Interessengruppen, Parteien und Quartiervertretungen mit 50 Personen Bearbeitung Teil Siedlung Metron Raumentwicklung AG: Beat Suter, Peter Wolf, Nicole Wirz, Christian Höchli Teil Landschaft Metron Landschaft AG: Brigitte Nyffenegger, Jürg Oes, Beat Wyler Metron AG T 056 460 91 11 Postfach 480 9999F 056 460 91 00 Stahlrain 2 [email protected] CH 5201 Brugg www.metron.ch F:\DATEN\M4\41-317B\04_BER\BER01_KONZ_V11.DOC Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen 3 1.1 Auftrag 3 1.2 Übersicht Masterplan Siedlung -

Neuer Steg in Rapperswil Ersetzt Halt in Busskirch
Freitag, 14. Mai 2021 AUSSERSCHWYZ 3 Apropos Neuer Steg in Rapperswil von Andreas Knobel ersetzt Halt in Busskirch Die dritte Saison der Oberseefähre steht an: Vom 26. Juli bis am 8. August verkehrt das Fahrgastschiff Jean Jacques Rousseau wieder zwischen Lachen, Altendorf und Rapperswil. Der bisherige Halt in Busskirch entfällt. von Patrizia Baumgartner zweite Oberseefähre zurückgegriffen, ie Schweiz ist wieder einmal heuer plant man jedoch wieder mit Ddem Untergang geweiht! ie Oberseefähre als be- nur einem Schiff. Auf der Jean Jacques Diesen Eindruck erhält, wer liebte Sommer attraktion Rousseau sind mit voller Kapa zität die Werbungen zu den verschiedenen startet bereits in die 60 Gäste zugelassen. Göldi betont, Abstimmungsvorlagen vom D dritte Saison. Dafür sor- dass die Oberseefähre kein Angebot 13. Juni betrachtet, die zurzeit in gen die Agglo Obersee des öffentlichen Verkehrs sei. «Der unseren Briefkästen landen. Dabei und die Gemeinden Lachen, Altendorf Betrieb wird gegebenenfalls wieder- spielt es gar keine Rolle, ob es sowie die Stadt Rapperswil-Jona. Zum um durch Massnahmen zur Bekämp- Befürworter oder Gegner sind. Allen Einsatz als Oberseefähre kommt wie- fung der Covid-19-Epidemie einge- gemeinsam ist, dass die Schweiz derum das nostalgische Schiff Jean schränkt.» nur retten kann, wer nach ihrem Jacques Rousseau, das vom Montag, Der Fahrplan liegt bereits vor. Ab Gusto abstimmt. Ähnlich tönt es 26. Juli, bis Sonntag, 8. August, die bei- Lachen verkehrt die Fähre zwischen aus den Leserbriefspalten und den Ufer des Obersees verbindet. Neu 10 und 21 Uhr. Die letzte Rückfahrt natürlich den Sozialen Medien. legt die Fähre anstatt in Busskirch ab Rapperswil ist um 21.30 Uhr. -

«Zürisee – Uferleben – Leben Am Ufer»
«ZüriSee – Uferleben – Leben am Ufer» Grundlagen, Folgerungen und Massnahmen zur nachhaltigen Aufwertung Zürichsee Landschaftsschutz Die Ufer am Zürichsee verdienen unser Interesse Seelandschaft ist Lebensraum. Seit jeher verändert er sich ständig – durch natürliche Entwicklungen und Eingriffe des Menschen. Wir haben die Chance, den Lebensraum Zürichsee und seine Ufer als Ganzes aktiv mitzugestalten. Weitblick, Wissen um die Zusammenhänge und Interesse für die Belange der Natur schaffen die Voraussetzungen für eine gute Entwicklung. Dieser Prospekt gibt Einblick in die Forschungsarbeit des Projekts «ZüriSee – Uferleben – Leben am Ufer», verweist auf die ökologischen Zusammenhänge, die Veränderungen und ihre Gründe und zeigt Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten auf. Zürichsee Landschaftsschutz (ZSL) will damit die Menschen am Zürichsee für die Natur in ihrem Lebensraum sensibilisieren und sie motivieren, aktiv an einer positiven Umgestaltung mitzuwirken. Untersuchungen des Lebens am Ufer Mit dem starken Rückgang der Schilfbestände am Ufer des Zürichsees wuchs auch die Sorge um die Erhaltung der intakten Landschaft um den See. Seit 1979 wird der Zustand des Röhrichts am Zürcher Ufer des Zürichsees regelmässig untersucht. Im Rahmen des Programms ZSL konnte die Kartierung der Röhrichtbestände auf die Anrainerkantone St. Gallen und Schwyz ausgedehnt wer- den. Jetzt liegt eine einheitliche Bestandesaufnahme der Ufervegetation für den ganzen See vor. Erhebungen zur Tierwelt, vor allem zu Vögeln und Libellen, ergänzen das Bild. In den letzten vier Jahrzehnten kam aber nicht nur die wissenschaftliche Beobachtung zum Zug. An zahlreichen Stellen des Sees wurden Schutz- und Sanierungsmassnahmen getroffen zur Regenera- tion von Röhrichtbeständen und erodierten Ufern. Allerdings ist der Erfolg dieser Massnahmen noch nicht überall sichtbar. Erfahrungen aus Regenerationsprojekten am Bodensee und am Bielersee konnten einbezogen wer- den. -
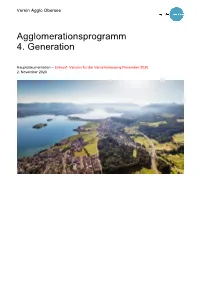
Agglomerationsprogramm 4. Generation
Verein Agglo Obersee Agglomerationsprogramm 4. Generation Hauptdokumentation – Entwurf, Version für die Vernehmlassung November 2020 2. November 2020 Agglomerationsprogramm 4. Generation Obersee / Hauptdokumentation – Entwurf, 2. November 2020 Auftraggeber Verein Agglo Obersee Geschäftsstelle Oberseestrasse 10 8640 Rapperswil Erarbeitung Teilprojekte Teilprojekt Städtisches Alltagsnetz asa AG, Rapperswil-Jona; Wälli AG Ingenieure Teilprojekt (MIV) Strassen Gruner AG, Zürich Teilprojekt Freiraum / Siedlungsklima Hager AG, Zürich; ETH Zürich Hauptmandat Beatrice Dürr Remo Fischer Gauthier Rüegg Lara Thomann (Grafik) EBP Schweiz AG Mühlebachstrasse 11 8032 Zürich Schweiz Telefon +41 44 395 16 16 [email protected] www.ebp.ch Druck: 29. Oktober 2020 2020-11-02_AP4G_Obersee_Hauptdokumentation_Vernehmlassung_Entwurf.docx Seite 2 Agglomerationsprogramm Obersee 4. Generation Die Agglo Obersee im Überblick Mit dem Programm «Agglomerationsverkehr» (PAV) strebt der Bund eine koordinierte Planung von Siedlung, Landschaft und Verkehr in urbanen Räumen an. In diesem Rahmen erarbeitete die Agglo Obersee bereits mehrere Agglomerationsprogramme: 2007 (1. Generation), 2011 (2. Generation) und 2015 (3. Generation). Die dort verankerten Massnahmen werden teilweise durch den Bund mitfinanziert. Die Massnahmen der bisherigen Generationen sind mittlerweile umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung. Nun folgt das Agglomerationspro- gramm der 4. Generation. Als Träger ist der Verein Agglo Obersee verantwortlich für die Ag- glomerationsprogramme in der Region. Was als Modellvorhaben mit vier beteiligten Gemeinden begann, besteht mittlerweile aus 17 Mitgliedergemeinden. Gegenüber der vorangegangenen Generation wurde der Bearbeitungsperimeter erweitert: Neu dazu gehören Reichenburg, Schübelbach, Tuggen und Wan- gen. Die Erweiterung ergab sich durch die ohnehin bereits starke Zusammenarbeit der Gemeinden. Zudem sind diese in den vergangenen Jahren vielerorts über die Gemeindegrenzen hinweg zusammengewachsen und haben auch aufgrund der S- Bahn sowie den Autobahnen eine ähnliche Entwicklungsdynamik. -

Trink Wasser – Trinkwasser
GENOSSENSCHAFT TRINKWASSERHERKUNFT IN RAPPERSWIL-JONA WASSERQUALITÄT Als «nicht gewinnorientierte» Genossenschaft haben wir ein Ziel: Die Schweiz wird oft als Wasserschloss Europas bezeichnet, Das Trinkwasser aus Rapperswil-Jona erfüllt die strengen Die Versorgung der Stadt Rapperswil-Jona mit Trink-, Brauch- und sie verfügt diesbezüglich über riesige Reserven. gesetzlichen Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung und Löschwasser. Fortwährend in bester Qualität, genügender Menge ist natürlich gesund. und Druck. Diesem Reichtum verdanken wir es, dass wir unseren Wasserkonsum nicht einzuschränken brauchen. Um eine hohe Wasserqualität sicher zu stellen, erfolgen die Wartung und der Unterhalt aller Anlagen nach einer strengen WASSER IST LEBEN! Durchschnittlich 75 – 80% des verteilten Trinkwassers in risikobasierten Qualitätssicherung, welche einen Schutz vor Rapperswil-Jona werden in den vier eigenen Grundwasser- Trinkwasserverunreinigungen als oberstes Ziel hat. Die Trink- Sauberes Trinkwasser ist ein kostbares Gut und ein unentbehr- pumpwerken Grünfeld, Busskirch, Tägernau und Hanfländer wasserqualität im Verteilnetz wird durch das kantonale Amt liches Lebensmittel, welches in der Schweiz höchsten Quali- gefördert. für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St. Gallen über- tätsansprüchen genügen muss. In Rapperswil-Jona steht es in prüft. Ca. 80 mikrobiologische Wasserproben werden, verteilt genügender Menge, umweltfreundlich und in bester Qualität 15 – 20% ist aufbereitetes Seewasser von der Gruppenwasser- über das ganze Jahr, jeweils untersucht und analysiert. Bei zur Verfügung. Dazu wird es zum kostengünstigen Preis direkt versorgung Zürcher Oberland. Dieses wird in Stäfa und den Grundwasserpumpwerken erfolgen chemische und physi- nach Hause geliefert – 365 Tage im Jahr. Männe dorf aus dem Zürichsee gepumpt und im Seewasser- kalische Wasseruntersuchungen. Zusätzlich werden in allen werk Mühlehölzli zu einwandfreiem Trinkwasser aufbereitet. Grundwasserpumpwerken einzelne Trinkwasserparameter permanent online überwacht. -

Schiffe Sollen Langsamer Fahren Und Weniger Stationen Bedienen Ein
Zürichsee-Zeitung Obersee Zürichsee-Zeitung Obersee Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018 2 | Region Region | 3 Auf frischer RAPPERSWIL-JONA DARÜBER ENTSCHEIDEN DIE STIMMBÜRGER AM 6. SEPTEMBER Schiffe sollen langsamer fahren Tat ertappt GOMMISWALD Am Montag ist kurz nach 21 Uhr ein unbekannter Ein Investor soll das Pflegezentrum bauen und weniger Stationen bedienen Mann bei einem Einbruch in ein Haus an der Uznacherstrasse von Im Schachen sollen ein Pflegezentrum mit 168 Plätzen und bestimmt die Stadt. Andere Ge- Stadt, da er kein Ausschreibungs- auch für Betagte mit Ergänzungs- Etwas Wehmut kam bei Orts- ZÜRICHSEE Die Zürichsee- einem Bewohner überrascht wor- Alterswohnungen mit 60 bis 80 Plätzen gebaut werden. Im meinden, etwa Gommiswald und verfahren durchführen muss. leistungen bezahlbar sein werden. verwaltungsrat Josef Stoffel auf. Schifffahrtsgesellschaft plant den. Der Täter und sein 30-jähri- November kommt ein Projektierungskredit für das Zentrum an Weesen, hätten sich für einen In- Über den Baurechtsvertrag mit Heute würden in den Wohnungen Das Bürgerspital verfügt ihre Zukunft. Der Fahrplan ger Komplize ergriffen die Flucht. die Urne. Für den Bau sucht die Stadt einen Investor, der vestor entschieden, führte Mar- dem noch nicht bestimmten In- und Zentren von Rajovita mehr schliesslich über eine lange Ge- 2020/21 sieht neue Kurse und Nach kurzer Fahndung konnte bereit ist, 65 Millionen Franken in die Hand zu nehmen. tin Stöckling aus. Das Modell ha- vestor wird 2020 an der Urne ent- als 50 Prozent der Bewohner Er- schichte. Doch die Infrastruktur ein gemächlicheres Tempo vor. die Kantonspolizei St. Gallen das be den Stadtrat überzeugt. Schon schieden. Sollte der Antrag schei- gänzungsleistungen beziehen. -

Of the Trees
project LORD OF THE TREES Landscape Architect and designer Enzo Enea with offices in Rapperswil-Jona, Zürich, Miami and New York is devoted to landscape architecture. He has designed gardens and landscapes all over the world and won a number of prestigious awards along the way. We in the Czech Republic will also have the opportunity to admire his work – he has designed the landscaping for a unique project in Nebřenice near Prague going by the name of The Oaks Prague. Words: Eva Hlinovská Photographs: Enzo Enea Archive f you want to experience what it me- public. It is not simply a garden, of cour- Enea during our interview for Esprit LN. ans when nature actually forces you se, but the Tree Museum which Enzo Enea „I am an optimist as far as the future to become aware of its power, the- opened in 2010. „We should understand of our planet is concerned. But it is hard re is no need to make for the rainfo- that we usually take something from nature keeping that optimism when you hear the rests or journey to Alaska. You simply – but we should give something back to her stories you do each and every day – fires, have to pay a visit to the Swiss town as well. Trees are an essential part of our earthquakes, the devastation of the rain- of Rapperswil. There, in the industrial lives: after all, they produce oxygen,“ says forests. I think we ought to realise that we quarter of Jona, you will find the headquar- Enzo Enea in describing why he decided to need nature.