17036458.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Associate Professor, Department of History
Matthew Paul Berg Professor, Department of History John Carroll University 1 John Carroll Boulevard University Heights, Ohio 44118 Office 216.397.4763 Fax: 216.397.4175 E-mail: [email protected] Education Ph.D. University of Chicago 1993 M.A. University of Chicago 1985 B.A. University of California, Los Angeles 1984 Additional Training January 2009. Center for Advanced Holocaust Studies Hess Seminar, “The Holocaust and other Genocides,” USHMM, Washington DC. 2002-2003. Participant, Association of American Colleges & Universities Workshop “The Liberal Education and Global Citizenship: The Arts of Democracy.” June 2002. United Nations International Conflict Research Seminar “Dealing with the Past.” University of Ulster/Magee Campus, Derry, Northern Ireland. January 2002. Center for Advanced Holocaust Studies Hess Seminar “The Concentration Camp System,” USHMM, Washington DC. July 2002. “Summer Academy on the OSCE.” Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution Schlaining, Austria. June 2000. “Foundation Course, International Civilian Peace-Keeping and Peace-Building.” Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution, Schlaining, Austria. Teaching Experience 2008 – Professor of History, John Carroll University 2000 – 2008 Associate Professor, Department of History, John Carroll University 1994 – 2000 Assistant Professor, Department of History, John Carroll University 1993 – 1994 Visiting Assistant Professor, Department of History, University of Toledo 1991 – 1993 Lecturer, Social Sciences Collegiate Division and Department of History, University of Chicago Berg, CurriculumVitae, 1 Matthew Paul Berg Courses Taught •First Year Seminar. •Introduction to Human Rights. •World Civilizations to 1600 / World Civilizations since 1600. •20th Century Global History. •World War One and Modernity. •The Cold War. •Justice & Democracy in a Global Context. •History as Art & Science (departmental methods course). -

Der Weg Zum Anschluss. Burgenlandschicksal 1928 – 1938
INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Kulturlandesrat Helmut Bieler . 4 Einleitung . 5 Pia Bayer Burgenländische Landespolitik 1928–1933. 6 Pia Bayer, Dieter Szorger Das Burgenland im Ständestaat 1933–1938 ■ Die politische Entwicklung . 16 ■ Der 12. Februar 1934 . 23 ■ Die Organisationsstruktur der Vaterländischen Front . 31 ■ Die Arbeiterbewegung im Untergrund. 35 Der Beginn der politischen Verfolgung Der Aufbau der Untergrundorganisation der Revolutionären Sozialisten und Kommunisten Die Volksfront gegen Hitler ■ Die Entwicklung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) . 43 Pia Bayer, Dieter Szorger Die Machtergreifung der Nationalsozialisten ■ Die Anatomie der Machtergreifung . 54 ■ Der Beginn der Verfolgungsmaßnahmen. 66 Die erste Verhaftungswelle Das NS-Terrorsystem Die NSDAP Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) Die Sicherheitsdienst-Außenstelle (SD) Eisenstadt Die Kriminalpolizei (Kripo) Die Opfer der politischen Verfolgung Die Verfolgung der jüdischen Burgenländer Die Verfolgung der burgenländischen Roma ■ Die Volksabstimmung vom 10. April 1938 . 85 ■ Die Auflösung des Burgenlandes . 95 Dieter Szorger Biografien führender burgenländischer Nationalsozialisten . 97 Zeittafel 1928–1938. 104 Literaturverzeichnis. 110 Danksagung . 113 VORWORT Sehr geehrte Damen und Herren! er kennt sie nicht, jene Propa- genstaatlichkeit hinnehmen. Das Burgen- gandafilme aus den 30er Jah- land verlor seine Selbstständigkeit, wurde Wren des vorigen Jahrhunderts? aufgeteilt und verschwand von der Land- Zu sehen ist meist ein kleiner Diktator auf -
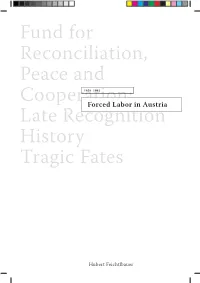
Forced Labor in Austria Late Recognition History Tragic Fates
Fund for Reconciliation, Peace and 19381945 Cooperation:Forced Labor in Austria Late Recognition History Tragic Fates Hubert Feichtlbauer Imprint Austrian Reconciliation Fund (Publisher) Hubert Feichtlbauer (Author) Scientific Advisor Univ. Doz. Florian Freund German Edition: ISBN: 3-901116-21-4 English Edition: ISBN: 3-901116-22-2 Published in German, English, Polish and Russian Printed by Rema Print, Neulerchenfelder Straße 35, A-1160 Vienna, on 100% chlorine-free bleached paper The book, the title, the cover design and all symbols and illustrations used are protected by copyright. All rights reserved, in particular with regard to the translation, reproduction, extraction of photomechanical or similar material and storage in data processing media either in full or in part. Despite careful research, no responsibility is accepted for the correctness of the information contained in this book. In order to ensure the readability of the texts and lists, gender-specific formulations were frequently dispensed with. Quotes from individuals and legal documents were translated solely for the purposes of this publication. No liability is accepted for translation, typesetting and printing errors. www.reconciliationfund.at © 2005 2 Schopenhauerstraße 36, A-1180 Vienna www.braintrust.at Contents 1. ›Preface‹ 5 Wolfgang Schüssel, Maria Schaumayer, Ludwig Steiner, Richard Wotava; About This Book 2. ›Guilt and Atonement‹ 17 3. ›Racism and Exploitation‹ 41 4. ›Every Case a Tragic Fate‹ 71 5. ›Why Such a Late Issue?‹ 127 6. ›The State and the Business Community -

Paths in Austrian and Finnish History
Smallcons Project A Framework for Socio-Economic Development in Europe? The Consensual Political Cultures of the Small West European States in Comparative and Historical Perspective (No. HPSE-CT-2002-00134) Work Package 10 Paths in Austrian and Finnish History Helmut Konrad, Martin Pletersek, Andrea Strutz (eds.) Department of History/Contemporary History, University of Graz September 2004 Contributors: Helmut Konrad, Martin Pletersek, Johanna Rainio-Niemi, Henrik Stenius, Andrea Strutz 2 Contents Helmut Konrad, Martin Pletersek, Andrea Strutz Paths in Austrian and Finnish history – a tentative comparison Helmut Konrad Periods in the History of Austrian Consensualism Henrik Stenius Periodising Finnish Consensus Martin Pletersek, Andrea Strutz A Monarchy and Two Republics – the Austrian Path (including comparative context of neighbouring new EU-members) Johanna Rainio-Niemi Paths in the Austrian and Finnish history: FINLAND (including comparative context of neighbouring new EU-members) 3 Paths in Austrian and Finnish history – a tentative comparison Helmut Konrad, Martin Pletersek, Andrea Strutz The smallcons-project "A Framework for Socio-economic Development in Europe? The Consensual Political Cultures of the Small West European States in Comparative and Historical Perspective" reserves a particular place for Austria and Finland because "[…] these cases suggest that the communication capacity conditional for consensualism can emerge within only a few decades." (Annex to the contract: 3). As opposed to the other project countries, the project proposal assumes that the two are the discontinuity cases whose historical paths didn't seem to point towards consensualism. In the words of Peter Katzenstein, "[…] the Austrian train was at every branch switched in a direction opposite from the other small European states." (1985: 188). -

Historisches 1 27
ÖSTERREICH JOURNAL NR. 2 / 6. 12. 2002 27 Historisches 1 27. 04. 1945 Provisorische Staatsregierung unter dem Vorsitz von Dr. Karl Renner. Ihr gehörten Vertreter der ÖVP, SPÖ und KPÖ zu gleichen Teilen an. 20. 12. 1945 Provisorische Bundesregierungegierung 1945 Kabinett Figl I (Sitzung vom 29. Dezember 1945) im Reichs- ratsaal im Parlament in Wien. v.l.n.r.: Ing. Vin- zenz Schumy, Johann Böhm, Eduard Heinl, Dr. Georg Zimmermann, Dr. Ernst Fischer, Johann Koplenig, Ing. Leopold Figl, Staats- kanzler Dr. Karl Renner, Dr. Adolf Schärf, Franz Honner, Dr. Josef Gerö, Josef Kraus, Andreas Korp, Ing. Julius Raab. Vorsitz: Karl Seitz. Bild: Institut für Zeitgeschichte © BKA/BPD 08. 11. 1949 Kabinett Figl II Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP), Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ 28. 10. 1952 Kabinett Figl III Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP), Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ 02. 04. 1953 Kabinett Raab I Gruppenfoto I. v.l.n.r. sitzend: BM f. ausw. Angelegenheiten Ing. Dr. Karl Gruber, BM f. Inneres Oskar Helmer, BK Ing. DDDR. Julius Raab, VK Dr. Adolf Schärf, BM f. Handel und Wiederaufbau DDDr. Udo Illig, v.l.n.r. stehend: SSekr. im BMaA Dr. Bruno Kreisky, BM f. sozi- ale Verwaltung Karl Maisel, SSekr. im BM f. Finanzen Dr. Fritz Bock, SSekr. im BM f. Inne- res Ferdinand Graf, BM f. Finanzen DDr. Rein- hard Kamitz, BM f. Unterricht Dr.Ernst Kolb, SSekr. im BM f. Handel und Wiederaufbau Dipl. Ing. Raimund Gehart, BM f. -

Grundlagen Zum Wissensmanagement Im
Band 14 / 2017 Band 14 / 2017 Die Ankunft Tausender Flüchtlinge und Migranten in Europa in den letzten Jahren machte Migration und Flucht wieder zu einem besonders aktuellen Thema. In der vorliegenden Publikation zum LVAk-Symposion 2016 wird dieser Themen- schwerpunkt aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: Flucht und Migration werden einander gegenüber gestellt, historische Beispiele angeführt und potenzielle Lösungsvor- schläge für eine zukünftige Migrationspolitik erarbeitet. Ein Migration und Flucht erweitertes Konzept von sogenannten „Hot Spots“ zur Regis- trierung von Flüchtlingen und Schutzzonen in den Herkunfts- ländern werden ebenso thematisiert wie Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz im Zusammenhang mit Migra- tion und Integration. Migration und Flucht und Migration ISBN: 978-3-903121-26-3 Harald Müller und Benedikt Hensellek (Hrsg.) 14/17 Symposion der Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie 2016 Hensellek (Hrsg.) Müller, Landesverteidigungsakademie Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Harald Müller, Benedikt Hensellek (Hrsg.) Migration und Flucht 14/2017 Wien, September 2017 Impressum: Medieninhaber, Herausgeber, Hersteller: Republik Österreich / Bundesministerium für Landesverteidigung Rossauer Lände 1 1090 Wien Redaktion: Landesverteidigungsakademie Kommando Stiftgasse 2a 1070 Wien Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie Copyright: © Republik Österreich / Bundesministerium für Landesverteidigung Alle Rechte vorbehalten September 2017 ISBN 978-3-903121-26-3 Druck: ReproZ W 17- Stiftgasse -

Intelligence Gathering in Postwar Austria P
MASTERARBEIT / MASTER´S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master´s Thesis US-led stay behind networks in Austria A tale from the Cold War: shady deals, dubious loyalties, and underground arms caches. verfasst von / submitted by Lorenzo Cottica, BA angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master (MA) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 805 degree program code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Masterstudium Globalgeschichte degree program as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Uni.-Prof. Mag. DDr. Oliver Rathkolb “A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina.1” (Thinking ill of others is a sin, but it often turns out good guesses.) 1 One of the most famous aphorisms credited to Giulio Andreotti, [undated], cited from ilsole24ore.com. Link. II Acknowledgments First and foremost, I want to express my sincere gratitude to the supervisor of this project, Prof. Oliver Rathkolb who, aside from assisting me throughout the research process, also granted me access to his private archive of copied source-material. Almost a third of all primary sources on which this thesis is founded upon, were thereby sponsored by prof. Rathkolb. I likewise want to thank General Horst Pleiner, for granting me the possibility to conduct and record an interesting interview of over an hour, thereby enriching the research with his expert perspective. III Abstract After dealing with a handful of editorial notes in chapter one, in chapter two, the thesis moves on to a description of the technical and methodological elements of the research itself, such as the terminology used, a critique of the main sources and an overview of the current state of research in this particular field. -

Masterarbeit / Master's Thesis
MASTERARBEIT / MASTER’S THESIS Titel der Masterarbeit / Title of the Master‘s Thesis „Das Stockholm-Syndrom der SPÖ-Linken“ verfasst von / submitted by Mag.a. Sonja Grusch angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts (MA) Wien, 2016 / Vienna, 2016 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 066 688 degree programme code as it appears on the student record sheet: Studienrichtung lt. Studienblatt / Wirtschafts- und Sozialgeschichte degree programme as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: a.o.Univ. Prof. Dr. Reinhard Sieder Das Stockholm-Syndrom der SPÖ-Linken1 „...dass die Treue zum Sozialismus wichtiger ist als eine falsch verstandene Parteidisziplin.“ Erwin Scharf, 1948 1 „Unter dem Stockholm-Syndrom versteht man ein psychologisches Phänomen, bei dem Opfer von Geiselnahmen ein positives emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Dies kann dazu führen, dass das Opfer mit den Tätern sympathisiert und mit ihnen kooperiert.“ Zitiert nach Wikipedia (28.2.2016) 2 Inhalt: 1. Einleitung Seite 5 2. 1945: Die Wiedergründung der SPÖ als taktischer Kompromiss Seite 8 2.1. Die Rechten haben einen Startvorteil Seite 8 2.2. Abgrenzung nach links – offen nach rechts Seite 14 2.3. Parteitag 1947: Die Resolution der 44 Seite 16 2.4. Es wird scharf geschossen: Gegen Erwin Scharf und die Parteilinke Seite 18 2.5. Die Ikone der Linken: Josef Hindels – und seine durchaus zweifelhafte Rolle Seite 20 2.6. Rückzug der Linken Seite 22 2.7. Zerfall der Linken in Folge der Schläge Seite 25 2.8. Warum diese Wucht gegen die Parteilinke? Seite 26 2.9. -

Der Erste Österreichertransport in Das KZ Dachau 1938
Wolfgang Neugebauer Peter Schwarz Stacheldraht, mit Tod geladen … Der erste Österreichertransport in das KZ Dachau 1938 Wolfgang Neugebauer Peter Schwarz Stacheldraht, mit Tod geladen … Der erste Österreichertransport in das KZ Dachau 1938 Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Österreichs Redaktion: Christine Schindler Die Herausgabe dieser Broschüre wurde durch den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus gefördert. © 2008, Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Österreichs, Wien Cover: Ernst Eisenmayer Layout: Christa Mehany-Mitterrutzner Druck: S.Print, 1220 Wien ISBN 978-3-901142-53-6 Vorwort Als am Morgen des 12. März 1938 die Truppen der Hitler-Wehrmacht Österreichs Grenzen überschritten, wussten die NS-Gegner, gleich ob sie Anhänger der Regierung Schuschnigg waren oder in der illegalen Arbeiter- bewegung in Opposition zur Regierung standen, dass es keine Hoffnung mehr auf die Erhaltung der Unabhängigkeit Österreichs gab. Noch bevor die deutsche Wehrmacht in Wien eingetroffen ist, waren schon NS-Greifkommandos unterwegs, um die Verhaftungslisten des unter dem Druck Hitlers eingesetzten Innenministers Seyß-Inquart abzuarbeiten. Damit wurde eine Hetzjagd nicht nur auf die jüdischen Bürger, sondern vor allem auch auf die politischen Gegner des Hitler-Regimes begonnen. Am 1. April wurde aus der Masse der Verhafteten der erste Transport von Häftlingen nach Dachau zusammengestellt. Die beiden Verfasser der vorlie- genden Broschüre, Hon.-Prof. Dr. Wolfgang Neugebauer und Mag. Peter Schwarz, haben in dankenswerter Weise dargestellt, mit welcher Brutalität dieser Transport vonstatten ging. Die Nazis wollten mit den Terrormaßnah- men vor allem die Angst in der österreichischen Bevölkerung schüren und auch die Jubler beeindrucken. Dachau war als Konzentrationslager seit den Tagen bekannt, als Hitler nach der Machtergreifung in Deutschland im Jahre 1933 vor allem die politischen Gegner dorthin deportierte. -

Publikationsverzeichnis Von Priv.-Doz. Dr. Helmut Wohnout
Publikationsverzeichnis von Priv.-Doz. Dr. Helmut Wohnout (Stand: 01/2019) Nicht in diesem Publikationsverzeichnis enthalten sind Beiträge in politischen Zeitschriften sowie Rezensionen in wissenschaftlichen Publikationen sowie kürzere Artikel in Tages- und Wochenzeitungen (u.a. Die Presse, Salzburger Nachrichten, Die Furche). I Selbstständige Publikationen 1.) Die Haltung der Österreichischen Volkspartei zum Neutralitätsgedanken 1945 bis 1955 (Wien 1986). 2.) Geschichte des Österreichischen Hospizes in Jerusalem (Klosterneuburg/Wien 1993). 3.) Regierungsdiktatur oder Ständeparlament? Gesetzgebung im autoritären Österreich (=Studien zu Politik und Verwaltung, Bd. 43, Hg. von Christian Brünner, Wolfgang Mantl, Manfried Welan) (Wien/Köln/Graz 1993). 4.) Das österreichische Hospiz in Jerusalem. Geschichte des Pilgerhauses an der Via Dolorosa. Mit einem Vorwort von Kardinal Franz König. (Wien/Köln/Weimar 2000). 5.) Alois Mock. Ein Politiker schreibt Geschichte (gemeinsam mit Martin Eichtinger) (Wien/Graz/Klagenfurt 2008); (erschienen 2009 in kroatischer Sprache unter dem Titel Alois Mock. Političar koji stvara povijest, 2010 in rumänischer Sprache unter dem Titel Alois Mock. Un politician scrie istoria und 2012 in slowenischer Sprache unter dem Titel Alois Mock. Politik piše zgodovino). 6.) Leopold Figl und das Jahr 1945.Von der Todeszelle auf den Ballhausplatz (St. Pölten/Salzburg/Wien 2015) II Herausgeberschaften 1.) Demokratie und Geschichte. Jahrbuch des Karl von Vogelsang-Institutes zur Erforschung der Geschichte der christlichen Demokratie in Österreich. Jahrgänge 1-10, (Wien/Köln/Weimar 1997-2011). 2.) Was bleibt an sozialer Gerechtigkeit? Gesellschaft und Katholische Soziallehre im neuen Jahrtausend (gemeinsam mit Matthias Tschirf und Karl Klein) (Wien 2000). 3.) Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert (gemeinsam mit Michael Gehler und Wolfram Kaiser) (Wien/Köln/Weimar 2001). 4.) 100 Jahre Leopold Figl. -

70 Jahre Arbeiterkammer Salzburg
70 JAHRE ARBEITERKAMMER SALZBURG 1946 2016 § 1 AKG Die Kammern für Arbeiter und Angestellte (…) sind berufen, die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu vertreten und zu fördern. IMPRESSUM Medieninhaberin, Herausgeberin & Verlag: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg, Tel.: 0662 8687, [email protected], www.ak-salzburg.at Projektleitung: Bettina Gruber Autoren: Franz Hager, Mag. Andreas Praher, Mag. Robert Schwarzbauer Redaktion: Mag. Dominik Senghaas; Layout: galcom, www.galcom.at Bildquellen: AK Salzburg, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Fotolia, Gemeinde Lend, GROHAG, Google Earth, Keltenmuseum, Stadtarchiv Salzburg (Fotosammlung und Sammlung Işık), Steinocher Archiv, ÖBB/Philipp Horak, SVV Druck: GWS Salzburg ISBN Nr.: 978-3-901817-27-4; Erschienen in Salzburg, Mai 2016 Unser besonderer Dank gilt Harald Gruber für die große Hilfe beim Ausheben historischer Informationen und Materialien. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten dieser Chronik gleichermaßen angesprochen fühlen. 70 JAHRE INHALT AK SALZBURG DIE AK IN DER 1. REPUBLIK (1921-1938) 9 Zur Vorgeschichte 10 Die Einrichtung der Arbeiterkammer in der Ersten Republik 12 Sozialreformen 1918 bis 1920 13 -

Von Der Fremdarbeit Zur Integration? – (Arbeits)Migrations- Und Integrationspolitik in Der Zweiten Republik
Demokratiezentrum Wien Quelle online: www.demokratiezentrum.org Quelle print: Bernhard Perchinig, Von der Fremdarbeit zur Integration? Migrations- und Integrationspolitik in Österreich seit 1945. In: Vida Bakondy, Simonetta Ferfoglia, Jasmina Janković, Cornelia Kogoj, Gamze Ongan, Heinrich Pichler, Ruby Sircar und Renée Winter (Hg.): Viel Glück! Migration heute. Wien, Belgrad, Zagreb, Istanbul. Good Luck! Migration Today. Vienna, Belgrade, Zagreb, Istanbul. Vienna (Mandelbaum Verlag) 2010, 142 – 160. , Bernhard Perchinig Von der Fremdarbeit zur Integration? – (Arbeits)migrations- und Integrationspolitik in der Zweiten Republik. Selektivität und Integration: Die Politik gegenüber den „Displaced Persons“ und den Volksdeutschen Im letzten Kriegsjahr und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in Europa etwa 30 Million Flüchtlinge und Vertriebene 1. In Österreich waren zwei große Gruppen bestimmend: Die „Displaced Persons“ (DP´s) - vom NS- Regime zwangsrekrutierte Arbeiter, Kriegsgefangene und jüdische Überlebende der Konzentrationslager - einerseits; und die aus Ost- und Zentraleuropa vertriebenen deutschen Minderheiten, die „Volksdeutschen“, andererseits. Zu den „Displaced Persons“ der ersten Nachkriegszeit kamen zwischen 1945 und 1947 mehrere Wellen jüdischer Flüchtlinge vor den Pogromen in Osteuropa, die größte darunter nach dem Pogrom von Kielce im Sommer 1947. Österreich hatte kein Interesse an einer Ansiedlung. Für Österreich wäre dies einem Schuldeingeständnis und einer Wiedergutmachungspflicht gleichgekommen, aber auch der neugegründete Staat Israel drängte auf eine rasche Weiterreise 2. In der Bevölkerung gab es massive Vorurteile gegen die DP´s. Sehr früh entstand innerhalb der österreichischen Parteienlandschaft – nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Kosten der Flüchtlingsbetreuung von den Alliierten der Republik verrechnet wurden - ein parteiübergreifender Konsens darüber, die Lager der DP´s möglichst schnell zu schließen, ihre Insassen außer Landes zu bringen und Integration zu verunmöglichen.