Bericht Leinkraut-Scheckenfalter
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Inventaire Suisse Des Biens Culturels D'importance Nationale
Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale Commune Objet Edifices Objet simple Objet multiple Collections Musée Archive Bibliothèque Archéologie spéciaux Cas x y Albinen ISOS Dorf: Albinen Anniviers (Grimentz) Ilôt Bosquet / Chlasche, Pierre à cupules x 610.100 113.250 (Saint-Luc) Groupe des 5 moulins x 612.840 118.360 ISOS village: Ayer ISOS village: Grimentz ISOS village: Saint-Jean ISOS village: Vissoie ISOS hameau: Pinsec Bagnes Alpage de Louvie, Mauvoisin x 589.920 100.060 Église St-Maurice, ossuaire, ancienne cure, Le Châble x 582.230 103.240 ISOS village: Bruson ISOS village: Le Châble ISOS village: Médières ISOS village: Sarreyer ISOS hameau: Fontenelle Bellwald ISOS Weiler: Bodma VALAIS 373 Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von nationaler Bedeutung Gemeinde Objekt Bauten Einzelobjekt Objekt mehrteilig Sammlungen Museum Archiv Bibliothek Archäologie Spezialfälle x y Bettmeralp ISOS Weiler: Eggen Binn Bogenbrücke mit Kapelle St. Anton, Bei der Brücke x 657.358 135.005 ISOS Dorf: Schmidigehischere ISOS Weiler: Fäld Bitsch ISOS Weiler: Wasen Blatten ISOS Dorf: Blatten ISOS Weiler: Eisten ISOS Weiler: Weissenried Bourg-Saint-Pierre Église St-Pierre avec tour romane x 582.130 088.640 Hospice avec ses dépendances, bibliothèque, musée et x x x x 579.196 079.752 archives, Col du Grand Saint-Bernard ISOS petite ville / bourg: Bourg-Saint-Pierre ISOS cas particulier: Grand-Saint-Bernard Brig-Glis Alter und neuer Stockalperpalast, Alte Simplonstrasse 28 x 642.520 129.468 374 WALLIS Inventaire suisse des biens culturels -

Kleines Silicon Valley in Steg?
Walliser Bote 10 Freitag, 1. Dezember 2017 WALLIS Bauprojekt | Im Steger Industriegebiet soll ein innovativer Energiepark entstehen Kleines Silicon Valley in Steg? STEG-HOHTENN | Am Sonntag und Marketing anwesend sein», stimmt die Steger Burger - zählt er auf. versammlung über die Er - teilung des Baurechts für Vorzeigebeispiel einen neuartigen Energie - für Energieeffizienz park ab. Gibt sie grünes Auch die Planungen für den Bau Licht, könnten sich schon sind inzwischen fortgeschritten. bald neue Jungunterneh - Für die Architektur zeichnet men im Ort niederlassen. dabei das Büro Vomsattel Wag - ner Architekten verantwortlich. Die Initianten wollen im Indus - «Neben verschiedenen moder - triegebiet von Steg bis Ende 2018 nen Sitzungszimmern und Büro - einen neuartigen Ener giepark räumlichkeiten werden auch bauen. «Überspitzt gesagt soll in ein Restaurant sowie 150 Park - der Gemeinde Steg-Hohtenn ein möglichkeiten integriert», nennt kleines Silicon Valley realisiert Eberhardt einige Details. Die werden. Ein Ort, an dem Ideen beiden Hälften des Baus sollen entstehen und kreative Köpfe an durch einen autofreien und na - der Zukunft der digitalisierten turnahen Aussenraum verbun - Welt tüfteln», erklärt Johann den werden. Es ist geplant, den Eberhardt, Geschäftsführer von Energiebedarf weitmöglichst mit winsun. Die Steger Solarspezia - Solarenergie zu decken und den listen wollen das Projekt ge - Park zum Vorzeigebeispiel für meinsam mit der ortsansässigen energieeffizientes Bauen und Ar - Bauunternehmung Zengaffinen beiten zu machen. und dem Catering-Unterneh - Die Initianten sind über - men mydomi.ch, das seinen zeugt, mit dem Projekt die Hauptsitz ebenfalls nach Steg Abwanderung qualifizierter verlegen will, realisieren. Mit Arbeitskräfte aus der Region dem geplanten Energiepark sol - reduzieren zu können. Damit len Freizeit und Arbeitsplatz ver - eine Realisierung aber möglich eint und damit attraktive Ar - wird, muss es am Sonntag noch beitsplätze für junge Arbeits - eine wichtige Hürde nehmen. -

Goats As Sentinel Hosts for the Detection of Tick-Borne Encephalitis
Rieille et al. BMC Veterinary Research (2017) 13:217 DOI 10.1186/s12917-017-1136-y RESEARCH ARTICLE Open Access Goats as sentinel hosts for the detection of tick-borne encephalitis risk areas in the Canton of Valais, Switzerland Nadia Rieille1,4, Christine Klaus2* , Donata Hoffmann3, Olivier Péter1 and Maarten J. Voordouw4 Abstract Background: Tick-borne encephalitis (TBE) is an important tick-borne disease in Europe. Detection of the TBE virus (TBEV) in local populations of Ixodes ricinus ticks is the most reliable proof that a given area is at risk for TBE, but this approach is time- consuming and expensive. A cheaper and simpler approach is to use immunology-based methods to screen vertebrate hosts for TBEV-specific antibodies and subsequently test the tick populations at locations with seropositive animals. Results: The purpose of the present study was to use goats as sentinel animals to identify new risk areas for TBE in the canton of Valais in Switzerland. A total of 4114 individual goat sera were screened for TBEV-specific antibodies using immunological methods. According to our ELISA assay, 175 goat sera reacted strongly with TBEV antigen, resulting in a seroprevalence rate of 4.3%. The serum neutralization test confirmed that 70 of the 173 ELISA-positive sera had neutralizing antibodies against TBEV. Most of the 26 seropositive goat flocks were detected in the known risk areas in the canton of Valais, with some spread into the connecting valley of Saas and to the east of the town of Brig. One seropositive site was 60 km to the west of the known TBEV-endemic area. -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland
A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -
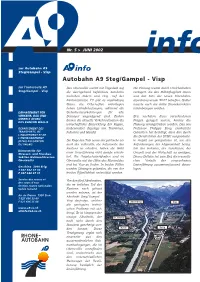
4055/NET A9 Info N. 5
Nr.5 > JUNI 2002 info zur Autobahn A9 Steg/Gampel - Visp Autobahn A9 Steg/Gampel - Visp sur l'autoroute A9 Das Oberwallis wartet mit Ungeduld auf Die Planung wurde durch Unsicherheiten Steg/Gampel - Visp die durchgehend befahrbare Autobahn verzögert, die den Militärflugplatz Raron zwischen Siders und Brig. Auf der und das Netz der neuen Eisenbahn- Kantonsstrasse T9 gibt es regelmässig alpentransversale NEAT betreffen. Später Staus, die Ortschaften unterliegen musste auch die dritte Rhonekorrektion hohen Lärmbelastungen, während die miteinbezogen werden. DEPARTEMENT FÜR Sicherheitsvorkehrungen für alle VERKEHR, BAU UND Benutzer ungenügend sind. Zudem Erst nachdem diese verschiedenen UMWELT (DVBU) bremst die aktuelle Verkehrssituation die Fragen geregelt waren, konnte die DES KANTON WALLIS wirtschaftliche Entwicklung der Region, Planung vorangetrieben werden. Das von DEPARTEMENT DES insbesondere diejenige von Tourismus, Professor Philippe Bovy erarbeitete TRANSPORTS, DE Industrie und Handel. Gutachten hat bestätigt, dass das durch L'EQUIPEMENT ET DE die Dienststellen des DVBU ausgearbeite- L'ENVIRONNEMENT (DTEE) DU CANTON Die Enge des Tals sowie der politische als te Projekt am geeignetsten ist, um den DU VALAIS auch der Volkswille, die Naturwerte des Anforderungen der Allgemeinheit bezüg- Kantons zu erhalten, haben die Wahl lich des Verkehrs, der Anschlüsse, der Dienststelle für Strassen- und Flussbau einer Linienführung nicht gerade erleich- Umwelt und der Wirtschaft zu genügen. Sektion Nationalstrassen tert. Die Hauptschwierigkeiten sind im Dieses Bulletin hat zum Ziel, die wesentli- Oberwallis Oberwallis auf der Höhe des Pfynwaldes chen Vorteile der vorgesehenen und bei Visp zu finden. In beiden Fällen Linienführung zusammenfassend darzu- Geschina 3900 Brig T 027 922 97 00 wurden Lösungen gefunden, die von der legen. -

Geschtjier-Blatt 2011-02
Seite 2 inhalt impressum Seite 2 Inhalt / Impressum Seite 3 Aus dem Gemeinderat, Geschtjier Agenda, Seite 4 10 Jahre „Geschtjier-Blatt“ Seite 5 Abklärungen Kindertagesstätte, Fahnen auf der Feschti, Wech- sel in der Kulturkommission, Fusion der Feuerwehren Seite 6 Der Hochwasserschutz in Niedergesteln Seite 7 Gratulationen Seite 8 National- und Ständeratswahlen vom 23.10.2011, Die Geschtjier in Zahlen, Vorschau Geschtjier-B latt 3/2011 Seite 9 Neues Jugendlokal Seite 10 Trachtendamen an Fronleichnam, Venedig in Niedergesteln? Ver- dienstmedaille für Klementine Kalbermatter, Link Familie von Turn Seite 11 Das Bietschhorn, Quellen, Wasserleiten, Familientag Kirchenchor Seite 12 Aymo I.; Rittersegnung am 01. Oktober 2011 Seite 13 Akzente „Professor Eberhard Schlotter zum 90. Geburtstag“ Seite 14 Alpfest 2011 in Mattachru Seite 15 Sauberes Niedergesteln, Frischer Anstrich für die Turnhalle, Schulhausordnung Telefon : Seite 16 Abschlussklasse der OS-Raron 2010/2011, Der erste Schultag +41 (0)27 934 19 12 im Schuljahr 2011/2012 Seite 17 Schulfoto des Schuljahres 2011/2012 Seite 18 Kinderflohmarkt, Kluger Rat – Elternrat Fax : Seite 19 Pfingstbrunch Seite 20 Damenturnverein, MUKI-Turnen, JUTU +41 (0)27 934 29 06 Seite 21 Geschtjier Holzofubrot Seite 22 Hütehundesport – wo Hund und Hundehalter ein Team bilden Seite 23 Hütehundesport – (Fortsetzung) Internet : Seite 24 Hütehundesport – (Fortsetzung), Grüsse aus Singapur www.niedergesteln.ch Seite 25 Alpenwerk in der Jolialpe www.3942.ch Seite 26 Eine Herde weisser Schafe Seite 27 Folkore-Festival -

13 Protection: a Means for Sustainable Development? The
13 Protection: A Means for Sustainable Development? The Case of the Jungfrau- Aletsch-Bietschhorn World Heritage Site in Switzerland Astrid Wallner1, Stephan Rist2, Karina Liechti3, Urs Wiesmann4 Abstract The Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn World Heritage Site (WHS) comprises main- ly natural high-mountain landscapes. The High Alps and impressive natu- ral landscapes are not the only feature making the region so attractive; its uniqueness also lies in the adjoining landscapes shaped by centuries of tra- ditional agricultural use. Given the dramatic changes in the agricultural sec- tor, the risk faced by cultural landscapes in the World Heritage Region is pos- sibly greater than that faced by the natural landscape inside the perimeter of the WHS. Inclusion on the World Heritage List was therefore an opportunity to contribute not only to the preservation of the ‘natural’ WHS: the protected part of the natural landscape is understood as the centrepiece of a strategy | downloaded: 1.10.2021 to enhance sustainable development in the entire region, including cultural landscapes. Maintaining the right balance between preservation of the WHS and promotion of sustainable regional development constitutes a key chal- lenge for management of the WHS. Local actors were heavily involved in the planning process in which the goals and objectives of the WHS were defined. This participatory process allowed examination of ongoing prob- lems and current opportunities, even though present ecological standards were a ‘non-negotiable’ feature. Therefore the basic patterns of valuation of the landscape by the different actors could not be modified. Nevertheless, the process made it possible to jointly define the present situation and thus create a basis for legitimising future action. -

Alps Village to Village Hiking
Alps Village to Village Hiking 10 Days Alps Village to Village Hiking Experience picturesque alpine hamlets and sweeping mountain vistas in Switzerland and France on this unforgettable hiking trilogy of the Alps. Tackle the legendary Eiger Trail at the foot of the Eiger's notorious north face, which has challenged mountaineers for over a century. Traverse canyon trails to discover imposing views of the iconic Matterhorn, and complete your tour in Chamonix, where the majestic Mont Blanc looms over the charming town. From Grindelwald to Zermatt to Chamonix, this 10-day tour will inspire and challenge even the most seasoned hiker. Details Testimonials Arrive: Geneva, Switzerland “This trip takes you to some of the most iconic hikes in the world. My only disappointment was that the Depart: Geneva, Switzerland trip was over! Great guides and wonderful hikes.” David M. Duration: 10 Days Group Size: 5-16 Guests "I've taken six MTS trips and they have all exceeded my expectations. The staff, the food, the logistics and Minimum Age: 18 Years Old the communications have always been exceptional. Thank you for being my "go to" adventure travel Activity Level: company!" Margaret I. REASON #01 REASON #02 REASON #03 This MT Sobek-crafted itinerary MT Sobek's expert guides have MT Sobek has been taking covers the must-see Alps in been leading treks in this region our travelers to the Alps since only 10 days — see the Eiger, for nearly 50 years, and this 1970 — we know the best hikes Matterhorn and Mont Blanc. grand tour is not to be missed. -

On the Trails of Josias Braun-Blanquet II: First Results from the 12Th EDGG Field Workshop Studying the Dry Grasslands of the Inneralpine Dry Valleys of Switzerland
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/339146186 On the trails of Josias Braun-Blanquet II: First results from the 12th EDGG Field Workshop studying the dry grasslands of the inneralpine dry valleys of Switzerland Article · March 2020 DOI: 10.21570/EDGG.PG.45.59-88 CITATIONS READS 0 252 15 authors, including: Jürgen Dengler Riccardo Guarino Zurich University of Applied Sciences Università degli Studi di Palermo 527 PUBLICATIONS 6,992 CITATIONS 269 PUBLICATIONS 1,621 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Ivan Moysiyenko Denys Vynokurov Kherson State University National Academy of Sciences of Ukraine 145 PUBLICATIONS 591 CITATIONS 58 PUBLICATIONS 98 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Emerald network of Ukraine, the shadow list View project Replacement Habitats on Green Roof to improve Biodiversity (ground-nesting birds, insects, spiders and plant diversity) View project All content following this page was uploaded by Jürgen Dengler on 05 March 2020. The user has requested enhancement of the downloaded file. 59 Palaearctic Grasslands 45 ( March 2020) DOI: 10.21570/EDGG.PG.45.59-88 Scientific Report On the trails of Josias Braun-Blanquet II: First results from the 12th EDGG Field Workshop studying the dry grasslands of the inneralpine dry valleys of Switzerland Jürgen Dengler1,2,3 *, Riccardo Guarino4 , Ivan Moysiyenko5 , Denys Vynokurov6,7 , Steffen Boch8 , Beata Cykowska-Marzencka9 , Manuel Babbi1, Chiara Catalano10 , Stefan Eggenberg11 , Jamyra Gehler1, Martina 12 13 14 15 1,16 Monigatti , Jonathan Pachlatko , Susanne Riedel , Wolfgang Willner & Iwona Dembicz 1Vegetation Ecology, Institute of Natural Resource Sciences (IUNR), Zurich 10Urban Ecosystem Design, Institute of Natural Resource Sciences (IUNR), University of Applied Sciences (ZHAW), Grüentalstr. -

Die Besten Tipps, Infos Und Ausflüge in Und Um Brig
Freizeitguide ... die besten Tipps, Infos und Ausflüge in und um Brig www.brig-simplon.ch · [email protected] · T: +41 (0) 27 921 60 30 Inhaltsverzeichnis Umkreis von 0-10 km S. 5 - 16 Umkreis von 11-20 km S. 17 - 20 Umkreis von 21-30 km S. 21 - 27 Umkreis von 31-40 km S. 28 - 33 Umkreis von 41-50 km S. 34 - 36 Umkreis ab 51 km S. 37 - 43 Legende und Erklärungen Um Ihnen die Orientierung zu Erleichtern haben wir die Ausflugstipps nach Distanzen und Himmelsrichtungen geordnet. Gemessen wurden die Entfernung jeweils ab Bahnhof Brig bis zu dem Punkt der per Auto am Reiseziel noch erreichbar ist. Auf folgende Symbole werden Sie in diesem Prospekt stossen: Anreisezeit bis zum genannten Ort mit dem Auto Distanz in Kilometer ab Bahnhof Brig mit dem Auto Um an den Ausflugstipp zu gelangen muss auf eine Berg- oder Zubringerbahn umgestiegen werden www.brig-simplon.ch Tel.: +41 (0)27 921 60 30 Änderungen bleiben vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung des Prospekts unterlaufen sind, ist jede Haftung ausge- schlossen.Inseratekauf und Korrekturwünsche bitte per Mail an [email protected]. Stand September 2014 / BST AG Blatten 15 min Brig 8 min 15 min Visp Termen Ausflugstipps im Umkreis von 0 - 10 km ab Brig www.brig-simplon.ch · [email protected] · T: +41 (0) 27 921 60 30 5 Bauernmarkt Brig 0 min 0 km Jeden Samstagmorgen findet im Zentrum von Brig ein Bauernmarkt statt, an dem die Bioproduzenten aus der Region frisches Gemüse, Früchte, Fleischwaren und Milchprodukte verkaufen. -

EDGG Field Workshops 2019 – the International Research Expeditions
Palaearctic Grasslands 41 (March 2019) 9 DOI: 10.21570/EDGG.PG.41.9-22 EDGG Event EDGG Field Workshops 2019 – the international re- search expeditions to study grassland diversity across multiple scales and taxa: Call for participation General Information Applications Background In general only EDGG members can participate in EDGG Field Workshops, but if non-members apply this will be Since 2009 (Dengler et al. 2009; Turtureanu et al. 2014) the considered as an application for free membership of the Field Workshops (formerly: Research Expeditions) are one EDGG. Any application for participation or travel grants of the major annual activities of EDGG. They aim to sample must be sent both to the Field Workshop Coordinator Jür- Palaearctic grasslands across multiple scales (0.0001–100 gen Dengler ([email protected]) and the m²) and multiple taxa (vascular plants, bryophytes and respective local contact person (see below). Deadline for lichens) to generate standardised high-quality biodiversity applications for both events in 2019 is the 31st of March data, together with in situ environmental and structural 2019. Confirmation of participation and feedback on travel data. The method of data sampling, first proposed by grant applications will be given as soon as possible after Dengler (2009), has been revised and improved from year this deadline, likely around the 10th of April. to year and has been recently described in detail (Dengler et al. 2016b). Together with the generation of high-quality All applicants except those who already participated in datasets, the exchange of knowledge between participants four or more Field Workshops have to submit a motivation from different countries and with diverse scientific inter- letter (10 lines maximum), explaining why they are inter- ests and backgrounds is an important aim of the EDGG ested in participation and what they would contribute to Field Workshops. -

WORLD MUSIC CONTEST Kerkrade (NL), Juli 2017
Jubiläumsprojekt 30 Jahre Oberwalliser Blasorchester www.obo-vs.ch Leitung Tobias Salzgeber OBOgoes WORLD MUSIC CONTEST Kerkrade (NL), Juli 2017 KONZERT Juli 2017, 20.00 Uhr Zentrum Sosta, Susten 1 Kontakt Korrespondenzadresse Oberwalliser Blasorchester Hauptstrasse 17 3943 Eischoll Projektverantwortliche Fabienne Schmidhalter-Gsponer Präsidentin [email protected] T 078 822 10 56 Sven Ritz Inhalt Vizepräsident [email protected] T 079 265 21 94 • Orchester | 3 • Provisorische Besetzung | 4 • Projekt 2016 | 5 • Projekt 2017 | 6 • Budget Kerkrade 2017 | 8 • Unterstützungsmöglichkeiten 1/3 | 9 • Unterstützungsmöglichkeiten 2/3 | 10 2 • Unterstützungsmöglichkeiten 3/3 | 11 Orchester Oberwalliser Blasorchester • Das Oberwalliser Blasorchester OBO wurde im Jahr 1987 gegründet. • In 29 Konzertprojekten hat es seither anspruchsvolle Kompositionen der verschiedensten Stile und Zeit- epochen einstudiert und auf nationalen und inter- Tobias Salzgeber, Dirigent nationalen Bühnen vorgetragen. • Geboren 1974 in Raron. 1995 Reifezeug- • Die Mitwirkenden sind Berufsmusiker, Musikstudenten nis am Lehrerseminar in Brig, danach und begeisterte Amateurmusiker aus allen Regionen Trompetenstudium am Konservatorium des Oberwallis sowie weitere ausgewählte Mitwirkende Bern mit Abschluss im Jahr 2000. aus der ganzen Schweiz. • 2004 Abschluss des Studiums der Blas- musikdirektion bei Josef Gnos an der Musikhochschule in Luzern. • 2004 bis 2006 Studium der Direktion und Instrumentation in der Masterklasse von Jan Cober in Maastricht. • Lehrer für Blechbläser