1 Andreas Heilmann Work in Progress: „Mein Chef Ist Schwul ... Was Tun
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

21. 3. Mai 1983: Fraktionssitzung
DIE GRÜNEN – 10. WP Fraktionssitzung: 3.5.1983 21. 3. Mai 1983: Fraktionssitzung AGG, B.II.1, 5317, 5318, 5321. »Protokoll der Fraktionssitzung vom 03. Mai 1983. Beginn der Sitzung um 09.00 Uhr«. Anwesend: Abgeordnete: Bard, Gert Bastian, Beck-Oberdorf, Burgmann, Drabiniok, Ehmke, Joschka Fischer, Gott- wald, Hecker, Hickel, Hoss, Jannsen, Kelly, Kleinert, Nickels, Potthast, Reents, Sauermilch, Schily, Dirk Schneider, Schoppe, Schwenninger, Stratmann, Verheyen, Vogt, Vollmer. Nachrückerinnen und Nachrücker: Arkenstette, Borgmann, Bueb, Daniels, Dann, Hönes, Horácˇek, Nor- bert Mann, Jo Müller, Rusche, Schierholz, Stefan Schulte, Senfft, Suhr, Tatge, Tischer, Axel Vogel, Marita Wagner, Gerd P. Werner, Helmut Werner, Zeitler. Landesvertreter ohne Mandat: Für das Bundesland Bremen von Gleich, für das Saarland Kunz. Protokoll: [Alleritz.] Tagesordnung: TOP 1: Kenntnisnahmen; Tagesordnung für die 4., 5. und 6. Sitzung des Deutschen Bundes- tages – Anlage – TOP 2: Gremienbesetzung – Anlage – TOP 3: Besetzung der Kommissionen des Ältestenrates – Anlage – TOP 4: Bericht über den Stand der Debattenvorbereitung TOP 5: Verschiedenes – nächste BHA-Sitzung, – Allgemeines zur Information. – Besuch Startbahn West am 07. Mai 82, 12.00 Uhr Hbf. Frankfurt, – Projekt »Zukunftswerkstatt« (Stand der Diskussion), – Nachrücker und soziale Bewegungen, – Fraktionsorganisation. TOP 1 wurde zur Kenntnis genommen. TOP 2 Otto Schily verliest Auszüge der Anlage zu TOP 2 (Gremienbesetzung)1 und bittet um Namens- vorschläge. 1 Die Anlage (vgl. AGG, B.II.1, 3060) enthält eine Übersicht des Allgemeinen Parlamentsdienstes vom 23. März 1983 zu »Gremien, denen Mitglieder angehören, die vom Bundestag bestimmt werden«, mit den jeweiligen gesetzlichen Grundlagen und Besetzungsmodalitäten, den auf die einzelnen Fraktionen in der 9. Wahlperiode entfallenen Sitzen sowie den Verteilungsschlüsseln der Sitze für die 10. -

Beschlußempfehlung Und Bericht Des 2
Deutscher Bundestag Drucksache 10/6584 10. Wahlperiode 27.11.86 Sachgebiet 1 Beschlußempfehlung und Bericht des 2. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes zu dem Antrag der Fraktion der SPD — Drucksache 10/3906 (neu) — Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und dem Ergänzungsantrag der Fraktion der SPD — Drucksache 10/4661 — Beschlußempfehlung Der Bundestag wolle beschließen: Der Bericht des 2. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgeset- zes wird zur Kenntnis genommen. Bonn, den 27. November 1986 Der 2. Untersuchungsausschuß Jahn (Marburg) Fellner Neuhausen Schäfer (Offenburg) Ströbele Vorsitzender Berichterstatter Drucksache 10/6584 Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode Gliederung Seite 1. Abschnitt: Einsetzung und Gang des Verfahrens 12 A. Auftrag und Besetzung des 2. Untersuchungsausschusses 12 I. Einsetzungsbeschluß und Ergänzungsbeschluß 12 II. Mitglieder des 2. Untersuchungsausschusses 13 B. Vorgeschichte und Parallelverfahren 13 I. Vorgeschichte 13 II. Parallelverfahren 14 C. Ablauf des Untersuchungsverfahrens 14 I. Konstituierung 14 II. Beweisaufnahme 14 III. Berichtsfeststellung 14 2. Abschnitt: Gegenstand der Untersuchung und festgestellter Sachver halt 15 A. Das Bundesamt für Verfassungsschutz als Bundesoberbehörde im Bereich der Inneren Sicherheit - 15 I. Dienst- und Fachaufsicht des Bundesministeriums des Innern über das Bundesamt für Verfassungsschutz 15 1. Begriff und Inhalt der Dienst- und Fachaufsicht 15 a) Fachaufsicht 15 b) Dienstaufsicht 15 c) Instrumente der Dienst- und Fachaufsicht 15 2. Verständnis der Dienst- und Fachaufsicht vor dem Hintergrund der Aufgabenstruktur des Bundesamtes für Verfassungsschutz 15 a) Allgemeines 15 b) Vollzug des Gesetzes zu Artikel 10 GG 16 Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode Drucksache 10/6584 Seite II. Organisation und Praxis der Zusammenarbeit zwischen Bundesmini- sterium des Innern und Bundesamt für Verfassungsschutz 16 1. Berichtswesen 16 2. -

Reden Und Taktieren Die Deutsche Tibetpolitik
Information der Tibet Initiative Deutschland e.V. INFOBLATT 13 Reden und Taktieren Die deutsche Tibetpolitik Schon damals zielte die Antwort der sowie Experten und Parlamentarier aus Bundesregierung darauf ab, die VR Großbritannien und Indien an. Eine China nicht zu provozieren. Buchdokumentation „Tibet klagt an“ Ein Jahr später, im Juli 1987, besuchte hielt die Aussagen und die Ergebnisse Bundeskanzler Helmut Kohl im Rahmen fest. einer Staatsvisite in der Volksrepublik Auch nach dem Tod von Petra Kelly und China die tibetische Hauptstadt Lhasa. Gert Bastian am 1. Oktober 1992 blieb Tibet Die offene Anerkennung der chinesi- ein Thema. Am 5. Mai 1995 beugte sich schen Ansprüche brachte dem Kanzler Bundesaußenminister Klaus Kinkel dem harsche Kritik ein. Helmut Kohl war der allgemeinen Druck und empfing als erster erste und bislang einzige amtierende Minister offiziell den Dalai Lama. Die an Regierungschef, der Tibet offiziell sich begrüßenswerte Initiative hatte einen einen Besuch abgestattet hat. seltsamen Beigeschmack, denn als der Dalai Lama dem Außenminister den tradi- Tibet im Bundestag tionellen Khatag (Begrüßungsschal) Anlässlich der Reise gab Petra Kelly beim überreichen wollte, wies dieser die Geste Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen brüsk zurück. Im deutschen Bundestag Bundestages eine Expertise zum völker- Gut einen Monat später erlebte das politi- rechtlichen Status von Tibet in Auftrag. sche Tibet-Engagement einen seiner Dabei ging es insbesondere um die Frage, Höhepunkte. Am 19. Juni 1995 organisierte Erst seit den achtziger Jahren ist Tibet ein ob China einen Rechtsanspruch auf Tibet der Auswärtige Ausschuss eine offizielle Thema in der internationalen Politik, wenn erheben kann. Die Wissenschaftler kamen Anhörung zu Tibet, zu der als man von wenigen Initiativen kurz nach zu einem eindeutigen Urteil: „China hat Hauptredner der Dalai Lama geladen war. -

G. Verzeichnis Der Dokumente I. Konstituierung
DIE GRÜNEN – 10. WP Verzeichnis der Dokumente G. Verzeichnis der Dokumente Nr. der Datum Edierte Dokumente, nachgewiesene Sitzungen und jeweilige Seite Dok.- Bestandsangabe Gruppe I. Konstituierung 1 16.1.1983 Beschlüsse der Bundesdelegiertenversammlung in Sindel- 5 fingen (AGG, B.I.1, 542) 2 11.–13.2.1983 Treffen der zukünftigen Bundestagsfraktion 7 (AGG, B.II.1, 3060) 3 8. 3. 1983 Fraktionssitzung 8 (AGG, B.II.1, 5317) A 7. 3. 1983 Pressemitteilung der Bundesgeschäfsstelle der GRÜNEN 11 (AGG, B.II.1, 5321) 4 9. 3. 1983 Fraktionssitzung 15 (AGG, B.II.1, 5317, 5318) A 10.3.1983 Aktennotiz von Bernd Faller 17 (AGG, B.II.1, 3376) B 9. 3. 1983 Protokollanhang: Kriterien Raumfrage 19 (AGG, B.II.1, 5318) C 9. 3. 1983 Sitzungsunterlage: Organisatorischer Fahrplan für den Auf- 19 bau der GRÜNEN Bundestagsfraktion (AGG, B.II.1, 5317) 5 14.3.1983 Fraktionssitzung 21 (AGG, B.II.1, 5318) A 14.3.1983 Sitzungsunterlage: Vorlage von Roland Vogt zur Friedens- 26 politik (AGG, B.II.1, 5318) B 14.3.1983 Sitzungsunterlage: Vorlage von Roland Vogt 27 (AGG, B.II.1, 5318) 6 15.3.1983 Fraktionssitzung 29 (AGG, B.II.1, 5317, 5318) 7 17.3.1983 Fraktionssitzung 32 (AGG, B.II.1, 5318) A 18.3.1983 Protokollanhang: Nachtrag zum Protokoll von Willi Tatge 35 (AGG, B.II.1, 5318) B 17.3.1983 Schreiben der Bundesgeschäftsstelle der GRÜNEN an alle 35 Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN IM BUNDESTAG (AGG, B.II.1, 394) Copyright © 2017 KGParl 1 Verzeichnis der Dokumente DIE GRÜNEN – 10. -
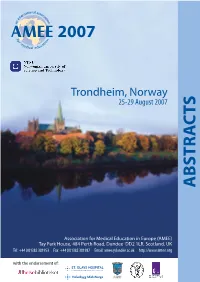
AMEE 2007 Abstract Book
2007 Trondheim, Norway 25-29 August 2007 ABSTRACTS Association for Medical Education in Europe (AMEE) Tay Park House, 484 Perth Road, Dundee DD2 1LR, Scotland, UK Tel: +44 (0)1382 381953 Fax: +44 (0)1382 381987 Email: [email protected] http://www.amee.org with the endorsement of: TRONDHEIM KOMMUNE Contents Session 1 1A Plenary Learning by doing .. .. .. .. .. 1 Session 2 2A Symposium ‘Playing the game’: structured educational experiences .. .. .. 3 2B Symposium Deliberate practice in medical education .. .. .. .. 3 2C Short Communications e-Learning resources .. .. .. .. .. 3 2D Short Communications Teaching and learning evidence-based medicine .. .. .. 4 2E Short Communications Curriculum: The education environment .. .. .. .. 6 2F Short Communications Assessment: Standard setting .. .. .. .. 7 2G Short Communications Assessment: The fi nal exam .. .. .. .. .. 8 2H Workshop Use of Generalizability Theory in designing and analyzing performance-based tests 9 2I Workshop Developing and evaluating item-based assessment tools: applying new concepts in validity to medical education .. .. 9 2J Workshop How can workplace teaching and learning be illuminated by contemporary sociocultural theory? .. .. .. .. 9 CONTENTS 2K Workshop A practical introduction to assessing the CanMEDS competencies .. .. 10 2L Workshop The student in diffi culty .. .. .. .. .. 10 2M Posters Admissions/Selection .. .. .. .. .. 10 2N Posters Communication skills and clinical teaching .. .. .. 13 2O Posters Simulation and new learning technologies .. .. .. 16 2P Posters What is a good teacher? / Medical education .. .. .. 20 2Q Workshop The Innocent Murmur: methods of eff ective instruction and assessment .. 23 2R Good Ideas in Medical Education (GIME) 1 The Curriculum .. .. .. .. .. .. 23 – i – Session 3 3A Symposium Patient focused simulation .. .. .. .. .. 25 3B Symposium Best Evidence Medical Education (BEME) .. .. .. .. 25 3C Symposium Comprehensive teaching, implementation and practice of evidence-based medicine 25 3D Short Communications e-PBL and collaborative learning . -

LGBT Politics in a Europeanized Germany: Unification As a Catalyst for Change Louise K. Davidson-Schmich University of Miami
LGBT Politics in a Europeanized Germany: Unification as a Catalyst for Change Louise K. Davidson‐Schmich University of Miami Paper Presented at the 2017 European Union Studies Association Conference Miami, FL May 5, 2017 Abstract: The two and a half decades since unification have brought about significant paradigm changes in German social policies toward lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) citizens including, inter alia, the legalization of same‐sex partnerships, an expansion of the rights granted to these same sex couples, and reforms allowing individuals to change their legal gender without divorcing or undergoing irrevocable surgeries. This article investigates developments that led the government of the Federal Republic, long dominated by socially‐conservative Christian Democrats, to extend greater rights to sexual minorities in the years following unification. The explanation lies in LGBT activists’ use of what van der Vleuten (2005) refers to as “pincer” tactics, working not only at the national but also at the European level to pressure reluctant domestic actors. Unification proved a critical juncture on both fronts, leading to the creation of a politically‐ influential, pan‐German LGBT organization at the domestic level and to institutional changes conducive to LGBT activism at the European Union level. In the language of the introduction to this volume, unification had an indirect effect on LBGTI rights, leading to a gradual increase in rights for sexual minorities, driven by a combination of activism from the “outside in” and the “inside out.” This article “brings in” the study of gender and sexuality to the literature on post‐ communist transformations. Note: A version of this paper is scheduled to appear in a forthcoming special issue of German Politics, commemorating the 25th anniversary of German unification. -

Bericht Und Handlungsempfehlungen
Kommission zur Aufarbeitung der Haltung des Landesverbandes Berlin von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN zu Pädophilie und sexualisierter Gewalt gegen Kinder von der Gründungs- phase bis in die 1990er Jahre Bericht und Handlungsempfehlungen INHALT 1 Einführung 3 2 Chronologie der Debatte von 1978 bis 1995 5 3 Die Debatte in Berlin 20 3.1 Die wichtigsten Debattenstränge in der AL Berlin 20 3.2 Debattenkultur: Schutz der Minderheiten 24 3.3 Der Schwulenbereich des Landesverbandes 28 3.4 Der AL-Frauenbereich und die Kreuzberger Frauen: Zweifel und Gegenwehr 52 3.4.1 Die Kreuzberger AL-Frauengruppe: Eine Innenansicht 63 3.5 Die Rolle der Gremien und Parteistrukturen 67 3.6 Die Rolle der Abgeordnetenhausfraktion 69 3.7 Umgang mit Tätern und Opfern 82 4 Fazit und Handlungsempfehlungen 87 2 1 EINFÜHRUNG Auf seiner Landesdelegiertenkonferenz am 30. November 2013 beschloss der Berliner Landesverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, „eine Kommission bestehend aus grünen Vertreterinnen und Vertretern, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Expertinnen und Exper- ten“ zu berufen. Ihre Aufgabe sollte es sein, „die Haltung des Landesverbands zu Pädo- philie und sexualisierter Gewalt gegen Kinder von der Gründungsphase bis in die 1990er Jahre“ zu untersuchen sowie einen Abschlussbericht und Handlungsempfehlungen vor- zulegen. Der Landesverband hatte sich bereits im Jahr 2010 mit einem Parteitagsbe- schluss von Positionen zugunsten der Straffreiheit von vermeintlich einvernehmlicher Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen aus der Gründungsphase der Partei dis- tanziert. Eine gründliche Aufarbeitung sowie inhaltliche Auseinandersetzung stand aber noch aus. Zu den weiteren Gründen für die Einsetzung einer eigenen Kommission zur Aufarbeitung zählte, dass im Berliner Landesverband – anders als in anderen Landes- verbänden – auch verurteilte pädosexuelle Straftäter zu den Akteuren der Debatte ge- hörten und diese zudem bis Mitte der 1990er Jahre andauerte, obwohl die innerparteili- che Diskussion auf Bundesebene bereits Ende der 1980er Jahre beendet worden war. -

Forum Demokratieforschung Beiträge Aus Studium Und Lehre
Working Paper No 4 Forum Demokratieforschung Beiträge aus Studium und Lehre Working Paper‐Reihe im Fachgebiet Demokratieforschung am Institut für Politikwissenschaft der Philipps Universität ‐Marburg Working Paper No 4 Die Piratenpartei ‐ Niedergang einer politischen Bewegung? Hausarbeit im Rahmen des Seminars "Parteiendemokratie im Umbruch? Parteien und Gesellschaft in Deutschland", Basismodul „Einführung in das politische System der BRD“ (Wintersemester 2013/2014) bei Prof’in Dr. Ursula Birsl am Institut für Politikwissenschaft der Philipps‐Universität Marburg von Carmelito Bauer Titelbild: Füllhorn von Christel Irmscher (Original: Acryl auf Leinwand 1997) Impressum Forum Demokratieforschung, Working Paper Reihe im Fachgebiet Demokratieforschung Am Institut für Politikwissenschaft an der Philipps Universität‐Marburg, Beiträge aus Studium und Lehre Herausgeberinnen: Prof’in Dr. Ursula Birsl, Matti Traußneck (M.A. Politologin), Ina Pallinger Working Paper No 4 (Mai 2014) ISSN 2197‐9483 http://www.uni‐marburg.de/fb03/politikwissenschaft/institut/lehrende/birsl/forumdemokratie Kontakt: Prof’in Dr. Ursula Birsl Matti Traußneck Philipps Universität‐Marburg Institut für Politikwissenschaft Wilhelm‐Röpke‐Str. 6G DE‐35032 Marburg E‐Mail: [email protected]‐marburg.de [email protected]‐marburg.de INHALT Einleitung ................................................................................................................................ 7 1. Theoretischer Überbau: Bewegungen im digitalen Zeitalter ........................................ -

17. 19. April 1983: Fraktionssitzung
DIE GRÜNEN – 10. WP Fraktionssitzung: 19.4.1983 17. 19. April 1983: Fraktionssitzung AGG, B.II.1, 5318, 5319. Überschrift: »Protokoll der Fraktionssitzung vom 19.4.83. Beginn: 11.15 Uhr« – »Protokoll der Plenarsitzung der Fraktion vom 19.04.1983, Teil II: ab 19.05 Uhr«. Anwesend:1 Abgeordnete (Vormittagssitzung): Bard, Beck-Oberdorf, Burgmann, Drabiniok, [Ehmke], Joschka Fischer, Gottwald, Hecker, Hickel, Hoss, Jannsen, Kleinert, Krizsan, Nickels, Potthast, Reents, Reetz, Sau- ermilch, Schoppe, Schwenninger, Stratmann, Verheyen, Vogt, Vollmer. Nachrückerinnen und Nachrücker (Vormittagssitzung): Arkenstette, Auhagen, Borgmann, Bueb, Daniels, Dann, Eid, Hönes, Horácˇek, Lange, Norbert Mann, Jo Müller, Rusche, Christian Schmidt, Stefan Schulte, Senfft, Suhr, Tatge, Axel Vogel, Volmer, Marita Wagner, Gerd P. Werner, Helmut Werner, Zeitler. Abgeordnete (Nachmittagssitzung): Bard, Gert Bastian, Beck-Oberdorf, Burgmann, Drabiniok, [Ehm- ke], Joschka Fischer, Gottwald, Hecker, Hickel, Hoss, Jannsen, Kelly, Kleinert, Krizsan, Nickels, Reents, Reetz, Sauermilch, Schily, Dirk Schneider, Schoppe, Schwenninger, Stratmann, Vogt, Vollmer. Nachrückerinnen und Nachrücker (Nachmittagssitzung): Arkenstette, Auhagen, Borgmann, Daniels, Fritsch, Horácˇek, Norbert Mann, Jo Müller, Rusche, Schierholz, Christian [Schmidt], Stefan Schulte, Senfft, Suhr, Tatge, Tischer, Marita Wagner, Gerd P. Werner. Landesvertreter ohne Mandat: Für das Bundesland Bremen von Gleich, für das Saarland Kunz. Sonstige: Fraktionsgeschäftsführung: Meiners, Pauly, Schata. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Frieß, Gampert, Hönigsberger, Sarah Jansen, Thimme. Gäste: [Lukas Beckmann] (Bundesgeschäftsführer), Gaugel (Rechtsanwältin, Bewerberin für das Justitiariat) – Guiffabeck, Kuby. TOP 1: Aktuelle Stunde Joschka Fischer erinnerte an eine Demo an der Startbahn West am 7.5.83. Um zahlreiche Teil- nahme von Mitgliedern der Bundestagsgruppe wird gebeten, da bei unserem Einzug in den Bun- destag 28 Mitglieder der Startbahn BI anwesend waren. Eine Interessentenliste wurde durch- gereicht. -

Abstr a C Ts
2007 Trondheim, Norway 25-29 August 2007 ABSTRACTS Association for Medical Education in Europe (AMEE) Tay Park House, 484 Perth Road, Dundee DD2 1LR, Scotland, UK Tel: +44 (0)1382 381953 Fax: +44 (0)1382 381987 Email: [email protected] http://www.amee.org with the endorsement of: TRONDHEIM KOMMUNE Contents Session 1 1A Plenary Learning by doing .. .. .. .. .. 1 Session 2 2A Symposium ‘Playing the game’: structured educational experiences .. .. .. 3 2B Symposium Deliberate practice in medical education .. .. .. .. 3 2C Short Communications e-Learning resources .. .. .. .. .. 3 2D Short Communications Teaching and learning evidence-based medicine .. .. .. 4 2E Short Communications Curriculum: The education environment .. .. .. .. 6 2F Short Communications Assessment: Standard setting .. .. .. .. 7 2G Short Communications Assessment: The fi nal exam .. .. .. .. .. 8 2H Workshop Use of Generalizability Theory in designing and analyzing performance-based tests 9 2I Workshop Developing and evaluating item-based assessment tools: applying new concepts in validity to medical education .. .. 9 2J Workshop How can workplace teaching and learning be illuminated by contemporary sociocultural theory? .. .. .. .. 9 CONTENTS 2K Workshop A practical introduction to assessing the CanMEDS competencies .. .. 10 2L Workshop The student in diffi culty .. .. .. .. .. 10 2M Posters Admissions/Selection .. .. .. .. .. 10 2N Posters Communication skills and clinical teaching .. .. .. 13 2O Posters Simulation and new learning technologies .. .. .. 16 2P Posters What is a good teacher? / Medical education .. .. .. 20 2Q Workshop The Innocent Murmur: methods of eff ective instruction and assessment .. 23 2R Good Ideas in Medical Education (GIME) 1 The Curriculum .. .. .. .. .. .. 23 – i – Session 3 3A Symposium Patient focused simulation .. .. .. .. .. 25 3B Symposium Best Evidence Medical Education (BEME) .. .. .. .. 25 3C Symposium Comprehensive teaching, implementation and practice of evidence-based medicine 25 3D Short Communications e-PBL and collaborative learning . -

Book of Abstracts (PDF)
Tagungsband 2010 Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung Ruhr‐Universität Bochum 23.–25. September 2010 Tagungsband Für diese Publikation gelten die Creative Commons Lizenzbedingungen Namensnennung‐Keine kommerzielle Nutzung‐Keine Bearbeitung 3.0. Herausgeber: GMA Kongress 2010 Ruhr‐Universität Bochum Tagungspräsidenten: Prof. Dr. Thorsten Schäfer, Prof. Dr. Herbert H. Rusche Die Online‐Veröffentlichung dieses Abstractbandes finden Sie im Portal German Medical Science unter http://www.egms.de/en/meetings/gma2010/ Veranstalter Zentrum für Medizinische Lehre in der Medizinischen Fakultät Ruhr‐Universität Bochum Universitätsstraße 150 • 44801 Bochum im Auftrag der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung Tagungspräsidenten Prof. Dr. Herbert H. Rusche Prof. Dr. Thorsten Schäfer Organisationsteam GMA‐Bochum Dr. Andreas Burger Karlheinz Ehrlich Dr. Bert Huenges Kathrin Klimke‐Jung Dr. Dieter Klix Dipl.‐Soz. Wiss. Ute Köster Karin Koppenhagen Hille Lieverscheidt Dipl.‐Soz. Wiss. Michaela Pieper Dr. Ralf Sander und die Mitarbeiter/innen des Studiendekanats Sekretariat Dagmar Zacher Zentrum für Medizinische Lehre Ruhr‐Universität Bochum Universitätsstraße 150 • 44801 Bochum [email protected] Telefon +49 (0)234 3 22 48 41 • Fax +49 (0)234 3 21 48 05 Wissenschaftlicher Beirat Dr. Jan P. Ehlers (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover) Prof. Dr. Martin R. Fischer (Universität Witten/Herdecke) Prof. Dr. Rosemarie Forstner (PMU Salzburg/AT) Waltraud Georg (Helios‐Klinik Berlin) Prof. Dr. Andreas Guse (Universität Hamburg) Prof. -

Aufarbeitung Und Verantwortung –
AUFARBEITUNG UND VERANTWORTUNG – Berichte und Dokumente zur Arbeit der Arbeitsgruppe Aufarbeitung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1 AUFARBEITUNG UND VERANTWORTUNG – Berichte und Dokumente zur Arbeit der Arbeitsgruppe Aufarbeitung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Inhalt Aufarbeitung und Verantwortung - Vorwort von Simone Peter und Michael Kellner 5 1 Die Tätigkeit der AG Aufarbeitung 11 1.1 Einsetzung der Arbeitsgruppe 11 1.1.1 Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung und Aufklärung der gegen die Grünen der 1980er Jahre erhobenen Vorwürfe der Unterstützung pädophiler Aktivisten und Bestrebungen - Beschluss der Bundesdelegiertenkonferenz Berlin, 20. Oktober 2013 11 1.1.2 Einsetzungsbeschluss des Bundesvorstandes vom 9. Dezember 2013 11 1.2 Zeitzeugengespräche der AG Aufarbeitung 15 1.2.1 Schwulenbewegung 15 1.2.2 Frauenbewegung 17 1.2.3 Rechtsdiskussion 19 1.2.4 Gesellschaftliche Einflüsse 21 1.2.5 Gespräch mit Daniel Cohn-Bendit und Adrian Koerfer 23 1.3 Die Aufarbeitungs-Debatte auf der BDK in Hamburg 38 1.3.1 Verantwortung für die eigene Geschichte übernehmen - Beschluss der Bundesdelegiertenkonferenz vom 22. November 2014 39 1.3.2 Rede von Adrian Koerfer, Vorsitzender von Glasbrechen e.V. 42 1.4 Argumentationshilfe der AG Aufarbeitung für die Kreisverbände 46 1.5 Der Anhörungsbeirat für Betroffene 49 1.5.1 Einsetzung des Anhörungsbeirats - Beschluss des Bundesvorstands vom 18.05.2015 49 1.5.2 Regeln zu Arbeit und Organisation des Anhörungsbeirats 51 1.5.3 Grüne beschließen Anerkennungszahlung an Opfer sexuellen Missbrauchs – 53 Pressemitteilung vom 21.09.2015 53 1.6 Politische und strukturelle Konsequenzen 2 1.6.1 Leitfaden für die Landes- und Kreisverbände 54 1.6.2 Ombudspersonen in den Geschäftsstellen 55 1.6.3 Kinder schützen – Prävention stärken.